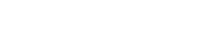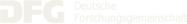Ich bringe Dir Weniges dar, mit dem Wunsche Vieles dafür wiederzuerhalten. Werde mein Lehrer und Vorbild. – Ich kann nur das Wesentlichste berühren, und darf es, weil Du auch Winke verstehn wirst. Erinnre Dich zu Zeiten, daß die hergebrachten <Worte> leicht das Schöne geben, als wähnte man, das sey Wahl, was doch nur Natur ist.
In einem dichterischen Kunstwerke muß die Ordnung richtig und schön seyn, der Stoff wahr, die Ausführung gut.
Es giebt nur zwey Gesetze für die Dichtkunst. Eines derselben ist – das Mannichfaltige muß zu innerer Einheit nothwendig verknüpft seyn. Zu Einem muß alles hinwirken, und aus diesem Einem, jedes Andren Daseyn, Stelle und Bedeutung nothwendig folgen. Das, wo alle Theile sich vereinigen, was das Ganze belebt und zusammenhält, das Herz des Gedichtes liegt oft tief verborgen. So ist es im Hamlet seine Stimmung – die ihm ganz eigenthümliche Ansicht von der Bestimmung des Menschen. Im Götz vom Berlichingen ist es der deutsche Rittergeist, sein letztes Aufstreben, ehe er erlischt. Einige der Handelnden stellen gleichsam das neue Jahrhundert vor, wie es mit dem alten kämpft – mit Götz und seinen Genossen stirbt die Tugend und die Zeit der Helden. Im Romeo ist Einheit, aber noch habe ich sie nicht erforschen können. Und im Karlos habe ich sie vergeblich gesucht. – Ohne Natureinheit und Vernunfteinheit (von der unten geredet wird) ist die höchste Schönheit der Anordnung unmöglich. Diese leidet sonst keine Vorschriften. Zu ihr gehört die Vertheilung in kleinere Ganze, welche unter andern auch durch die willkührlichen Einschnitte des Versbaues bewirkt wird. Die Theile müssen in das grössere Ganze sanft verschweben, wie Wellen des Stromes. Daß eine Reihe von Gemälden gleicher Größe, in ähnliche Rahmen eingesetzt, ein Ganzes natürlich bilden können, kann ich nicht glauben. Doch umschreibe ich vielleicht mit Unrecht die Stanzen so. – Es kann hier gar nicht die Rede seyn von der armseeligen Kunst, die Neugier zu spannen, die selbst Schillers größtes Werk verunstaltet.
Zur Wahrheit gehört erstens die Tiefe im Gegensatz zur Flachheit, dem untrüglichen Kennzeichen der Gemeinheit. Auf jene haben unsre drey Dichter gleiche Ansprüche. – Zum andern wird erfordert die Aehnlichkeit mit der Natur. – Ehe der Geist mit der Natur Eins ist, wirkt er zu sehr nur aus sich und aus seinen Begriffen, weiß nicht sich dem Wirklichen anzuschmiegen, wie Schiller, dessen Erfindungen eckigt sind, wie die Thaten eines großen Jünglings. – Wenige nur vernehmen den leisen Gang der Natur in der Zeit. Göthe kennt die Welt und einige Leidenschaften, und Klopstock lauschte sehr glücklich auf die zarte Stimme in seinem Innern. Schiller ist abgerißen und unnatürlich. – Ein Höchstes läßt sich hier nicht bestimmen. Shakespeare ist unter allen Dichtern der Wahrste. –
Die Ausführung oder Bezeichnung verlangt Reinheit und Lebendigkeit. Zur letzteren gehört das meiste des Versbaues. Die Fehler wieder die Reinheit sind am leichtesten anzugeben, und Wieland kann als ein vollständiges Beyspiel derselben angesehen werden. Ein Höchstes läßt sich nicht bestimmen. Vielleicht kann selbst Klopstock noch übertroffen werden.
Der Character des Dichters ist Trieb zur Darstellung selbst; und zwar eines dichterischen Stoffes. Seine Vollkommenheit, die allgemeine Fähigkeit alles gut darzustellen, und es scheint dieses Göthens Absicht gewesen zu seyn.
Ein blos vollkommenes Gedicht wird schon alle Erkenntnißkräfte üben und schärfen, durch Schönheit und Zweckmäßigkeit den Geist vergnügen, und die Triebe in Spiel setzen. Um aber das ernste Lob derer zu verdienen, die über Werth und Unwerth allein gültige Richter sind, muß es mehr als vollkommen seyn, einen großen Gehalt haben; ‚mußʻ, wie Klopstock sagt, ‚uns mächtig daran erinnern, daß wir unsterblich sindʻ. Nur der menschliche, selbstthätige Geist und seine Thaten haben selbsteignen Werth. Je menschlicher, je würdiger! – So viel geistiges Leben ein Werk enthält, so viel Werth hat es. – Die höchste Thätigkeit, Vollkommenheit und Harmonie aller unsrer Kräfte, innigster Genuß unsres eigensten Selbst, Erhebung, Seeligkeit selbst kann die Wirkung eines Kunstwerkes seyn. Aber auch die besten haben nur geringen Werth. Ich würde Schiller unter den Deutschen nennen, wenn er so viel Harmonie besäße, als kämpfende Kraft, und ungeheure Einbildung. – Man darf fordern, daß die Werke des Dichters nicht kleiner sind, als er selbst, wie man Göthen Schuld giebt. – Ueber den Gehalt ist es am schwersten zu urtheilen, wie über die Wahrheit eines Gedichts. Es giebt nur ein unbedingtes Gesetz – Vernunfteinheit, nehmlich daß der <freye> Geist stets siege über die Natur. Vielleicht machte im Hamlet, der Inhalt selbst – der Selbstmord des freyen Geistes an sich selbst – eine einzige Ausnahme möglich und erlaubt. Aber ich halte es noch für unentschieden, ob dieses bewunderungswürdige Werk <überall> verstanden werden kann. Sonst ist die kleinste Verletzung unsrer heiligsten Kraft, vollständig und unverzeihlich. – Beym Schluß epischer und dramatischer Werke ist es höchst schwer, beyde Vernunft und Natur zu befriedigen. –
Wenn man erwägt, wie eng der Umfang auch der weniger vortreflichen ist, so möchte man wohl sagen; es giebt eine eigne Poesie nicht nur für jeden Stand, Volk, Zeitalter; sondern selbst für jeden Einzelnen. Zwar Alles Gute, aller Geist ist eigentlich allgemein; aber der Geist, der zu eigenthümlich wirkt, ist nur denen Wenigen verständlich, deren Sphäre sehr groß ist. Unsre Künstler dichten meist nur für sich selbst, und denken so wenig an die Welt, wie diese an sie. Und doch ist es eine ewige Wahrheit; wer für die Welt lebt, in dessen Herzen muß Raum seyn für eine Welt. <Shakespeare möchte man den Grenzenlosen nennen.> Deutsche Kraft ist schon oft unsichtbar verschwendet [worden]. Man denke nur an Klopstocks Christenthum und Grammatik, und manche Laune von Göthen.
Den großen Gebrauch, den die Kunst von der äußern Welt derer machen kann, für die sie dichtet, haben die Deutschen lange geahndet, nur irrten sie oft, wie im Götz, den Bardieten, in Hans Sachsens Manier und mehrern andern mißglückten Hoffnungen.
Auf die große Frage; ‚ob das Ziel schon erreicht sey?ʻ – ruft uns alles laut die Antwort entgegen, welche der heilige Ahnherr deutscher Kunst ahnend aussprach – ‚Noch viel Verdienst ist übrig.ʻ Mir däucht der Tag bricht an unter uns, und wenn es wird, wird es ein großer Tag werden.
Fr. Schlegel.