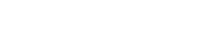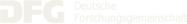Niebuhr hat mir auf die Anfrage, die ich bei ihm, auf Ew. Hochwohlgebohrnen Veranlassung, that, geantwortet, daß es auf der Vaticana zwar tamulische, allein keine Sanskrit Manuscripte giebt, daß er auf der Propaganda aber noch nachsuchen will.
Eben als ich dies Ew. Hochwohlgebohrnen mittheilen wollte, erhalte ich das dritte Heft Ihrer Indischen Bibliothek, das mir so vorzüglich lehrreich gewesen ist, daß ich mir die Freude nicht versagen kann, Ihnen selbst dafür sogleich zu danken, und Sie zugleich um Erlaubniß zu bitten, Ihnen einige Fragen dabei vorzulegen.
Die, meinem Urtheile nach, sehr schön geschriebene lateinische Abhandlung hat mich ungemein angezogen, und ich habe sie mehr als einmal gelesen, da sie mehrere Punkte enthält, die sich auch auf dem Wege meiner Untersuchungen befinden.
Ew. Hochwohlgebohrnen verwerfen p. 283. die Meynung, daß das Bas Breton Celtischen Ursprungs seyn sollte. Allein dürfte das nicht, ungeachtet der von Ihnen an dieser Stelle angeführten Gründe, wirklich der Fall seyn? Möge auch dieser Dialect in seiner heutigen Gestalt erst im 5. saeculum von Britannien herübergekommen seyn, so ist die Vorfrage die, ob nicht eben die einheimische Sprache Britanniens Celtisch war? Dies nun ist mir, obgleich ich die Sprachen selbst zu wenig kenne, höchst wahrscheinlich. Denn ich nenne Celtisch nur die Sprache der alten Gallier, und die Gallischen Ortnamen und mehrere Gallische Worte der Alten finden in diesen alteinheimischen Sprachen Englands ihre Erklärung und Ableitung. Ich möchte daher immer dabei bleiben, [2] daß dieser Punkt erst durch fernere Untersuchung dieser Sprachen so weit gebracht werden könne, daß sich ein entscheidendes Urtheil darüber fällen ließe.
Sehr anziehend ist mir S. 285–287. gewesen, was über die Wichtigkeit des grammatischen Baues bei Beurtheilung der Sprachabstammung gesagt ist. Es ist mir, wie aus der Seele geschrieben, und ich habe in einigen in der Akademie vorgelesenen Abhandlungen gerade auch geäußert, daß die grammatischen Eigenthümlichkeiten, als inniger mit der Denkweise verwandt, nicht, gleich den Wörtern, wandern können. Sehr gewünscht aber hätte ich, Ew. Hochwohlgebohrnen hätten diesen Punkt weiter verfolgt und mehr ausgeführt. Denn im Einzelnen erheischt er freilich viele, und zum Theil schwierige und feine Bestimmungen, zu denen ich vorzüglich oft jetzt geleitet werde, da ich mich mit der Untersuchung von Sprachen beschäftige, welche bei anscheinend sehr ähnlichem grammatischem Bau große lexikalische Verschiedenheit haben. Zuvörderst muß man wohl verstehen, was man ähnliche, oder verschiedene Grammatik nennt. Auch bei völliger Gleichheit im Ganzen kann es große Verschiedenheiten im Einzelnen geben, wie man am Mangel der Geschlechtsbezeichnung im Englischen (der aber wohl nur aus der flachen, verwischenden Aussprache herkommt) und dem Dänischen Passivum sieht. Ferner gehen wohl auch einzelne grammatische Eigenthümlichkeiten von einem Volke auf das andre über. So dürfte die Englische Gerundiv Construction, die man gewöhnlich participium indeclinabile nennt, it having been cet. nur aus dem Lateinischen, oder Französischen angenommen worden seyn. Nach vielem Nachdenken hierüber scheint es mir, daß man weit sicherer aus der grammatischen Beschaffenheit auf die Verschiedenheit, als auf die Verwandtschaft der Sprachen schließen kann. So ist die Grammatik immer das sichere Fundament, wo[3]rauf ich mein Urtheil stütze, daß das Baskische eine eigenthümliche und Muttersprache ist, und wenn auch ¾ ihrer Wörter mit Recht könnten der Verderbung aus bekannten Sprachen zugeschrieben werden, würde jenes Urtheil dadurch nicht bei mir wankend werden. Ebenso gewiß ist es, daß, wenn auch das Lateinische wirklich Baskische Wörter und sogar in großer Anzahl haben sollte, es darum doch immer in keine nähere Verwandtschaft mit dieser Sprache träte, als die dadurch begründet wird. Denn es giebt natürlich mehrere Grade und Arten der Verwandtschaft. Allein für weit schwieriger halte ich den Schluß auf die Verwandtschaft aus dem grammatischen Bau, und wenigstens muß man dabei, dünkt mich, nothwendig genau die verschiedenen Theile unterscheiden, aus welchem der grammatische Bau besteht. Man kann darin, meiner Erfahrung nach, unterscheiden: 1. dasjenige, was bloß auf Ideen und Ansichten beruht, und wovon man eine Schilderung machen kann, ohne nur Einen Laut der Sprache zu erwähnen; z. B. ob die Sprache eigne Verba hat, oder jedes Wort als ein Verbum behandeln kann, ob das Pronomen bloß den Begriff der Person enthält, oder auch den des Seyns und dadurch zum Verbum substantivum wird, ob es ein passivum giebt, oder man das passivum nur wie ein impersonales Activum behandelt u. s. f. 2. die technischen Mittel, die grammatischen Verschiedenheiten zu bezeichnen, ob durch Affixa, Umlaut, Silbenwiederholung u. s. f. 3. die wirklichen Laute, die grammatischen Bildungssilben, wie das a privativum, die Substantivendungen u. s. f. Wo die Aehnlichkeit durch alle drei Punkte durchläuft, ist kein Zweifel über die Verwandtschaft vorhanden. Allein schwierig wird die Frage da, wo sie sich nur in dem einen, oder anderen findet? Der letzte hat eine sehr genaue Aehnlichkeit mit der Mittheilung wirklicher Wörter. Er gehört zum Theil zum lexikalischen Theil der Sprache, um so mehr, da in allen Sprachen viele Affixa ehemalige Wörter sind. An sich nicht verwandte Sprachen können daher auch darin gegenseitig von einander aufnehmen. Das [4] Englische, dessen Grammatik durchaus Deutschen Ursprungs ist, so viele Lateinische Wörter es auch hat, besitzt solcher Silben aus beiden Sprachen, wie das privative un und dis, und viele andre Beispiele beweisen. Es zeigt aber, daß nur un ihm eigenthümlich ist, da es dies auch mit lateinischen Wörtern verbindet. Dieser Theil der Grammatik scheint mir am meisten für die Verwandtschaft, oder dagegen zu beweisen, weil er der speciellste ist, und die Aehnlichkeit, oder Verschiedenheit daher am wenigsten allgemeine Gründe haben kann, sondern auf zufälligeren historischen beruhen muß. Denn darauf kommt doch am Ende Alles zurück, wieviel in dem Sprachbau in Ansichten gegründet ist, die einen Grad der Allgemeinheit bei dem Menschengeschlecht überhaupt, oder bei gewissen unter gleichen Verhältnissen lebenden Nationen haben. Ew. Hochwohlgebohrnen scheinen dies zwar gewissermaßen zu verwerfen, indem Sie sagen a lege quadam naturae ejusmodi inventa pendere non facile dixeris, und ich bin in der auf diese Stelle folgenden Behauptung ganz Ihrer Meynung, daß nicht alle Sprachen denselben grammatischen Gang genommen zu haben brauchen. So überzeugt ich bin, daß es keine Sprache giebt, in welcher nicht wahre Agglutination eine sehr große Rolle spiele, so wenig theile ich die Meynung einiger, die alle Flexion verwerfen, und billige noch weniger alle neuerlich gemachten Versuche der Analyse von Agglutinationen. Es ist daher gar nicht mein System, daß alle Grammatik ursprünglich ein an einander Reihen wirklicher Wörter gewesen sey, und daß dies gedauert habe, bis der Gebrauch die Spuren verwischt habe. Einiges ist auch ursprünglich nicht ein solches Agglutiniren gewesen, und nicht bloß in den gebildeten, sondern in ganz rohen Sprachen, wo z. B. eine Amerikanische Sprache den Optativ immer durch Verdoppelung des Vocals bildet, waadehan statt wadehan, um die Sehnsucht an[5]zuzeigen, eine andre bei Bildung des Particips den Vocal in einen Diphthongen verwandelt u. s. f. Es ist hernach nicht bloß die Zeit gewesen die verändert hat, und nicht jede Nation ist alle Stufen durchlaufen, sondern einige haben viele übersprungen und sind sogar auf einem ganz andern Wege, als der mechanische ist, zum Ziele gelangt. Denn, meiner Art nach, die Geschichte der Sprachen zu erklären, nehme ich immer die beiden Fundamente an: diejenige Sprachentwicklung, die sich aus allgemeinen Begriffen nachweisen läßt, und die daher, wie Alles, was wir logisch verfolgen können, mechanisch ist, nur in der Art mechanisch, als eine Verrichtung der Intellectualität es seyn kann; und hernach diejenige Abweichung von diesem Gange, und diejenige Abkürzung desselben, welche die Individualität der Nation bewirkt, die, wenn sie zur Vortreflichkeit führt, genialisch ist, und nicht mehr logisch vorausgesehen, oder schrittweise nachgewiesen werden kann. Indem ich daher wirklich von etwas Allgemeinem in der Grammatik aller Sprachen ausgehe, was wirklich a lege naturae pendet, bin ich gegen mehrere grammatische Aehnlichkeiten, die vorzüglich von den oben nr. 1. und 2. benannten Punkten abhängen, in Absicht des Urtheils über die Abstammung mistrauisch. Indem ich aber im höchsten Grade anerkenne, daß jene Naturgesetze in den individuellen Geistesanlagen der Nationen die mannigfaltigsten Bestimmungen finden können, so bin ich weit entfernt zu behaupten, daß aus den Amerikanischen Sprachen im Verlaufe der Zeit Sanskrit werden müsse, oder daß dieses ehedem müsse einen solchen Ursprung gehabt haben. Sollte ich daher die Frage, ob bei Bestimmung der Verwandtschaft der Sprachen mehr auf die Grammatik, oder den Wortvorrath zu geben sey? beantworten, so würde ich sagen, daß auf der einen Seite das Urtheil aus der Grammatik sicherer sey, weil sie inniger mit der Individualität der Nation verbun[6]den ist, und nicht leicht von einer Nation zur andern überwandert, auf der andern aber unsichrer, weil der grammatische Bau mehr von allgemeinen Bedingungen des menschlichen Denkens abhängig, und das Feld möglicher Verschiedenheit minder groß ist. Jedes Urtheil, das nicht auf diese doppelte Beschaffenheit der Grammatik sorgfältige Rücksicht nimmt, scheint mir allemal bedenklich. Daß alle Sprachen in Absicht der Grammatik sich sehr ähnlich sehen, wenn man sie nicht oberflächlich, sondern tief in ihrem Innern untersucht, ist unläugbar. So ist im Mexikanischen das Augment des perfectum o (also ähnlich dem α und dem ε), so ist in mehreren Amerikanischen Sprachen die Silbenwiederholung, so giebt es viele Fälle, wo in ihnen das praesens vermöge einer Partikel zur vergangenen Zeit wird, wie im Sanskrit durch sma, oder der Indicativ zum Conjunctiv, wie im Griechischen durch ἂν und κε, u. s. f. Die Zeit halte ich übrigens nicht für gleichgültig, und mehrere grammatische Verschiedenheiten halte ich wirklich mehr für Folgen der Zeit, als der Nationalität. Ich beziehe dies vorzüglich auf die Sprachentwicklung, vermöge welcher aus wirklichen Phrasen wahre Formen werden. Es scheint mir auch ganz natürlich, daß der menschliche Geist, solange bis durch irgend einen Funken ein individueller intellektueller Trieb in ihm entsteht, einen instinctmäßigen Gang verfolgt, der natürlich bei allen Nationen sich sehr ähnlich seyn muß. Richtet sich der individuell intellektuelle Trieb auf die Sprache mit Macht und zur Zeit, wo sie noch biegsam ist, so entsteht nun eine eigenthümliche grammatische Form, und die Sprache erleidet nicht mehr große Veränderungen. Erwacht er zu spät, wenn die instinctmäßige Form schon zu unbiegsam geworden ist, so dringt er nicht mehr durch sie durch. Dieser ganze Punkt ist in der Sprachuntersuchung so wichtig, daß Sie mir darum verzeihen müssen, wenn ich in dem Wunsche, [7] einmal gelegentlich Ihre Meynung darüber zu vernehmen, weitläuftiger darüber war.
Sehr gefreut hat es mich übrigens, daß Sie S. 276. die flüchtige Anhäufung von Nachrichten über viele Sprachen auf ihren wahren Unwerth zurückgeführt haben. Wenn man die Arbeit über eine Sprache wie ein experimentum in anima vili ansieht, so lernt man geradezu nichts daraus. Verfolgt man aber mit philologischer Genauigkeit jede, so habe ich noch immer auch die scheinbar barbarischste lehrreich gefunden.
Die Abhandlung über Wilson, den ich seit einem Jahr täglich in Händen habe, hat mich aufs höchste interessirt.
Möchten Sie nicht (S. 321.) zu den Wörtern, die Wilson irrig mit einem b schreibt, auch wahu rechnen? Die Wurzel wah ist doch unser wachsen, und das Lateinische vastus spricht auch dafür. Ueberhaupt gestehe ich, daß das Lob, welches Sie Wilson hierin beilegen, mir Wilkins mehr zu verdienen scheint. So hat es mir wenigstens bei Vergleichung seiner radicals und seines Hitopadesa mit Wilsons Lexicon geschienen.
Ew. Hochwohlgebohrnen sprechen S. 332. dem Sanskrit die selbständigen Praepositionen ab, und sagen, daß es derselben nicht bedarf, weil die Declination zureiche. Sicher ist es, daß die Sprache sich meistentheils der Casus bedient und wenig der Indeclinabilien, die man Praepositionen nennen könnte. Ob dies aber zu ihren Vorzügen gehört, möchte ich bezweifeln. Denn die Casus, namentlich Locativus und Instrumentalis, werden bisweilen in wunderbarer Art gebraucht, und die doch mir der Deutlichkeit Schaden zu thun scheint. Was aber den ersten Punkt betrift, so habe ich schon öfter darüber nachgedacht, und wünschte wohl genauer darüber von Ihnen belehrt zu werden. Mir hat es immer geschienen, daß zwar dieser Theil der Sanskrit Grammatik nicht dieselbe Ausbildung erhalten hat, als andre, aber daß doch in der Sprache Wörter vorhanden [8] sind, aus denen in andern Sprachen wahre Praepositionen geworden sind, und daß in einigen Fällen dieser wahre Uebergang in Praepositionen auch im Sanskrit sichtbar ist. Es kommt freilich hier ganz auf den Begriff und die Ansicht an, die man von diesem Redetheil im Allgemeinen hat. Bei der hier vorliegenden Frage kommt es, dünkt mich, nur darauf an, ob die Sprache gewisse Wörter hat, die man nicht füglich anders, denn wie Praepositionen erklären kann, d. h. wie Wörter, die (wenn sie auch an sich declinabel wären) dennoch als indeclinabilia gebraucht werden, die bloß bestimmt sind, ein Verhältniß zu bezeichnen, und dadurch ein von ihnen regiertes Wort in eine bestimmte Abhängigkeit von sich stellen. Nach dem Wenigen, was ich bisher im Sanskrit gelesen, finde ich einen dreifachen Fall, wo man an Praepositionen denken kann. 1. wo ein Indeclinabile zwar als Praeposition übersetzt werden kann, aber ebenso gut auch ein zum Verbum gehörendes Adverbium seyn kann. Dies ist der Fall mit dem häufigen saha, auch mit sârddham Ramayana l. 1. S. 1. sl. 31. wo man dies Wort als zum Verbum gehörig durch zugleich übersetzen, und den Begriff von mit in dem Instrumentalis suchen kann. So ist wohl auch prabhṛiti Hitopadesa editio Londinensis p. 34. l. 24. wo der unmittelbar vorhergehende Ablativ den Begriff von dem Augenblick an ausdrücken, und das Indeclinabile (was wenigstens hier im absoluten Zustande so steht) als Adverbium fernerhin übersetzen kann. 2. wo ein declinirtes Substantivum, oder absolut genommenes Adjectivum oder Participium das ausdrückt, wozu andre Sprachen Praepositionen gebrauchen. Auch da aber sind die Fälle verschieden, und nähern sich mehr, oder weniger den Praepositionen. Ganz substantivisch ist z. B. Ramayana l. 1. S. 1. sl. 101 bharatasyantikam in die Nähe des Bharata zu ihm. Denn das Substantivum, das man auch als Praeposition ansehen könnte, regiert den Genitiv und seine Bedeutung braucht gar nicht verändert zu werden. Allein viel anders ist Nalus IV. 3. twatkṛitê, man kann freilich auch hier Alles ohne Praeposition erklären, und sagen: in dem von Dir Geschehenen, aber man muß, um zu einem deutlichen Sinn zu [9] gelangen, das doch wieder übersetzen. Dabei fällt mir eine andre Frage ein. Wird das kṛitê immer mit dem Ablativ oder auch mit dem Genitiv construirt und muß man Hitopadesa p. 34, l. 19. tasyâḥ kṛitê für einen Ablativ oder Genitiv nehmen, da die Endung beides seyn kann? Noch praepositionsartiger, wenn ich so sagen darf, ist Nalus IV. 26. ṛitê tâm. Hier ist allerdings auch ein Locativus eines Participiums, es ließe sich auch allenfalls der Accusativ erklären, wenn man sagte, daß dies Participium, so wie die sogenannten participia indeclinabilia und der Infinitiv, denselben Casus als das Verbum regierten. Allein Alles das ist sehr gezwungen, da hingegen die Bedeutung von außer viel natürlicher ist. 3. endlich aber giebt es Fälle, die ich nun schlechterdings nicht anders zu erklären weiß, und wo sonst sich in Zusammensetzung befindende Praepositionen allein stehen. Bei meiner armseligen Lecture ist mir aber freilich davon nur prati vorgekommen. Zwei Stellen im Ramayana scheinen mir keine andre Erklärung zuzulassen. l. 1. S. 1. sl. 72. Da badaḥ ein masculinum ist, so muß das Wort hier im Accusativ stehen; dieser Accusativ kann das Verbum (hier nur das Participium mit ausgelassnem Verbum Seyn) nicht regieren. Er kann also nur von prati regiert seyn und man muß übersetzen: es wurde versprochen, gelobt, sich entschlossen von R. zur Erweckung des V. Wäre indess auch diese Constructionsschwierigkeit nicht, so wüßte ich hier der Partikel keine schickliche Adverbialbedeutung zu geben. Die zweite Stelle macht mich noch mehr irre. S. 3. sl. 39. Soll hier prati auf den Accusativ gehen? Ich kann es nicht anders nehmen, und der Grund liegt wohl darin, daß, wenn auch das Verbum gehen den Accusativ regiert, doch das Substantivum dies nicht gleich natürlich thun kann. Die Englische Uebersetzung hat in diesem Satz eine Negation. In dem Text scheint mir aber nur zu liegen, der Selbstvorsatz, die Entschließung R. über das Gehen (Locativ) nach K. Endlich die Stelle im Nalus I. 17. Hier würde ich allerdings die Partikel lieber durch gegenseitig (als Adverbium) übersetzen. Das erste Wort des Verses ist von der Art, daß es in sich vollständig ist: einer den andren i. e. wechselseitig. In Bopps Uebersetzung muß man alterius auf desiderium be[10]ziehen. Im Text ist aber, nach Ihrer gewiß sehr richtigen Bemerkung (S. 353.), der erste Theil des Worts ein Nominativ. Das ô kann nur von dem Visarga vor dem elidirten Vocal des folgenden Worts herkommen. Der letzte Accusativ wird also vom ersten Nominativ regiert, und das Ganze bildet meines Erachtens eine Art Adverbium.1) In den beiden Beispielen aus dem Ramayana ist noch merkwürdig, daß die frei stehende Partikel dieselbe ist, als die mit dem Verbum zusammengesetzte, was sich auch im Griechischen häufig findet. – Nehme ich nun Alles zusammen, das frei stehende prati, was in einer Stelle (wenn ich sie recht fasse) einen Casus regiert, den das Verbum nicht regieren kann, ferner daß bei kṛitê, ṛitê der Sinn viel natürlicher und leichter wird, wenn man sie wie Praepositionen auffaßt, endlich daß wohl die meisten Praepositionen, wenn nicht alle, aus declinirten Substantiven, die dann indeclinable Partikeln geworden sind, entstanden sind, so möchte ich doch nicht die frei stehenden Praepositionen im Sanskrit ganz wegwerfen, sondern sagen, daß es deren wirklich giebt, aber nicht so ausgebildet, wie im Griechischen und Lateinischen, daß aber die Sprache auf dem Wege war, und die Elemente enthielt, aus denen auch diese Gattung der Redetheile vollkommen hervorwachsen konnte.
S. 340. sprechen Sie ja ein ordentliches Abschreckungsanathem über unberufene Sanskritschüler aus. Indeß ist es, glaube ich, wirklich so, daß gewisse Schwierigkeiten, auch bei aller Ausbildung der Hülfsmittel, immer dieser Sprache eigenthümlich bleiben werden. Wenigstens fühle ich an mir, daß man, auch bei eifrigem Studium, lange ein sehr armseliger Schüler bleibt.
Der Irrthum mit nir und ni ist um so auffallender in Wilson, als Wilkins geradezu und deutlich, gerade wie Ew. Hochwohlgebornen, beide Partikeln, als Gegensätze angiebt.
Sie tadeln gewiß mit Recht die Schreibung Sunscrit S. 367. Sollte man aber nicht immer, wie auch Wilkins thut, Sanskrita Sprache sagen? Die Abkürzung ist nicht einmal dem Ohre ge[11]fällig. Ich gestehe, daß ich, ohne Ihre und Bopps Autoritaet, es unfehlbar thun würde.
Ein neues allgemeines Wörterbuch wird freilich nicht so bald zu Stande kommen, und ist, nach Wilson, auch, wie es mir scheint, kein so dringendes Bedürfniß. Allein ein nicht so weitschichtiges, und äußerst nützliches Unternehmen wäre ein Wörterbuch, oder wenn man will Vocabularium, das nur die gelesensten Hauptwerke umfaßte, aber da in die verschiednen Bedeutungen, vorzüglich der Verba eingienge und die Hauptstellen citirte. Umfaßte ein solches Wörterbuch den Hitopadesa, Ramayana, Mahabharat und Manuʼs Gesetze, so wäre im Grunde das Bedürfniß erfüllt. Denn wo dies Wörterbuch für andre Schriften nicht ausreichte, gienge man auf Wilson zurück, und hülfe sich selbst.
Mit großer Freude habe ich aus S. 367. gesehen, daß Sie eine eigne Grammatik hoffen lassen. Bleiben Sie ja bei diesem Gedanken. Wenige Dinge werden dem Studium so förderlich seyn.
Und nun bitte ich Ew. Hochwohlgebohrnen herzlich wegen der Länge dieses Schreibens um Verzeihung und empfehle mich Ihrem gütigen Andenken. Mit der hochachtungsvollsten Ergebenheit
der Ihrige,
Humboldt.
[12]
[10] 1) Ein sehr deutliches Beispiel des allein stehenden prati ist Nalus X. 11. Man könnte hier freilich sagen, die Praeposition sey vom Verbum getrennt, wie bisweilen im Griechischen. Aber dann wird es mehr ein Wortstreit.