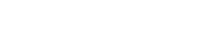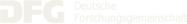Notice (8): Undefined offset: 0 [APP/View/Letters/view.ctp, line 329]
Code Context
/version-01-20/letters/view/3168" data-language=""></ul></div><div id="zoomImage" style="height:695px" class="open-sea-dragon" data-src="<?php echo $this->Html->url($dzi_imagesHand[0]) ?>" data-language="<?=$this->Session->read('Config.language')?>"></div>
$viewFile = '/var/www/awschlegel/version-01-20/app/View/Letters/view.ctp' $dataForView = array( 'html' => 'Bonn den 23sten Junius 1829.<br>Ew. Excellenz bitte ich um Erlaubniß, auf Ihr gestern empfangenes gehaltreiches Schreiben vorläufig nur einiges erwiedern zu dürfen. Ich habe eben eine sehr dringende Arbeit vor, worüber die Beantwortung, wenn sie ausführlich seyn sollte, gar zu lange verschoben bleiben könnte.<br>Ich werde gewiß nicht unterlassen, die Gründe für die neue Schreibung von neuem sorgfältig zu erwägen. Wäre ich aber noch so sehr von deren Statthaftigkeit und Zweckmäßigkeit überzeugt, so stände es nicht mehr in meiner Gewalt, sie in Ausübung zu bringen. Mein Hitôpadêsa ist gedruckt; vom Râmâyana ist der erste Band gedruckt, und wenn ich nun in dem zweiten die Methode plötzlich wechselte, so könnten die Leser mit Recht klagen, während das Töpferrad herumläuft, sey aus der <span class="slant-italic ">amphora</span> ein <span class="slant-italic ">urceus</span> geworden. Ferner möchte ich auch dem Râmâyana gern Eingang verschaffen. Es ist vorauszusehen, daß die Gelehrten in London, Paris und Calcutta sich gegen die Neuerung erklären werden. Ich bedarf aber einiges Absatzes, nicht um Gewinn zu haben, sondern nur um einen Theil der Kosten zu decken. Wenn dieß nicht erfolgt, so könnten leicht meine geringen Mittel erschöpft seyn, ehe ich das Werk zu Ende gebracht hätte. Die Subscription ist noch sehr kümmerlich, und jeder Band des Râmâyana kostet mir wenigstens 1000 Thaler. Alles zusammengenommen, Anschaffung kostbarer Bücher und Kunstsachen, Reisen, Unterstützung und Entschädigung meines Mitarbeiters, habe ich, mäßig angeschlagen, auf die Sanskrit-Studien schon über 5000 Thaler verwendet.<br>Da die festere Gränzbestimmung der Worttrennung Ew. Excellenz Beifall nicht gewonnen hat, so thut es mir nun wirklich leid, daß ich nicht alles ohne Zwischenräume gedruckt habe. Bei dem schließenden <span class="slant-italic ">n</span> habe ich Herrn Lassens Meynung nachgegeben. Solche unmerkliche Schritte ließen sich wohl wieder zurück thun.<br>Darüber, daß wir die Sylbentheilung nicht beobachten, können wir uns, glaube ich, beruhigen. In den alten Inschriften ist sie stark bezeichnet, in den Devanagari Manuscripten meistens weit weniger, und in den Bengalischen fließt alles in einander.<br>Ew. Excellenz glauben bei mir eine feindselige Gesinnung gegen Herrn Bopp wahrzunehmen. Folgendes sind die Thatsachen.<br>Ich habe ihn in sehr früher Zeit dem jetzt regierenden Könige von Baiern zur Unterstützung in England angelegentlich empfohlen, und mit Ihrem Herrn Bruder gemeinschaftlich etwas für ihn ausgewirkt; ich habe ihn in den Heidelberger Jahrbüchern dem Deutschen Publicum angekündigt, da noch niemand von ihm wußte; ich habe seinen Nalus mit Wärme aufgenommen, mit Nachdruck gelobt, und die Mängel nur leise berührt; ich habe seine Geschmacklosigkeit, seine holperichten Deutschen Verse, seine schülerhafte Latinität mit dem Mantel der Liebe bedeckt; ich habe ihm die Emendationen zum Nalus mitgetheilt, und ihm sogar die Handschrift anvertraut; ich habe ihn in der Vorrede zum Râmâyana ehrenvoll erwähnt, und ihm das Werk selbst zeitig, ehe es in den Buchhandel kam, zugeschickt. Ich habe also vom Anfange an bis auf den heutigen Tag das zuvorkommendste Betragen gegen ihn beobachtet.<br>Dafür habe ich nun sehr schlechten Dank erlebt. Schon vor einer Anzahl Jahren hat er mir einen übeln Streich gespielt, den ich ihm, wie aus obigem genugsam erhellet, nicht nachgetragen.<br>Eine vertrauliche Mittheilung von Einwürfen, wenn sie auch ganz ungegründet wären, ist immer ein freundschaftliches Verfahren. Denn wäre die Absicht feindlich, so würde man mit dem Angriffe gleich öffentlich hervortreten, damit er den Gegner unvorbereitet träfe.<br>Herr Bopp ist aber über die Nachweisung einiger Versehen in eine solche Entrüstung gerathen, er hat mir einen so ungehörigen Brief geschrieben, daß mir nichts übrig blieb, als die Fortsetzung des Briefwechsels höflich abzulehnen.<br>Jetzt da ich den vom Ministerium bewilligten Guß der kleinen Devanagari-Lettern verlange, bezeigt er sich äußerst ungefällig und legt mir Zögerungen und Hindernisse in den Weg.<br>Mein zweites Distichon besagt nichts weiter, als daß Herr Bopp einen ungültigen Sprachgebrauch zuweilen durch falsche Lesearten zu erweisen sucht. Davon liegen die Beispiele vor mir. Z. B. Arjuna p <span class="slant-italic ">p</span>. 77. Übrigens sind wohl keine Epigramme unschuldiger als die in einer fremden Sprache, welche kaum ein Dutzend Menschen in Deutschland verstehen; vollends wenn sie nur vertraulich mitgetheilt werden.<br>Herr Bopp hat allerdings grammatischen Sinn: wenn er nur die Indischen Grammatiker fleißiger studirt hätte, wenn er nicht immer Originalität anbringen wollte, wo sie nicht hingehört, so hätte er etwas recht gutes leisten mögen. Kritischer Sinn für die Unterscheidung des Ächten und Unächten oder Verfälschten mangelt ihm gänzlich. Deswegen macht er auch keinen Unterschied zwischen beglaubigten und unbeglaubigten Texten. In der Auslegungskunst ist er schwach. Z. B. in der Anmerkung über <span class="slant-italic ">ētāwat</span> (Arjun. <span class="slant-italic ">p</span>. 109, 110.) thut er fast unglaubliche Fehlgriffe. Er will mit Unrecht Wilkins zurechtweisen, und entstellt ganz was dieser gesagt hatte. – Es wäre leicht, die Beispiele zu häufen.<br>Wenn mir wegen freimüthiger öffentlicher Äußerungen über das, was mir, in einem wissenschaftlichen Gebiet, irrig und verkehrt scheint, Eifersucht angeschuldigt wird, so muß ich es mir gefallen lassen. Mir ist schon manchmal schlimmeres begegnet. In diesem Falle wäre aber doch die Hypothese sehr unwahrscheinlich, theils wegen des oben angeführten, theils weil ich zur Ausführung meiner bösen Absichten fünf Jahre versäumt hätte. Ich hatte in der That wichtigeres zu thun.<br>Ich hoffe, Ew. Excellenz werden den unerfreulichen Inhalt dieses Briefes meinem lebhaften Wunsche, mich vor Ihnen zu rechtfertigen, zu gute halten. Es wäre freilich angenehmer, einem so überschauenden und tief eindringenden Geiste gegenüber sich mit würdigeren Gegenständen der Betrachtung zu beschäftigen.<br>Vielerlei Störungen lassen mich in meinen Arbeiten nicht so vorwärts kommen, wie ich wohl wünschte. Im Sommer strömen mir die Reisenden von allen Weltgegenden zu, und es wäre doch unfreundlich, sie an der Thür abzuweisen. Seit vier Jahren führe ich den Vorsitz in einem Verein für die Vergrößerung und Verschönerung der Stadt. Nun bin ich auch Mitglied des Municipal-Rathes geworden. Ich wollte es nicht ablehnen, in der Hoffnung, zuweilen etwas auch für die Universität ersprießliches zu fördern.<br>In den öffentlichen Blättern habe ich mich bisher vergeblich nach guten Nachrichten von Ihrem Herrn Bruder umgesehen. Ich schließe mit den herzlichsten Wünschen für die Fortdauer Ihrer Gesundheit, und bitte Ew. Excellenz den Ausdruck meiner unveränderlichen Gesinnungen zu genehmigen.<br>Gehorsamst<br>AWvSchlegel.<br>Die Zeilen am Schlusse Ihres Briefes las ich mit inniger Rührung. Jedoch dünkt mich, bei dem Verluste des theuersten Gegenstandes liegt etwas tröstliches und linderndes in der Erinnerung der vollkommenen Harmonie, worin man gelebt hat. Wenn aber auf innige Gemeinschaft eine Trennung der Geister und Gemüther folgt, eine Spaltung, welche bis zum empörtesten Unwillen steigt, über die öffentliche Rolle, die der Andere spielt, über die Grundsätze, die er lehrt, über seine verwerflichen wiewohl ohnmächtigen Bestrebungen, Aberglauben und Geistesknechtschaft zu fördern; wenn in dieser Lage dann die letzte Trennung durch den Tod erfolgt: dann ist die Trauer zugleich unendlich schmerzlich und peinlich. Dieß war mein Fall mit meinem Bruder Friedrich. Verloren hatte ich ihn längst, und diese Wunde hat seit Jahren geblutet. So hat jeder seine eignen Leiden.', 'isaprint' => true, 'isnewtranslation' => false, 'statemsg' => 'betamsg15', 'cittitle' => '', 'description' => 'August Wilhelm von Schlegel an Wilhelm von Humboldt am 23.06.1829, Bonn', 'adressatort' => 'Unknown', 'absendeort' => 'Bonn <a class="gndmetadata" target="_blank" href="http://d-nb.info/gnd/1001909-1">GND</a>', 'date' => '23.06.1829', 'adressat' => array( (int) 2949 => array( 'ID' => '2949', 'project' => '1', 'timecreate' => '2013-10-17 13:02:22', 'timelastchg' => '2018-01-11 15:52:48', 'key' => 'AWS-ap-00av', 'docTyp' => array( [maximum depth reached] ), '39_name' => 'Humboldt, Wilhelm von', '39_geschlecht' => 'm', '39_gebdatum' => '1767-06-22', '39_toddatum' => '1835-04-08', '39_pdb' => 'GND', '39_dbid' => '118554727', '39_quellen' => 'NDB@https://www.deutsche-biographie.de/gnd118554727.html#ndbcontent@ ADB@https://www.deutsche-biographie.de/gnd118554727.html#adbcontent@ WBIS@http://db.saur.de/WBIS/basicSearch.jsf@J023-835-2@ Wikipedia@https://de.wikipedia.org/wiki/Wilhelm_von_Humboldt@', '39_geburtsort' => array( [maximum depth reached] ), '39_sterbeort' => array( [maximum depth reached] ), '39_lebenwirken' => 'Politiker, Sprachforscher, Publizist, Philosoph Wilhelm von Humboldt wuchs auf Schloss Tegel auf, dem Familienbesitz der Humboldts. Ab 1787 studierte Wilhelm zusammen mit seinem Bruder Alexander an der Universität in Frankfurt (Oder) Rechtswissenschaften. Ein Jahr später wechselte er an die Universität Göttingen, wo er den gleichfalls dort studierenden AWS kennenlernte. 1789 führte ihn eine Reise in das revolutionäre Paris. Anfang 1790 trat er nach Beendigung des Studiums in den Staatsdienst und erhielt eine Anstellung im Justizdepartement. 1791 heiratete er Caroline von Dacheröden, die Tochter eines preußischen Kammergerichtsrates. Im selben Jahr schied er aus dem Staatsdienst aus, um auf den Gütern der Familie von Dacheröden seine Studien der altgriechischen Sprache, Kultur, Kunst und Philosophie fortzusetzen. 1794 zog er nach Jena. Humboldt fungierte als konstruktiver Kritiker und gelehrter Ratgeber für die Protagonisten der Weimarer Klassik. Ab November 1797 lebte er in Paris, um seine Studien fortzuführen. Ausgiebige Reisen nach Spanien dienten auch der Erforschung der baskischen Kultur und Sprache. Von 1802 bis 1808 agierte Humboldt als preußischer Gesandter beim Heiligen Stuhl in Rom. Mit der Aufgabe der konsularischen Vertretung war Humboldt zeitlich nicht überfordert, so dass er genug Gelegenheit hatte, seine Studien weiter zu betreiben und sein Domizil zu einem gesellschaftlichen Mittelpunkt zu machen. 1809 wurde er Sektionschef für Kultus und Unterricht im Ministerium des Innern in Berlin. Humboldt galt als liberaler Bildungsreformer. Zu seinen Leistungen gehören ein neu gegliedertes Bildungssystem, das allen Schichten die Möglichkeit des Zugangs zu Bildung zusichern sollte, und die Vereinheitlichung der Abschlussprüfungen. Als weiterer Meilenstein kann Humboldts Beteiligung bei der Gründung der Universität Berlin gelten; zahlreiche renommierte Wissenschaftler konnten für die Lehrstühle gewonnen werden. Die Eröffnung der Universität im Oktober 1810 fand allerdings ohne Humboldt statt. Nach Auseinandersetzungen verließ er den Bildungssektor und ging als preußischer Gesandter nach Wien, später nach London. In dieser Funktion war er am Wiener Kongress beteiligt. 1819 schied er aus dem Staatsdienst aus und beschäftigte sich weiter mit sprachwissenschaftlichen Forschungen, darunter auch dem Sanskrit und dem Kâwi, der Sprache der indonesischen Insel Java. Wilhelms Bruder Alexander von Humboldt war ein bedeutender Naturforscher, die Brüder Humboldt gelten als die „preußischen Dioskuren“.', '39_namevar' => 'Humboldt, Friedrich Wilhelm Christian Karl Ferdinand von Humboldt, Carl W. von Humboldt, Wilhelm F. von Humboldt, Guillaume de Humboldt, Karl W. von Humboldt, Carl Wilhelm von Humboldt, G. de', '39_beziehung' => 'AWS kannte Wilhelm von Humboldt schon aus Göttinger Studentenzeiten, in Jena begegneten sie sich wieder. Schlegel war 1805 Gast Humboldts in Rom, zur Zeit von dessen preußischer Gesandtschaft. Humboldt und AWS korrespondierten auch über ihre sprachwissenschaftlichen Studien, von großer Kenntnis Humboldts zeugen die ausführlichen brieflichen Diskussionen über das Sanskrit. Humboldt steuerte Aufsätze zu Schlegels „Indischer Bibliothek“ bei. Beide Gelehrte begegneten sich mit großem Respekt, auch wenn sie nicht in allen fachlichen Überzeugungen übereinstimmten.', '39_status_person' => 'Vollständig', '39_sourcename0' => 'AWS-ap-00av-0.jpg', 'folders' => array( [maximum depth reached] ), '_label' => '', '_descr' => '', '_model' => 'Person', '_model_title' => 'Person', '_model_titles' => 'People', '_url' => '' ) ), 'adrCitation' => 'Wilhelm von Humboldt', 'absender' => array(), 'absCitation' => 'August Wilhelm von Schlegel', 'percount' => (int) 1, 'notabs' => false, 'tabs' => array( 'text' => array( 'content' => 'Volltext Druck', 'exists' => '1' ), 'druck' => array( 'exists' => '1', 'content' => 'Digitalisat Druck' ) ), 'parallelview' => array( (int) 0 => '1', (int) 1 => '1' ), 'dzi_imagesHand' => array(), 'dzi_imagesDruck' => array( (int) 0 => '/cake_fud/files/temp/images/dzi/AWS-aw-0234-0.jpg.xml', (int) 1 => '/cake_fud/files/temp/images/dzi/AWS-aw-0234-1.jpg.xml', (int) 2 => '/cake_fud/files/temp/images/dzi/AWS-aw-0234-2.jpg.xml', (int) 3 => '/cake_fud/files/temp/images/dzi/AWS-aw-0234-3.jpg.xml', (int) 4 => '/cake_fud/files/temp/images/dzi/AWS-aw-0234-4.jpg.xml' ), 'indexesintext' => array(), 'right' => 'druck', 'left' => 'text', 'handschrift' => array(), 'druck' => array( 'Bibliographische Angabe' => 'Briefwechsel zwischen Wilhelm von Humboldt und August Wilhelm Schlegel. Hg. v. Albert Leitzmann. Halle 1908, S. 242‒246.', 'Incipit' => '„Bonn den 23sten Junius 1829.<br>Ew. Excellenz bitte ich um Erlaubniß, auf Ihr gestern empfangenes gehaltreiches Schreiben vorläufig nur einiges erwiedern zu [...]“' ), 'docmain' => array( 'ID' => '3168', 'project' => '1', 'timecreate' => '2013-11-12 09:27:37', 'timelastchg' => '2019-10-11 12:48:38', 'key' => 'AWS-aw-0234', 'docTyp' => array( 'name' => 'Brief', 'id' => '36' ), '36_html' => 'Bonn den 23sten Junius 1829.<br>Ew. Excellenz bitte ich um Erlaubniß, auf Ihr gestern empfangenes gehaltreiches Schreiben vorläufig nur einiges erwiedern zu dürfen. Ich habe eben eine sehr dringende Arbeit vor, worüber die Beantwortung, wenn sie ausführlich seyn sollte, gar zu lange verschoben bleiben könnte.<br>Ich werde gewiß nicht unterlassen, die Gründe für die neue Schreibung von neuem sorgfältig zu erwägen. Wäre ich aber noch so sehr von deren Statthaftigkeit und Zweckmäßigkeit überzeugt, so stände es nicht mehr in meiner Gewalt, sie in Ausübung zu bringen. Mein Hitôpadêsa ist gedruckt; vom Râmâyana ist der erste Band gedruckt, und wenn ich nun in dem zweiten die Methode plötzlich wechselte, so könnten die Leser mit Recht klagen, während das Töpferrad herumläuft, sey aus der <span class="slant-italic ">amphora</span> ein <span class="slant-italic ">urceus</span> geworden. Ferner möchte ich auch dem Râmâyana gern Eingang verschaffen. Es ist vorauszusehen, daß die Gelehrten in London, Paris und Calcutta sich gegen die Neuerung erklären werden. Ich bedarf aber einiges Absatzes, nicht um Gewinn zu haben, sondern nur um einen Theil der Kosten zu decken. Wenn dieß nicht erfolgt, so könnten leicht meine geringen Mittel erschöpft seyn, ehe ich das Werk zu Ende gebracht hätte. Die Subscription ist noch sehr kümmerlich, und jeder Band des Râmâyana kostet mir wenigstens 1000 Thaler. Alles zusammengenommen, Anschaffung kostbarer Bücher und Kunstsachen, Reisen, Unterstützung und Entschädigung meines Mitarbeiters, habe ich, mäßig angeschlagen, auf die Sanskrit-Studien schon über 5000 Thaler verwendet.<br>Da die festere Gränzbestimmung der Worttrennung Ew. Excellenz Beifall nicht gewonnen hat, so thut es mir nun wirklich leid, daß ich nicht alles ohne Zwischenräume gedruckt habe. Bei dem schließenden <span class="slant-italic ">n</span> habe ich Herrn Lassens Meynung nachgegeben. Solche unmerkliche Schritte ließen sich wohl wieder zurück thun.<br>Darüber, daß wir die Sylbentheilung nicht beobachten, können wir uns, glaube ich, beruhigen. In den alten Inschriften ist sie stark bezeichnet, in den Devanagari Manuscripten meistens weit weniger, und in den Bengalischen fließt alles in einander.<br>Ew. Excellenz glauben bei mir eine feindselige Gesinnung gegen Herrn Bopp wahrzunehmen. Folgendes sind die Thatsachen.<br>Ich habe ihn in sehr früher Zeit dem jetzt regierenden Könige von Baiern zur Unterstützung in England angelegentlich empfohlen, und mit Ihrem Herrn Bruder gemeinschaftlich etwas für ihn ausgewirkt; ich habe ihn in den Heidelberger Jahrbüchern dem Deutschen Publicum angekündigt, da noch niemand von ihm wußte; ich habe seinen Nalus mit Wärme aufgenommen, mit Nachdruck gelobt, und die Mängel nur leise berührt; ich habe seine Geschmacklosigkeit, seine holperichten Deutschen Verse, seine schülerhafte Latinität mit dem Mantel der Liebe bedeckt; ich habe ihm die Emendationen zum Nalus mitgetheilt, und ihm sogar die Handschrift anvertraut; ich habe ihn in der Vorrede zum Râmâyana ehrenvoll erwähnt, und ihm das Werk selbst zeitig, ehe es in den Buchhandel kam, zugeschickt. Ich habe also vom Anfange an bis auf den heutigen Tag das zuvorkommendste Betragen gegen ihn beobachtet.<br>Dafür habe ich nun sehr schlechten Dank erlebt. Schon vor einer Anzahl Jahren hat er mir einen übeln Streich gespielt, den ich ihm, wie aus obigem genugsam erhellet, nicht nachgetragen.<br>Eine vertrauliche Mittheilung von Einwürfen, wenn sie auch ganz ungegründet wären, ist immer ein freundschaftliches Verfahren. Denn wäre die Absicht feindlich, so würde man mit dem Angriffe gleich öffentlich hervortreten, damit er den Gegner unvorbereitet träfe.<br>Herr Bopp ist aber über die Nachweisung einiger Versehen in eine solche Entrüstung gerathen, er hat mir einen so ungehörigen Brief geschrieben, daß mir nichts übrig blieb, als die Fortsetzung des Briefwechsels höflich abzulehnen.<br>Jetzt da ich den vom Ministerium bewilligten Guß der kleinen Devanagari-Lettern verlange, bezeigt er sich äußerst ungefällig und legt mir Zögerungen und Hindernisse in den Weg.<br>Mein zweites Distichon besagt nichts weiter, als daß Herr Bopp einen ungültigen Sprachgebrauch zuweilen durch falsche Lesearten zu erweisen sucht. Davon liegen die Beispiele vor mir. Z. B. Arjuna p <span class="slant-italic ">p</span>. 77. Übrigens sind wohl keine Epigramme unschuldiger als die in einer fremden Sprache, welche kaum ein Dutzend Menschen in Deutschland verstehen; vollends wenn sie nur vertraulich mitgetheilt werden.<br>Herr Bopp hat allerdings grammatischen Sinn: wenn er nur die Indischen Grammatiker fleißiger studirt hätte, wenn er nicht immer Originalität anbringen wollte, wo sie nicht hingehört, so hätte er etwas recht gutes leisten mögen. Kritischer Sinn für die Unterscheidung des Ächten und Unächten oder Verfälschten mangelt ihm gänzlich. Deswegen macht er auch keinen Unterschied zwischen beglaubigten und unbeglaubigten Texten. In der Auslegungskunst ist er schwach. Z. B. in der Anmerkung über <span class="slant-italic ">ētāwat</span> (Arjun. <span class="slant-italic ">p</span>. 109, 110.) thut er fast unglaubliche Fehlgriffe. Er will mit Unrecht Wilkins zurechtweisen, und entstellt ganz was dieser gesagt hatte. – Es wäre leicht, die Beispiele zu häufen.<br>Wenn mir wegen freimüthiger öffentlicher Äußerungen über das, was mir, in einem wissenschaftlichen Gebiet, irrig und verkehrt scheint, Eifersucht angeschuldigt wird, so muß ich es mir gefallen lassen. Mir ist schon manchmal schlimmeres begegnet. In diesem Falle wäre aber doch die Hypothese sehr unwahrscheinlich, theils wegen des oben angeführten, theils weil ich zur Ausführung meiner bösen Absichten fünf Jahre versäumt hätte. Ich hatte in der That wichtigeres zu thun.<br>Ich hoffe, Ew. Excellenz werden den unerfreulichen Inhalt dieses Briefes meinem lebhaften Wunsche, mich vor Ihnen zu rechtfertigen, zu gute halten. Es wäre freilich angenehmer, einem so überschauenden und tief eindringenden Geiste gegenüber sich mit würdigeren Gegenständen der Betrachtung zu beschäftigen.<br>Vielerlei Störungen lassen mich in meinen Arbeiten nicht so vorwärts kommen, wie ich wohl wünschte. Im Sommer strömen mir die Reisenden von allen Weltgegenden zu, und es wäre doch unfreundlich, sie an der Thür abzuweisen. Seit vier Jahren führe ich den Vorsitz in einem Verein für die Vergrößerung und Verschönerung der Stadt. Nun bin ich auch Mitglied des Municipal-Rathes geworden. Ich wollte es nicht ablehnen, in der Hoffnung, zuweilen etwas auch für die Universität ersprießliches zu fördern.<br>In den öffentlichen Blättern habe ich mich bisher vergeblich nach guten Nachrichten von Ihrem Herrn Bruder umgesehen. Ich schließe mit den herzlichsten Wünschen für die Fortdauer Ihrer Gesundheit, und bitte Ew. Excellenz den Ausdruck meiner unveränderlichen Gesinnungen zu genehmigen.<br>Gehorsamst<br>AWvSchlegel.<br>Die Zeilen am Schlusse Ihres Briefes las ich mit inniger Rührung. Jedoch dünkt mich, bei dem Verluste des theuersten Gegenstandes liegt etwas tröstliches und linderndes in der Erinnerung der vollkommenen Harmonie, worin man gelebt hat. Wenn aber auf innige Gemeinschaft eine Trennung der Geister und Gemüther folgt, eine Spaltung, welche bis zum empörtesten Unwillen steigt, über die öffentliche Rolle, die der Andere spielt, über die Grundsätze, die er lehrt, über seine verwerflichen wiewohl ohnmächtigen Bestrebungen, Aberglauben und Geistesknechtschaft zu fördern; wenn in dieser Lage dann die letzte Trennung durch den Tod erfolgt: dann ist die Trauer zugleich unendlich schmerzlich und peinlich. Dieß war mein Fall mit meinem Bruder Friedrich. Verloren hatte ich ihn längst, und diese Wunde hat seit Jahren geblutet. So hat jeder seine eignen Leiden.', '36_xml' => '<p>Bonn den 23sten Junius 1829.<lb/>Ew. Excellenz bitte ich um Erlaubniß, auf Ihr gestern empfangenes gehaltreiches Schreiben vorläufig nur einiges erwiedern zu dürfen. Ich habe eben eine sehr dringende Arbeit vor, worüber die Beantwortung, wenn sie ausführlich seyn sollte, gar zu lange verschoben bleiben könnte.<lb/>Ich werde gewiß nicht unterlassen, die Gründe für die neue Schreibung von neuem sorgfältig zu erwägen. Wäre ich aber noch so sehr von deren Statthaftigkeit und Zweckmäßigkeit überzeugt, so stände es nicht mehr in meiner Gewalt, sie in Ausübung zu bringen. Mein Hitôpadêsa ist gedruckt; vom Râmâyana ist der erste Band gedruckt, und wenn ich nun in dem zweiten die Methode plötzlich wechselte, so könnten die Leser mit Recht klagen, während das Töpferrad herumläuft, sey aus der <hi rend="slant:italic">amphora</hi> ein <hi rend="slant:italic">urceus</hi> geworden. Ferner möchte ich auch dem Râmâyana gern Eingang verschaffen. Es ist vorauszusehen, daß die Gelehrten in London, Paris und Calcutta sich gegen die Neuerung erklären werden. Ich bedarf aber einiges Absatzes, nicht um Gewinn zu haben, sondern nur um einen Theil der Kosten zu decken. Wenn dieß nicht erfolgt, so könnten leicht meine geringen Mittel erschöpft seyn, ehe ich das Werk zu Ende gebracht hätte. Die Subscription ist noch sehr kümmerlich, und jeder Band des Râmâyana kostet mir wenigstens 1000 Thaler. Alles zusammengenommen, Anschaffung kostbarer Bücher und Kunstsachen, Reisen, Unterstützung und Entschädigung meines Mitarbeiters, habe ich, mäßig angeschlagen, auf die Sanskrit-Studien schon über 5000 Thaler verwendet.<lb/>Da die festere Gränzbestimmung der Worttrennung Ew. Excellenz Beifall nicht gewonnen hat, so thut es mir nun wirklich leid, daß ich nicht alles ohne Zwischenräume gedruckt habe. Bei dem schließenden <hi rend="slant:italic">n</hi> habe ich Herrn Lassens Meynung nachgegeben. Solche unmerkliche Schritte ließen sich wohl wieder zurück thun.<lb/>Darüber, daß wir die Sylbentheilung nicht beobachten, können wir uns, glaube ich, beruhigen. In den alten Inschriften ist sie stark bezeichnet, in den Devanagari Manuscripten meistens weit weniger, und in den Bengalischen fließt alles in einander.<lb/>Ew. Excellenz glauben bei mir eine feindselige Gesinnung gegen Herrn Bopp wahrzunehmen. Folgendes sind die Thatsachen.<lb/>Ich habe ihn in sehr früher Zeit dem jetzt regierenden Könige von Baiern zur Unterstützung in England angelegentlich empfohlen, und mit Ihrem Herrn Bruder gemeinschaftlich etwas für ihn ausgewirkt; ich habe ihn in den Heidelberger Jahrbüchern dem Deutschen Publicum angekündigt, da noch niemand von ihm wußte; ich habe seinen Nalus mit Wärme aufgenommen, mit Nachdruck gelobt, und die Mängel nur leise berührt; ich habe seine Geschmacklosigkeit, seine holperichten Deutschen Verse, seine schülerhafte Latinität mit dem Mantel der Liebe bedeckt; ich habe ihm die Emendationen zum Nalus mitgetheilt, und ihm sogar die Handschrift anvertraut; ich habe ihn in der Vorrede zum Râmâyana ehrenvoll erwähnt, und ihm das Werk selbst zeitig, ehe es in den Buchhandel kam, zugeschickt. Ich habe also vom Anfange an bis auf den heutigen Tag das zuvorkommendste Betragen gegen ihn beobachtet.<lb/>Dafür habe ich nun sehr schlechten Dank erlebt. Schon vor einer Anzahl Jahren hat er mir einen übeln Streich gespielt, den ich ihm, wie aus obigem genugsam erhellet, nicht nachgetragen.<lb/>Eine vertrauliche Mittheilung von Einwürfen, wenn sie auch ganz ungegründet wären, ist immer ein freundschaftliches Verfahren. Denn wäre die Absicht feindlich, so würde man mit dem Angriffe gleich öffentlich hervortreten, damit er den Gegner unvorbereitet träfe.<lb/>Herr Bopp ist aber über die Nachweisung einiger Versehen in eine solche Entrüstung gerathen, er hat mir einen so ungehörigen Brief geschrieben, daß mir nichts übrig blieb, als die Fortsetzung des Briefwechsels höflich abzulehnen.<lb/>Jetzt da ich den vom Ministerium bewilligten Guß der kleinen Devanagari-Lettern verlange, bezeigt er sich äußerst ungefällig und legt mir Zögerungen und Hindernisse in den Weg.<lb/>Mein zweites Distichon besagt nichts weiter, als daß Herr Bopp einen ungültigen Sprachgebrauch zuweilen durch falsche Lesearten zu erweisen sucht. Davon liegen die Beispiele vor mir. Z. B. Arjuna p <hi rend="slant:italic">p</hi>. 77. Übrigens sind wohl keine Epigramme unschuldiger als die in einer fremden Sprache, welche kaum ein Dutzend Menschen in Deutschland verstehen; vollends wenn sie nur vertraulich mitgetheilt werden.<lb/>Herr Bopp hat allerdings grammatischen Sinn: wenn er nur die Indischen Grammatiker fleißiger studirt hätte, wenn er nicht immer Originalität anbringen wollte, wo sie nicht hingehört, so hätte er etwas recht gutes leisten mögen. Kritischer Sinn für die Unterscheidung des Ächten und Unächten oder Verfälschten mangelt ihm gänzlich. Deswegen macht er auch keinen Unterschied zwischen beglaubigten und unbeglaubigten Texten. In der Auslegungskunst ist er schwach. Z. B. in der Anmerkung über <hi rend="slant:italic">ētāwat</hi> (Arjun. <hi rend="slant:italic">p</hi>. 109, 110.) thut er fast unglaubliche Fehlgriffe. Er will mit Unrecht Wilkins zurechtweisen, und entstellt ganz was dieser gesagt hatte. – Es wäre leicht, die Beispiele zu häufen.<lb/>Wenn mir wegen freimüthiger öffentlicher Äußerungen über das, was mir, in einem wissenschaftlichen Gebiet, irrig und verkehrt scheint, Eifersucht angeschuldigt wird, so muß ich es mir gefallen lassen. Mir ist schon manchmal schlimmeres begegnet. In diesem Falle wäre aber doch die Hypothese sehr unwahrscheinlich, theils wegen des oben angeführten, theils weil ich zur Ausführung meiner bösen Absichten fünf Jahre versäumt hätte. Ich hatte in der That wichtigeres zu thun.<lb/>Ich hoffe, Ew. Excellenz werden den unerfreulichen Inhalt dieses Briefes meinem lebhaften Wunsche, mich vor Ihnen zu rechtfertigen, zu gute halten. Es wäre freilich angenehmer, einem so überschauenden und tief eindringenden Geiste gegenüber sich mit würdigeren Gegenständen der Betrachtung zu beschäftigen.<lb/>Vielerlei Störungen lassen mich in meinen Arbeiten nicht so vorwärts kommen, wie ich wohl wünschte. Im Sommer strömen mir die Reisenden von allen Weltgegenden zu, und es wäre doch unfreundlich, sie an der Thür abzuweisen. Seit vier Jahren führe ich den Vorsitz in einem Verein für die Vergrößerung und Verschönerung der Stadt. Nun bin ich auch Mitglied des Municipal-Rathes geworden. Ich wollte es nicht ablehnen, in der Hoffnung, zuweilen etwas auch für die Universität ersprießliches zu fördern.<lb/>In den öffentlichen Blättern habe ich mich bisher vergeblich nach guten Nachrichten von Ihrem Herrn Bruder umgesehen. Ich schließe mit den herzlichsten Wünschen für die Fortdauer Ihrer Gesundheit, und bitte Ew. Excellenz den Ausdruck meiner unveränderlichen Gesinnungen zu genehmigen.<lb/>Gehorsamst<lb/>AWvSchlegel.<lb/>Die Zeilen am Schlusse Ihres Briefes las ich mit inniger Rührung. Jedoch dünkt mich, bei dem Verluste des theuersten Gegenstandes liegt etwas tröstliches und linderndes in der Erinnerung der vollkommenen Harmonie, worin man gelebt hat. Wenn aber auf innige Gemeinschaft eine Trennung der Geister und Gemüther folgt, eine Spaltung, welche bis zum empörtesten Unwillen steigt, über die öffentliche Rolle, die der Andere spielt, über die Grundsätze, die er lehrt, über seine verwerflichen wiewohl ohnmächtigen Bestrebungen, Aberglauben und Geistesknechtschaft zu fördern; wenn in dieser Lage dann die letzte Trennung durch den Tod erfolgt: dann ist die Trauer zugleich unendlich schmerzlich und peinlich. Dieß war mein Fall mit meinem Bruder Friedrich. Verloren hatte ich ihn längst, und diese Wunde hat seit Jahren geblutet. So hat jeder seine eignen Leiden.</p>', '36_xml_standoff' => 'Bonn den 23sten Junius 1829.<lb/>Ew. Excellenz bitte ich um Erlaubniß, auf Ihr gestern empfangenes gehaltreiches Schreiben vorläufig nur einiges erwiedern zu dürfen. Ich habe eben eine sehr dringende Arbeit vor, worüber die Beantwortung, wenn sie ausführlich seyn sollte, gar zu lange verschoben bleiben könnte.<lb/>Ich werde gewiß nicht unterlassen, die Gründe für die neue Schreibung von neuem sorgfältig zu erwägen. Wäre ich aber noch so sehr von deren Statthaftigkeit und Zweckmäßigkeit überzeugt, so stände es nicht mehr in meiner Gewalt, sie in Ausübung zu bringen. Mein Hitôpadêsa ist gedruckt; vom Râmâyana ist der erste Band gedruckt, und wenn ich nun in dem zweiten die Methode plötzlich wechselte, so könnten die Leser mit Recht klagen, während das Töpferrad herumläuft, sey aus der <hi rend="slant:italic">amphora</hi> ein <hi rend="slant:italic">urceus</hi> geworden. Ferner möchte ich auch dem Râmâyana gern Eingang verschaffen. Es ist vorauszusehen, daß die Gelehrten in London, Paris und Calcutta sich gegen die Neuerung erklären werden. Ich bedarf aber einiges Absatzes, nicht um Gewinn zu haben, sondern nur um einen Theil der Kosten zu decken. Wenn dieß nicht erfolgt, so könnten leicht meine geringen Mittel erschöpft seyn, ehe ich das Werk zu Ende gebracht hätte. Die Subscription ist noch sehr kümmerlich, und jeder Band des Râmâyana kostet mir wenigstens 1000 Thaler. Alles zusammengenommen, Anschaffung kostbarer Bücher und Kunstsachen, Reisen, Unterstützung und Entschädigung meines Mitarbeiters, habe ich, mäßig angeschlagen, auf die Sanskrit-Studien schon über 5000 Thaler verwendet.<lb/>Da die festere Gränzbestimmung der Worttrennung Ew. Excellenz Beifall nicht gewonnen hat, so thut es mir nun wirklich leid, daß ich nicht alles ohne Zwischenräume gedruckt habe. Bei dem schließenden <hi rend="slant:italic">n</hi> habe ich Herrn Lassens Meynung nachgegeben. Solche unmerkliche Schritte ließen sich wohl wieder zurück thun.<lb/>Darüber, daß wir die Sylbentheilung nicht beobachten, können wir uns, glaube ich, beruhigen. In den alten Inschriften ist sie stark bezeichnet, in den Devanagari Manuscripten meistens weit weniger, und in den Bengalischen fließt alles in einander.<lb/>Ew. Excellenz glauben bei mir eine feindselige Gesinnung gegen Herrn Bopp wahrzunehmen. Folgendes sind die Thatsachen.<lb/>Ich habe ihn in sehr früher Zeit dem jetzt regierenden Könige von Baiern zur Unterstützung in England angelegentlich empfohlen, und mit Ihrem Herrn Bruder gemeinschaftlich etwas für ihn ausgewirkt; ich habe ihn in den Heidelberger Jahrbüchern dem Deutschen Publicum angekündigt, da noch niemand von ihm wußte; ich habe seinen Nalus mit Wärme aufgenommen, mit Nachdruck gelobt, und die Mängel nur leise berührt; ich habe seine Geschmacklosigkeit, seine holperichten Deutschen Verse, seine schülerhafte Latinität mit dem Mantel der Liebe bedeckt; ich habe ihm die Emendationen zum Nalus mitgetheilt, und ihm sogar die Handschrift anvertraut; ich habe ihn in der Vorrede zum Râmâyana ehrenvoll erwähnt, und ihm das Werk selbst zeitig, ehe es in den Buchhandel kam, zugeschickt. Ich habe also vom Anfange an bis auf den heutigen Tag das zuvorkommendste Betragen gegen ihn beobachtet.<lb/>Dafür habe ich nun sehr schlechten Dank erlebt. Schon vor einer Anzahl Jahren hat er mir einen übeln Streich gespielt, den ich ihm, wie aus obigem genugsam erhellet, nicht nachgetragen.<lb/>Eine vertrauliche Mittheilung von Einwürfen, wenn sie auch ganz ungegründet wären, ist immer ein freundschaftliches Verfahren. Denn wäre die Absicht feindlich, so würde man mit dem Angriffe gleich öffentlich hervortreten, damit er den Gegner unvorbereitet träfe.<lb/>Herr Bopp ist aber über die Nachweisung einiger Versehen in eine solche Entrüstung gerathen, er hat mir einen so ungehörigen Brief geschrieben, daß mir nichts übrig blieb, als die Fortsetzung des Briefwechsels höflich abzulehnen.<lb/>Jetzt da ich den vom Ministerium bewilligten Guß der kleinen Devanagari-Lettern verlange, bezeigt er sich äußerst ungefällig und legt mir Zögerungen und Hindernisse in den Weg.<lb/>Mein zweites Distichon besagt nichts weiter, als daß Herr Bopp einen ungültigen Sprachgebrauch zuweilen durch falsche Lesearten zu erweisen sucht. Davon liegen die Beispiele vor mir. Z. B. Arjuna p <hi rend="slant:italic">p</hi>. 77. Übrigens sind wohl keine Epigramme unschuldiger als die in einer fremden Sprache, welche kaum ein Dutzend Menschen in Deutschland verstehen; vollends wenn sie nur vertraulich mitgetheilt werden.<lb/>Herr Bopp hat allerdings grammatischen Sinn: wenn er nur die Indischen Grammatiker fleißiger studirt hätte, wenn er nicht immer Originalität anbringen wollte, wo sie nicht hingehört, so hätte er etwas recht gutes leisten mögen. Kritischer Sinn für die Unterscheidung des Ächten und Unächten oder Verfälschten mangelt ihm gänzlich. Deswegen macht er auch keinen Unterschied zwischen beglaubigten und unbeglaubigten Texten. In der Auslegungskunst ist er schwach. Z. B. in der Anmerkung über <hi rend="slant:italic">ētāwat</hi> (Arjun. <hi rend="slant:italic">p</hi>. 109, 110.) thut er fast unglaubliche Fehlgriffe. Er will mit Unrecht Wilkins zurechtweisen, und entstellt ganz was dieser gesagt hatte. – Es wäre leicht, die Beispiele zu häufen.<lb/>Wenn mir wegen freimüthiger öffentlicher Äußerungen über das, was mir, in einem wissenschaftlichen Gebiet, irrig und verkehrt scheint, Eifersucht angeschuldigt wird, so muß ich es mir gefallen lassen. Mir ist schon manchmal schlimmeres begegnet. In diesem Falle wäre aber doch die Hypothese sehr unwahrscheinlich, theils wegen des oben angeführten, theils weil ich zur Ausführung meiner bösen Absichten fünf Jahre versäumt hätte. Ich hatte in der That wichtigeres zu thun.<lb/>Ich hoffe, Ew. Excellenz werden den unerfreulichen Inhalt dieses Briefes meinem lebhaften Wunsche, mich vor Ihnen zu rechtfertigen, zu gute halten. Es wäre freilich angenehmer, einem so überschauenden und tief eindringenden Geiste gegenüber sich mit würdigeren Gegenständen der Betrachtung zu beschäftigen.<lb/>Vielerlei Störungen lassen mich in meinen Arbeiten nicht so vorwärts kommen, wie ich wohl wünschte. Im Sommer strömen mir die Reisenden von allen Weltgegenden zu, und es wäre doch unfreundlich, sie an der Thür abzuweisen. Seit vier Jahren führe ich den Vorsitz in einem Verein für die Vergrößerung und Verschönerung der Stadt. Nun bin ich auch Mitglied des Municipal-Rathes geworden. Ich wollte es nicht ablehnen, in der Hoffnung, zuweilen etwas auch für die Universität ersprießliches zu fördern.<lb/>In den öffentlichen Blättern habe ich mich bisher vergeblich nach guten Nachrichten von Ihrem Herrn Bruder umgesehen. Ich schließe mit den herzlichsten Wünschen für die Fortdauer Ihrer Gesundheit, und bitte Ew. Excellenz den Ausdruck meiner unveränderlichen Gesinnungen zu genehmigen.<lb/>Gehorsamst<lb/>AWvSchlegel.<lb/>Die Zeilen am Schlusse Ihres Briefes las ich mit inniger Rührung. Jedoch dünkt mich, bei dem Verluste des theuersten Gegenstandes liegt etwas tröstliches und linderndes in der Erinnerung der vollkommenen Harmonie, worin man gelebt hat. Wenn aber auf innige Gemeinschaft eine Trennung der Geister und Gemüther folgt, eine Spaltung, welche bis zum empörtesten Unwillen steigt, über die öffentliche Rolle, die der Andere spielt, über die Grundsätze, die er lehrt, über seine verwerflichen wiewohl ohnmächtigen Bestrebungen, Aberglauben und Geistesknechtschaft zu fördern; wenn in dieser Lage dann die letzte Trennung durch den Tod erfolgt: dann ist die Trauer zugleich unendlich schmerzlich und peinlich. Dieß war mein Fall mit meinem Bruder Friedrich. Verloren hatte ich ihn längst, und diese Wunde hat seit Jahren geblutet. So hat jeder seine eignen Leiden.', '36_briefid' => 'Leitzmann1908_AWSanWvHumboldt_23061829', '36_absender' => array( (int) 0 => array( [maximum depth reached] ) ), '36_adressat' => array( (int) 0 => array( [maximum depth reached] ) ), '36_datumvon' => '1829-06-23', '36_sprache' => array( (int) 0 => 'Deutsch' ), '36_absenderort' => array( (int) 0 => array( [maximum depth reached] ) ), '36_leitd' => 'Briefwechsel zwischen Wilhelm von Humboldt und August Wilhelm Schlegel. Hg. v. Albert Leitzmann. Halle 1908, S. 242‒246.', '36_status' => 'Einmal kollationierter Druckvolltext ohne Registerauszeichnung', '36_Datum' => '1829-06-23', '36_facet_absender' => array( (int) 0 => 'August Wilhelm von Schlegel' ), '36_facet_absender_reverse' => array( (int) 0 => 'Schlegel, August Wilhelm von' ), '36_facet_adressat' => array( (int) 0 => 'Wilhelm von Humboldt' ), '36_facet_adressat_reverse' => array( (int) 0 => 'Humboldt, Wilhelm von' ), '36_facet_absenderort' => array( (int) 0 => 'Bonn' ), '36_facet_adressatort' => '', '36_facet_status' => 'Einmal kollationierter Druckvolltext ohne Registerauszeichnung', '36_facet_datengeberhand' => '', '36_facet_sprache' => array( (int) 0 => 'Deutsch' ), '36_facet_korrespondenten' => array( (int) 0 => 'Wilhelm von Humboldt' ), '36_Digitalisat_Druck_Server' => array( (int) 0 => 'AWS-aw-0234-0.jpg', (int) 1 => 'AWS-aw-0234-1.jpg', (int) 2 => 'AWS-aw-0234-2.jpg', (int) 3 => 'AWS-aw-0234-3.jpg', (int) 4 => 'AWS-aw-0234-4.jpg' ), '_label' => '', '_descr' => '', '_model' => 'Letter', '_model_title' => 'Letter', '_model_titles' => 'Letters', '_url' => '' ), 'doctype_name' => 'Letters', 'captions' => array( '36_dummy' => '', '36_absender' => 'Absender/Verfasser', '36_absverif1' => 'Verfasser Verifikation', '36_absender2' => 'Verfasser 2', '36_absverif2' => 'Verfasser 2 Verifikation', '36_absbrieftyp2' => 'Verfasser 2 Brieftyp', '36_absender3' => 'Verfasser 3', '36_absverif3' => 'Verfasser 3 Verifikation', '36_absbrieftyp3' => 'Verfasser 3 Brieftyp', '36_adressat' => 'Adressat/Empfänger', '36_adrverif1' => 'Empfänger Verifikation', '36_adressat2' => 'Empfänger 2', '36_adrverif2' => 'Empfänger 2 Verifikation', '36_adressat3' => 'Empfänger 3', '36_adrverif3' => 'Empfänger 3 Verifikation', '36_adressatfalsch' => 'Empfänger_falsch', '36_absenderort' => 'Ort Absender/Verfasser', '36_absortverif1' => 'Ort Verfasser Verifikation', '36_absortungenau' => 'Ort Verfasser ungenau', '36_absenderort2' => 'Ort Verfasser 2', '36_absortverif2' => 'Ort Verfasser 2 Verifikation', '36_absenderort3' => 'Ort Verfasser 3', '36_absortverif3' => 'Ort Verfasser 3 Verifikation', '36_adressatort' => 'Ort Adressat/Empfänger', '36_adrortverif' => 'Ort Empfänger Verifikation', '36_datumvon' => 'Datum von', '36_datumbis' => 'Datum bis', '36_altDat' => 'Datum/Datum manuell', '36_datumverif' => 'Datum Verifikation', '36_sortdatum' => 'Datum zum Sortieren', '36_wochentag' => 'Wochentag nicht erzeugen', '36_sortdatum1' => 'Briefsortierung', '36_fremddatierung' => 'Fremddatierung', '36_typ' => 'Brieftyp', '36_briefid' => 'Brief Identifier', '36_purl_web' => 'PURL web', '36_status' => 'Bearbeitungsstatus', '36_anmerkung' => 'Anmerkung (intern)', '36_anmerkungextern' => 'Anmerkung (extern)', '36_datengeber' => 'Datengeber', '36_purl' => 'OAI-Id', '36_leitd' => 'Druck 1:Bibliographische Angabe', '36_druck2' => 'Druck 2:Bibliographische Angabe', '36_druck3' => 'Druck 3:Bibliographische Angabe', '36_internhand' => 'Zugehörige Handschrift', '36_datengeberhand' => 'Datengeber', '36_purlhand' => 'OAI-Id', '36_purlhand_alt' => 'OAI-Id (alternative)', '36_signaturhand' => 'Signatur', '36_signaturhand_alt' => 'Signatur (alternative)', '36_h1prov' => 'Provenienz', '36_h1zahl' => 'Blatt-/Seitenzahl', '36_h1format' => 'Format', '36_h1besonder' => 'Besonderheiten', '36_hueberlieferung' => 'Ãœberlieferung', '36_infoinhalt' => 'Verschollen/erschlossen: Information über den Inhalt', '36_heditor' => 'Editor/in', '36_hredaktion' => 'Redakteur/in', '36_interndruck' => 'Zugehörige Druck', '36_band' => 'KFSA Band', '36_briefnr' => 'KFSA Brief-Nr.', '36_briefseite' => 'KFSA Seite', '36_incipit' => 'Incipit', '36_textgrundlage' => 'Textgrundlage Sigle', '36_uberstatus' => 'Ãœberlieferungsstatus', '36_gattung' => 'Gattung', '36_korrepsondentds' => 'Korrespondent_DS', '36_korrepsondentfs' => 'Korrespondent_FS', '36_ermitteltvon' => 'Ermittelt von', '36_metadatenintern' => 'Metadaten (intern)', '36_beilagen' => 'Beilage(en)', '36_abszusatz' => 'Verfasser Zusatzinfos', '36_adrzusatz' => 'Empfänger Zusatzinfos', '36_absortzusatz' => 'Verfasser Ort Zusatzinfos', '36_adrortzusatz' => 'Empfänger Ort Zusatzinfos', '36_datumzusatz' => 'Datum Zusatzinfos', '36_' => '', '36_KFSA Hand.hueberleiferung' => 'Ãœberlieferungsträger', '36_KFSA Hand.harchiv' => 'Archiv', '36_KFSA Hand.hsignatur' => 'Signatur', '36_KFSA Hand.hprovenienz' => 'Provenienz', '36_KFSA Hand.harchivlalt' => 'Archiv_alt', '36_KFSA Hand.hsignaturalt' => 'Signatur_alt', '36_KFSA Hand.hblattzahl' => 'Blattzahl', '36_KFSA Hand.hseitenzahl' => 'Seitenzahl', '36_KFSA Hand.hformat' => 'Format', '36_KFSA Hand.hadresse' => 'Adresse', '36_KFSA Hand.hvollstaendig' => 'Vollständigkeit', '36_KFSA Hand.hzusatzinfo' => 'H Zusatzinfos', '36_KFSA Druck.drliteratur' => 'Druck in', '36_KFSA Druck.drsigle' => 'Sigle', '36_KFSA Druck.drbandnrseite' => 'Bd./Nr./S.', '36_KFSA Druck.drfaksimile' => 'Faksimile', '36_KFSA Druck.drvollstaendig' => 'Vollständigkeit', '36_KFSA Druck.dzusatzinfo' => 'D Zusatzinfos', '36_KFSA Doku.dokliteratur' => 'Dokumentiert in', '36_KFSA Doku.doksigle' => 'Sigle', '36_KFSA Doku.dokbandnrseite' => 'Bd./Nr./S.', '36_KFSA Doku.dokfaksimile' => 'Faksimile', '36_KFSA Doku.dokvollstaendig' => 'Vollständigkeit', '36_KFSA Doku.dokzusatzinfo' => 'A Zusatzinfos', '36_Link Druck.url_titel_druck' => 'Titel/Bezeichnung', '36_Link Druck.url_image_druck' => 'Link zu Online-Dokument', '36_Link Hand.url_titel_hand' => 'Titel/Bezeichnung', '36_Link Hand.url_image_hand' => 'Link zu Online-Dokument', '36_preasentation' => 'Nicht in die Präsentation', '36_verlag' => 'Verlag', '36_anhang_tite0' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename0' => 'Image', '36_anhang_tite1' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename1' => 'Image', '36_anhang_tite2' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename2' => 'Image', '36_anhang_tite3' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename3' => 'Image', '36_anhang_tite4' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename4' => 'Image', '36_anhang_tite5' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename5' => 'Image', '36_anhang_tite6' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename6' => 'Image', '36_anhang_tite7' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename7' => 'Image', '36_anhang_tite8' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename8' => 'Image', '36_anhang_tite9' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename9' => 'Image', '36_anhang_titea' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcenamea' => 'Image', '36_anhang_titeb' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcenameb' => 'Image', '36_anhang_titec' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcenamec' => 'Image', '36_anhang_tited' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcenamed' => 'Image', '36_anhang_titee' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcenamee' => 'Image', '36_anhang_titeu' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcenameu' => 'Image', '36_anhang_titev' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcenamev' => 'Image', '36_anhang_titew' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcenamew' => 'Image', '36_anhang_titex' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcenamex' => 'Image', '36_anhang_titey' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcenamey' => 'Image', '36_anhang_titez' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcenamez' => 'Image', '36_anhang_tite10' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename10' => 'Image', '36_anhang_tite11' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename11' => 'Image', '36_anhang_tite12' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename12' => 'Image', '36_anhang_tite13' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename13' => 'Image', '36_anhang_tite14' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename14' => 'Image', '36_anhang_tite15' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename15' => 'Image', '36_anhang_tite16' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename16' => 'Image', '36_anhang_tite17' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename17' => 'Image', '36_anhang_tite18' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename18' => 'Image', '36_h_preasentation' => 'Nicht in die Präsentation', '36_anhang_titef' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcenamef' => 'Image', '36_anhang_titeg' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcenameg' => 'Image', '36_anhang_titeh' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcenameh' => 'Image', '36_anhang_titei' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcenamei' => 'Image', '36_anhang_titej' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcenamej' => 'Image', '36_anhang_titek' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcenamek' => 'Image', '36_anhang_titel' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcenamel' => 'Image', '36_anhang_titem' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcenamem' => 'Image', '36_anhang_titen' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcenamen' => 'Image', '36_anhang_titeo' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcenameo' => 'Image', '36_anhang_titep' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcenamep' => 'Image', '36_anhang_titeq' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcenameq' => 'Image', '36_anhang_titer' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcenamer' => 'Image', '36_anhang_tites' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcenames' => 'Image', '36_anhang_titet' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcenamet' => 'Image', '36_anhang_tite19' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename19' => 'Image', '36_anhang_tite20' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename20' => 'Image', '36_anhang_tite21' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename21' => 'Image', '36_anhang_tite22' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename22' => 'Image', '36_anhang_tite23' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename23' => 'Image', '36_anhang_tite24' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename24' => 'Image', '36_anhang_tite25' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename25' => 'Image', '36_anhang_tite26' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename26' => 'Image', '36_anhang_tite27' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename27' => 'Image', '36_anhang_tite28' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename28' => 'Image', '36_anhang_tite29' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename29' => 'Image', '36_anhang_tite30' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename30' => 'Image', '36_anhang_tite31' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename32' => 'Image', '36_anhang_tite33' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename33' => 'Image', '36_anhang_tite34' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename34' => 'Image', '36_Relationen.relation_art' => 'Art', '36_Relationen.relation_link' => 'Interner Link', '36_volltext' => 'Brieftext (Digitalisat Leitdruck oder Transkript Handschrift)', '36_History.hisbearbeiter' => 'Bearbeiter', '36_History.hisschritt' => 'Bearbeitungsschritt', '36_History.hisdatum' => 'Datum', '36_History.hisnotiz' => 'Notiz', '36_personen' => 'Personen', '36_werke' => 'Werke', '36_orte' => 'Orte', '36_themen' => 'Themen', '36_briedfehlt' => 'Fehlt', '36_briefbestellt' => 'Bestellt', '36_intrans' => 'Transkription', '36_intranskorr1' => 'Transkription Korrektur 1', '36_intranskorr2' => 'Transkription Korrektur 2', '36_intranscheck' => 'Transkription Korr. geprüft', '36_intranseintr' => 'Transkription Korr. eingetr', '36_inannotcheck' => 'Auszeichnungen Reg. geprüft', '36_inkollation' => 'Auszeichnungen Kollationierung', '36_inkollcheck' => 'Auszeichnungen Koll. geprüft', '36_himageupload' => 'H/h Digis hochgeladen', '36_dimageupload' => 'D Digis hochgeladen', '36_stand' => 'Bearbeitungsstand (Webseite)', '36_stand_d' => 'Bearbeitungsstand (Druck)', '36_timecreate' => 'Erstellt am', '36_timelastchg' => 'Zuletzt gespeichert am', '36_comment' => 'Kommentar(intern)', '36_accessid' => 'Access ID', '36_accessidalt' => 'Access ID-alt', '36_digifotos' => 'Digitalisat Fotos', '36_imagelink' => 'Imagelink', '36_vermekrbehler' => 'Notizen Behler', '36_vermekrotto' => 'Anmerkungen Otto', '36_vermekraccess' => 'Bearb-Vermerke Access', '36_zeugenbeschreib' => 'Zeugenbeschreibung', '36_sprache' => 'Sprache', '36_accessinfo1' => 'Archiv H (+ Signatur)', '36_korrekturbd36' => 'Korrekturen Bd. 36', '36_druckbd36' => 'Druckrelevant Bd. 36', '36_digitalisath1' => 'Digitalisat_H', '36_digitalisath2' => 'Digitalisat_h', '36_titelhs' => 'Titel_Hs', '36_accessinfo2' => 'Archiv H (+ Signatur)', '36_accessinfo3' => 'Sigle (Dokumentiert in + Bd./Nr./S.)', '36_accessinfo4' => 'Sigle (Druck in + Bd./Nr./S.)', '36_KFSA Hand.hschreibstoff' => 'Schreibstoff', '36_Relationen.relation_anmerkung' => null, '36_anhang_tite35' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename35' => 'Image', '36_anhang_tite36' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename36' => 'Image', '36_anhang_tite37' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename37' => 'Image', '36_anhang_tite38' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename38' => 'Image', '36_anhang_tite39' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename39' => 'Image', '36_anhang_tite40' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename40' => 'Image', '36_anhang_tite41' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename41' => 'Image', '36_anhang_tite42' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename42' => 'Image', '36_anhang_tite43' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename43' => 'Image', '36_anhang_tite44' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename44' => 'Image', '36_anhang_tite45' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename45' => 'Image', '36_anhang_tite46' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename46' => 'Image', '36_anhang_tite47' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename47' => 'Image', '36_anhang_tite48' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename48' => 'Image', '36_anhang_tite49' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename49' => 'Image', '36_anhang_tite50' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename50' => 'Image', '36_anhang_tite51' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename51' => 'Image', '36_anhang_tite52' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename52' => 'Image', '36_anhang_tite53' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename53' => 'Image', '36_anhang_tite54' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename54' => 'Image', '36_KFSA Hand.hbeschreibung' => 'Beschreibung', '36_KFSA Kritanhang.krit_infotyp' => 'Infotyp', '36_KFSA Kritanhang.krit_infotext' => 'Infotext', '36_datumspezif' => 'Datum Spezifikation', 'index_orte_10' => 'Orte', 'index_orte_10.content' => 'Orte', 'index_orte_10.comment' => 'Orte (Kommentar)', 'index_personen_11' => 'Personen', 'index_personen_11.content' => 'Personen', 'index_personen_11.comment' => 'Personen (Kommentar)', 'index_werke_12' => 'Werke', 'index_werke_12.content' => 'Werke', 'index_werke_12.comment' => 'Werke (Kommentar)', 'index_periodika_13' => 'Periodika', 'index_periodika_13.content' => 'Periodika', 'index_periodika_13.comment' => 'Periodika (Kommentar)', 'index_sachen_14' => 'Sachen', 'index_sachen_14.content' => 'Sachen', 'index_sachen_14.comment' => 'Sachen (Kommentar)', 'index_koerperschaften_15' => 'Koerperschaften', 'index_koerperschaften_15.content' => 'Koerperschaften', 'index_koerperschaften_15.comment' => 'Koerperschaften (Kommentar)', 'index_zitate_16' => 'Zitate', 'index_zitate_16.content' => 'Zitate', 'index_zitate_16.comment' => 'Zitate (Kommentar)', 'index_korrespondenzpartner_17' => 'Korrespondenzpartner', 'index_korrespondenzpartner_17.content' => 'Korrespondenzpartner', 'index_korrespondenzpartner_17.comment' => 'Korrespondenzpartner (Kommentar)', 'index_archive_18' => 'Archive', 'index_archive_18.content' => 'Archive', 'index_archive_18.comment' => 'Archive (Kommentar)', 'index_literatur_19' => 'Literatur', 'index_literatur_19.content' => 'Literatur', 'index_literatur_19.comment' => 'Literatur (Kommentar)', 'index_kunstwerke_kfsa_20' => 'Kunstwerke KFSA', 'index_kunstwerke_kfsa_20.content' => 'Kunstwerke KFSA', 'index_kunstwerke_kfsa_20.comment' => 'Kunstwerke KFSA (Kommentar)', 'index_druckwerke_kfsa_21' => 'Druckwerke KFSA', 'index_druckwerke_kfsa_21.content' => 'Druckwerke KFSA', 'index_druckwerke_kfsa_21.comment' => 'Druckwerke KFSA (Kommentar)', '36_fulltext' => 'XML Volltext', '36_html' => 'HTML Volltext', '36_publicHTML' => 'HTML Volltext', '36_plaintext' => 'Volltext', 'transcript.text' => 'Transkripte', 'folders' => 'Mappen', 'notes' => 'Notizen', 'notes.title' => 'Notizen (Titel)', 'notes.content' => 'Notizen', 'notes.category' => 'Notizen (Kategorie)', 'key' => 'FuD Schlüssel' ) ) $html = 'Bonn den 23sten Junius 1829.<br>Ew. Excellenz bitte ich um Erlaubniß, auf Ihr gestern empfangenes gehaltreiches Schreiben vorläufig nur einiges erwiedern zu dürfen. Ich habe eben eine sehr dringende Arbeit vor, worüber die Beantwortung, wenn sie ausführlich seyn sollte, gar zu lange verschoben bleiben könnte.<br>Ich werde gewiß nicht unterlassen, die Gründe für die neue Schreibung von neuem sorgfältig zu erwägen. Wäre ich aber noch so sehr von deren Statthaftigkeit und Zweckmäßigkeit überzeugt, so stände es nicht mehr in meiner Gewalt, sie in Ausübung zu bringen. Mein Hitôpadêsa ist gedruckt; vom Râmâyana ist der erste Band gedruckt, und wenn ich nun in dem zweiten die Methode plötzlich wechselte, so könnten die Leser mit Recht klagen, während das Töpferrad herumläuft, sey aus der <span class="slant-italic ">amphora</span> ein <span class="slant-italic ">urceus</span> geworden. Ferner möchte ich auch dem Râmâyana gern Eingang verschaffen. Es ist vorauszusehen, daß die Gelehrten in London, Paris und Calcutta sich gegen die Neuerung erklären werden. Ich bedarf aber einiges Absatzes, nicht um Gewinn zu haben, sondern nur um einen Theil der Kosten zu decken. Wenn dieß nicht erfolgt, so könnten leicht meine geringen Mittel erschöpft seyn, ehe ich das Werk zu Ende gebracht hätte. Die Subscription ist noch sehr kümmerlich, und jeder Band des Râmâyana kostet mir wenigstens 1000 Thaler. Alles zusammengenommen, Anschaffung kostbarer Bücher und Kunstsachen, Reisen, Unterstützung und Entschädigung meines Mitarbeiters, habe ich, mäßig angeschlagen, auf die Sanskrit-Studien schon über 5000 Thaler verwendet.<br>Da die festere Gränzbestimmung der Worttrennung Ew. Excellenz Beifall nicht gewonnen hat, so thut es mir nun wirklich leid, daß ich nicht alles ohne Zwischenräume gedruckt habe. Bei dem schließenden <span class="slant-italic ">n</span> habe ich Herrn Lassens Meynung nachgegeben. Solche unmerkliche Schritte ließen sich wohl wieder zurück thun.<br>Darüber, daß wir die Sylbentheilung nicht beobachten, können wir uns, glaube ich, beruhigen. In den alten Inschriften ist sie stark bezeichnet, in den Devanagari Manuscripten meistens weit weniger, und in den Bengalischen fließt alles in einander.<br>Ew. Excellenz glauben bei mir eine feindselige Gesinnung gegen Herrn Bopp wahrzunehmen. Folgendes sind die Thatsachen.<br>Ich habe ihn in sehr früher Zeit dem jetzt regierenden Könige von Baiern zur Unterstützung in England angelegentlich empfohlen, und mit Ihrem Herrn Bruder gemeinschaftlich etwas für ihn ausgewirkt; ich habe ihn in den Heidelberger Jahrbüchern dem Deutschen Publicum angekündigt, da noch niemand von ihm wußte; ich habe seinen Nalus mit Wärme aufgenommen, mit Nachdruck gelobt, und die Mängel nur leise berührt; ich habe seine Geschmacklosigkeit, seine holperichten Deutschen Verse, seine schülerhafte Latinität mit dem Mantel der Liebe bedeckt; ich habe ihm die Emendationen zum Nalus mitgetheilt, und ihm sogar die Handschrift anvertraut; ich habe ihn in der Vorrede zum Râmâyana ehrenvoll erwähnt, und ihm das Werk selbst zeitig, ehe es in den Buchhandel kam, zugeschickt. Ich habe also vom Anfange an bis auf den heutigen Tag das zuvorkommendste Betragen gegen ihn beobachtet.<br>Dafür habe ich nun sehr schlechten Dank erlebt. Schon vor einer Anzahl Jahren hat er mir einen übeln Streich gespielt, den ich ihm, wie aus obigem genugsam erhellet, nicht nachgetragen.<br>Eine vertrauliche Mittheilung von Einwürfen, wenn sie auch ganz ungegründet wären, ist immer ein freundschaftliches Verfahren. Denn wäre die Absicht feindlich, so würde man mit dem Angriffe gleich öffentlich hervortreten, damit er den Gegner unvorbereitet träfe.<br>Herr Bopp ist aber über die Nachweisung einiger Versehen in eine solche Entrüstung gerathen, er hat mir einen so ungehörigen Brief geschrieben, daß mir nichts übrig blieb, als die Fortsetzung des Briefwechsels höflich abzulehnen.<br>Jetzt da ich den vom Ministerium bewilligten Guß der kleinen Devanagari-Lettern verlange, bezeigt er sich äußerst ungefällig und legt mir Zögerungen und Hindernisse in den Weg.<br>Mein zweites Distichon besagt nichts weiter, als daß Herr Bopp einen ungültigen Sprachgebrauch zuweilen durch falsche Lesearten zu erweisen sucht. Davon liegen die Beispiele vor mir. Z. B. Arjuna p <span class="slant-italic ">p</span>. 77. Übrigens sind wohl keine Epigramme unschuldiger als die in einer fremden Sprache, welche kaum ein Dutzend Menschen in Deutschland verstehen; vollends wenn sie nur vertraulich mitgetheilt werden.<br>Herr Bopp hat allerdings grammatischen Sinn: wenn er nur die Indischen Grammatiker fleißiger studirt hätte, wenn er nicht immer Originalität anbringen wollte, wo sie nicht hingehört, so hätte er etwas recht gutes leisten mögen. Kritischer Sinn für die Unterscheidung des Ächten und Unächten oder Verfälschten mangelt ihm gänzlich. Deswegen macht er auch keinen Unterschied zwischen beglaubigten und unbeglaubigten Texten. In der Auslegungskunst ist er schwach. Z. B. in der Anmerkung über <span class="slant-italic ">ētāwat</span> (Arjun. <span class="slant-italic ">p</span>. 109, 110.) thut er fast unglaubliche Fehlgriffe. Er will mit Unrecht Wilkins zurechtweisen, und entstellt ganz was dieser gesagt hatte. – Es wäre leicht, die Beispiele zu häufen.<br>Wenn mir wegen freimüthiger öffentlicher Äußerungen über das, was mir, in einem wissenschaftlichen Gebiet, irrig und verkehrt scheint, Eifersucht angeschuldigt wird, so muß ich es mir gefallen lassen. Mir ist schon manchmal schlimmeres begegnet. In diesem Falle wäre aber doch die Hypothese sehr unwahrscheinlich, theils wegen des oben angeführten, theils weil ich zur Ausführung meiner bösen Absichten fünf Jahre versäumt hätte. Ich hatte in der That wichtigeres zu thun.<br>Ich hoffe, Ew. Excellenz werden den unerfreulichen Inhalt dieses Briefes meinem lebhaften Wunsche, mich vor Ihnen zu rechtfertigen, zu gute halten. Es wäre freilich angenehmer, einem so überschauenden und tief eindringenden Geiste gegenüber sich mit würdigeren Gegenständen der Betrachtung zu beschäftigen.<br>Vielerlei Störungen lassen mich in meinen Arbeiten nicht so vorwärts kommen, wie ich wohl wünschte. Im Sommer strömen mir die Reisenden von allen Weltgegenden zu, und es wäre doch unfreundlich, sie an der Thür abzuweisen. Seit vier Jahren führe ich den Vorsitz in einem Verein für die Vergrößerung und Verschönerung der Stadt. Nun bin ich auch Mitglied des Municipal-Rathes geworden. Ich wollte es nicht ablehnen, in der Hoffnung, zuweilen etwas auch für die Universität ersprießliches zu fördern.<br>In den öffentlichen Blättern habe ich mich bisher vergeblich nach guten Nachrichten von Ihrem Herrn Bruder umgesehen. Ich schließe mit den herzlichsten Wünschen für die Fortdauer Ihrer Gesundheit, und bitte Ew. Excellenz den Ausdruck meiner unveränderlichen Gesinnungen zu genehmigen.<br>Gehorsamst<br>AWvSchlegel.<br>Die Zeilen am Schlusse Ihres Briefes las ich mit inniger Rührung. Jedoch dünkt mich, bei dem Verluste des theuersten Gegenstandes liegt etwas tröstliches und linderndes in der Erinnerung der vollkommenen Harmonie, worin man gelebt hat. Wenn aber auf innige Gemeinschaft eine Trennung der Geister und Gemüther folgt, eine Spaltung, welche bis zum empörtesten Unwillen steigt, über die öffentliche Rolle, die der Andere spielt, über die Grundsätze, die er lehrt, über seine verwerflichen wiewohl ohnmächtigen Bestrebungen, Aberglauben und Geistesknechtschaft zu fördern; wenn in dieser Lage dann die letzte Trennung durch den Tod erfolgt: dann ist die Trauer zugleich unendlich schmerzlich und peinlich. Dieß war mein Fall mit meinem Bruder Friedrich. Verloren hatte ich ihn längst, und diese Wunde hat seit Jahren geblutet. So hat jeder seine eignen Leiden.' $isaprint = true $isnewtranslation = false $statemsg = 'betamsg15' $cittitle = '' $description = 'August Wilhelm von Schlegel an Wilhelm von Humboldt am 23.06.1829, Bonn' $adressatort = 'Unknown' $absendeort = 'Bonn <a class="gndmetadata" target="_blank" href="http://d-nb.info/gnd/1001909-1">GND</a>' $date = '23.06.1829' $adressat = array( (int) 2949 => array( 'ID' => '2949', 'project' => '1', 'timecreate' => '2013-10-17 13:02:22', 'timelastchg' => '2018-01-11 15:52:48', 'key' => 'AWS-ap-00av', 'docTyp' => array( 'name' => 'Person', 'id' => '39' ), '39_name' => 'Humboldt, Wilhelm von', '39_geschlecht' => 'm', '39_gebdatum' => '1767-06-22', '39_toddatum' => '1835-04-08', '39_pdb' => 'GND', '39_dbid' => '118554727', '39_quellen' => 'NDB@https://www.deutsche-biographie.de/gnd118554727.html#ndbcontent@ ADB@https://www.deutsche-biographie.de/gnd118554727.html#adbcontent@ WBIS@http://db.saur.de/WBIS/basicSearch.jsf@J023-835-2@ Wikipedia@https://de.wikipedia.org/wiki/Wilhelm_von_Humboldt@', '39_geburtsort' => array( 'ID' => '2275', 'content' => 'Potsdam', 'bemerkung' => 'GND:4046948-7', 'LmAdd' => array([maximum depth reached]) ), '39_sterbeort' => array( 'ID' => '10056', 'content' => 'Tegel', 'bemerkung' => 'GND:5007835-5', 'LmAdd' => array([maximum depth reached]) ), '39_lebenwirken' => 'Politiker, Sprachforscher, Publizist, Philosoph Wilhelm von Humboldt wuchs auf Schloss Tegel auf, dem Familienbesitz der Humboldts. Ab 1787 studierte Wilhelm zusammen mit seinem Bruder Alexander an der Universität in Frankfurt (Oder) Rechtswissenschaften. Ein Jahr später wechselte er an die Universität Göttingen, wo er den gleichfalls dort studierenden AWS kennenlernte. 1789 führte ihn eine Reise in das revolutionäre Paris. Anfang 1790 trat er nach Beendigung des Studiums in den Staatsdienst und erhielt eine Anstellung im Justizdepartement. 1791 heiratete er Caroline von Dacheröden, die Tochter eines preußischen Kammergerichtsrates. Im selben Jahr schied er aus dem Staatsdienst aus, um auf den Gütern der Familie von Dacheröden seine Studien der altgriechischen Sprache, Kultur, Kunst und Philosophie fortzusetzen. 1794 zog er nach Jena. Humboldt fungierte als konstruktiver Kritiker und gelehrter Ratgeber für die Protagonisten der Weimarer Klassik. Ab November 1797 lebte er in Paris, um seine Studien fortzuführen. Ausgiebige Reisen nach Spanien dienten auch der Erforschung der baskischen Kultur und Sprache. Von 1802 bis 1808 agierte Humboldt als preußischer Gesandter beim Heiligen Stuhl in Rom. Mit der Aufgabe der konsularischen Vertretung war Humboldt zeitlich nicht überfordert, so dass er genug Gelegenheit hatte, seine Studien weiter zu betreiben und sein Domizil zu einem gesellschaftlichen Mittelpunkt zu machen. 1809 wurde er Sektionschef für Kultus und Unterricht im Ministerium des Innern in Berlin. Humboldt galt als liberaler Bildungsreformer. Zu seinen Leistungen gehören ein neu gegliedertes Bildungssystem, das allen Schichten die Möglichkeit des Zugangs zu Bildung zusichern sollte, und die Vereinheitlichung der Abschlussprüfungen. Als weiterer Meilenstein kann Humboldts Beteiligung bei der Gründung der Universität Berlin gelten; zahlreiche renommierte Wissenschaftler konnten für die Lehrstühle gewonnen werden. Die Eröffnung der Universität im Oktober 1810 fand allerdings ohne Humboldt statt. Nach Auseinandersetzungen verließ er den Bildungssektor und ging als preußischer Gesandter nach Wien, später nach London. In dieser Funktion war er am Wiener Kongress beteiligt. 1819 schied er aus dem Staatsdienst aus und beschäftigte sich weiter mit sprachwissenschaftlichen Forschungen, darunter auch dem Sanskrit und dem Kâwi, der Sprache der indonesischen Insel Java. Wilhelms Bruder Alexander von Humboldt war ein bedeutender Naturforscher, die Brüder Humboldt gelten als die „preußischen Dioskuren“.', '39_namevar' => 'Humboldt, Friedrich Wilhelm Christian Karl Ferdinand von Humboldt, Carl W. von Humboldt, Wilhelm F. von Humboldt, Guillaume de Humboldt, Karl W. von Humboldt, Carl Wilhelm von Humboldt, G. de', '39_beziehung' => 'AWS kannte Wilhelm von Humboldt schon aus Göttinger Studentenzeiten, in Jena begegneten sie sich wieder. Schlegel war 1805 Gast Humboldts in Rom, zur Zeit von dessen preußischer Gesandtschaft. Humboldt und AWS korrespondierten auch über ihre sprachwissenschaftlichen Studien, von großer Kenntnis Humboldts zeugen die ausführlichen brieflichen Diskussionen über das Sanskrit. Humboldt steuerte Aufsätze zu Schlegels „Indischer Bibliothek“ bei. Beide Gelehrte begegneten sich mit großem Respekt, auch wenn sie nicht in allen fachlichen Überzeugungen übereinstimmten.', '39_status_person' => 'Vollständig', '39_sourcename0' => 'AWS-ap-00av-0.jpg', 'folders' => array( (int) 0 => 'Personen', (int) 1 => 'Personen' ), '_label' => '', '_descr' => '', '_model' => 'Person', '_model_title' => 'Person', '_model_titles' => 'People', '_url' => '' ) ) $adrCitation = 'Wilhelm von Humboldt' $absender = array() $absCitation = 'August Wilhelm von Schlegel' $percount = (int) 2 $notabs = false $tabs = array( 'text' => array( 'content' => 'Volltext Druck', 'exists' => '1' ), 'druck' => array( 'exists' => '1', 'content' => 'Digitalisat Druck' ) ) $parallelview = array( (int) 0 => '1', (int) 1 => '1' ) $dzi_imagesHand = array() $dzi_imagesDruck = array( (int) 0 => '/cake_fud/files/temp/images/dzi/AWS-aw-0234-0.jpg.xml', (int) 1 => '/cake_fud/files/temp/images/dzi/AWS-aw-0234-1.jpg.xml', (int) 2 => '/cake_fud/files/temp/images/dzi/AWS-aw-0234-2.jpg.xml', (int) 3 => '/cake_fud/files/temp/images/dzi/AWS-aw-0234-3.jpg.xml', (int) 4 => '/cake_fud/files/temp/images/dzi/AWS-aw-0234-4.jpg.xml' ) $indexesintext = array() $right = 'druck' $left = 'text' $handschrift = array() $druck = array( 'Bibliographische Angabe' => 'Briefwechsel zwischen Wilhelm von Humboldt und August Wilhelm Schlegel. Hg. v. Albert Leitzmann. Halle 1908, S. 242‒246.', 'Incipit' => '„Bonn den 23sten Junius 1829.<br>Ew. Excellenz bitte ich um Erlaubniß, auf Ihr gestern empfangenes gehaltreiches Schreiben vorläufig nur einiges erwiedern zu [...]“' ) $docmain = array( 'ID' => '3168', 'project' => '1', 'timecreate' => '2013-11-12 09:27:37', 'timelastchg' => '2019-10-11 12:48:38', 'key' => 'AWS-aw-0234', 'docTyp' => array( 'name' => 'Brief', 'id' => '36' ), '36_html' => 'Bonn den 23sten Junius 1829.<br>Ew. Excellenz bitte ich um Erlaubniß, auf Ihr gestern empfangenes gehaltreiches Schreiben vorläufig nur einiges erwiedern zu dürfen. Ich habe eben eine sehr dringende Arbeit vor, worüber die Beantwortung, wenn sie ausführlich seyn sollte, gar zu lange verschoben bleiben könnte.<br>Ich werde gewiß nicht unterlassen, die Gründe für die neue Schreibung von neuem sorgfältig zu erwägen. Wäre ich aber noch so sehr von deren Statthaftigkeit und Zweckmäßigkeit überzeugt, so stände es nicht mehr in meiner Gewalt, sie in Ausübung zu bringen. Mein Hitôpadêsa ist gedruckt; vom Râmâyana ist der erste Band gedruckt, und wenn ich nun in dem zweiten die Methode plötzlich wechselte, so könnten die Leser mit Recht klagen, während das Töpferrad herumläuft, sey aus der <span class="slant-italic ">amphora</span> ein <span class="slant-italic ">urceus</span> geworden. Ferner möchte ich auch dem Râmâyana gern Eingang verschaffen. Es ist vorauszusehen, daß die Gelehrten in London, Paris und Calcutta sich gegen die Neuerung erklären werden. Ich bedarf aber einiges Absatzes, nicht um Gewinn zu haben, sondern nur um einen Theil der Kosten zu decken. Wenn dieß nicht erfolgt, so könnten leicht meine geringen Mittel erschöpft seyn, ehe ich das Werk zu Ende gebracht hätte. Die Subscription ist noch sehr kümmerlich, und jeder Band des Râmâyana kostet mir wenigstens 1000 Thaler. Alles zusammengenommen, Anschaffung kostbarer Bücher und Kunstsachen, Reisen, Unterstützung und Entschädigung meines Mitarbeiters, habe ich, mäßig angeschlagen, auf die Sanskrit-Studien schon über 5000 Thaler verwendet.<br>Da die festere Gränzbestimmung der Worttrennung Ew. Excellenz Beifall nicht gewonnen hat, so thut es mir nun wirklich leid, daß ich nicht alles ohne Zwischenräume gedruckt habe. Bei dem schließenden <span class="slant-italic ">n</span> habe ich Herrn Lassens Meynung nachgegeben. Solche unmerkliche Schritte ließen sich wohl wieder zurück thun.<br>Darüber, daß wir die Sylbentheilung nicht beobachten, können wir uns, glaube ich, beruhigen. In den alten Inschriften ist sie stark bezeichnet, in den Devanagari Manuscripten meistens weit weniger, und in den Bengalischen fließt alles in einander.<br>Ew. Excellenz glauben bei mir eine feindselige Gesinnung gegen Herrn Bopp wahrzunehmen. Folgendes sind die Thatsachen.<br>Ich habe ihn in sehr früher Zeit dem jetzt regierenden Könige von Baiern zur Unterstützung in England angelegentlich empfohlen, und mit Ihrem Herrn Bruder gemeinschaftlich etwas für ihn ausgewirkt; ich habe ihn in den Heidelberger Jahrbüchern dem Deutschen Publicum angekündigt, da noch niemand von ihm wußte; ich habe seinen Nalus mit Wärme aufgenommen, mit Nachdruck gelobt, und die Mängel nur leise berührt; ich habe seine Geschmacklosigkeit, seine holperichten Deutschen Verse, seine schülerhafte Latinität mit dem Mantel der Liebe bedeckt; ich habe ihm die Emendationen zum Nalus mitgetheilt, und ihm sogar die Handschrift anvertraut; ich habe ihn in der Vorrede zum Râmâyana ehrenvoll erwähnt, und ihm das Werk selbst zeitig, ehe es in den Buchhandel kam, zugeschickt. Ich habe also vom Anfange an bis auf den heutigen Tag das zuvorkommendste Betragen gegen ihn beobachtet.<br>Dafür habe ich nun sehr schlechten Dank erlebt. Schon vor einer Anzahl Jahren hat er mir einen übeln Streich gespielt, den ich ihm, wie aus obigem genugsam erhellet, nicht nachgetragen.<br>Eine vertrauliche Mittheilung von Einwürfen, wenn sie auch ganz ungegründet wären, ist immer ein freundschaftliches Verfahren. Denn wäre die Absicht feindlich, so würde man mit dem Angriffe gleich öffentlich hervortreten, damit er den Gegner unvorbereitet träfe.<br>Herr Bopp ist aber über die Nachweisung einiger Versehen in eine solche Entrüstung gerathen, er hat mir einen so ungehörigen Brief geschrieben, daß mir nichts übrig blieb, als die Fortsetzung des Briefwechsels höflich abzulehnen.<br>Jetzt da ich den vom Ministerium bewilligten Guß der kleinen Devanagari-Lettern verlange, bezeigt er sich äußerst ungefällig und legt mir Zögerungen und Hindernisse in den Weg.<br>Mein zweites Distichon besagt nichts weiter, als daß Herr Bopp einen ungültigen Sprachgebrauch zuweilen durch falsche Lesearten zu erweisen sucht. Davon liegen die Beispiele vor mir. Z. B. Arjuna p <span class="slant-italic ">p</span>. 77. Übrigens sind wohl keine Epigramme unschuldiger als die in einer fremden Sprache, welche kaum ein Dutzend Menschen in Deutschland verstehen; vollends wenn sie nur vertraulich mitgetheilt werden.<br>Herr Bopp hat allerdings grammatischen Sinn: wenn er nur die Indischen Grammatiker fleißiger studirt hätte, wenn er nicht immer Originalität anbringen wollte, wo sie nicht hingehört, so hätte er etwas recht gutes leisten mögen. Kritischer Sinn für die Unterscheidung des Ächten und Unächten oder Verfälschten mangelt ihm gänzlich. Deswegen macht er auch keinen Unterschied zwischen beglaubigten und unbeglaubigten Texten. In der Auslegungskunst ist er schwach. Z. B. in der Anmerkung über <span class="slant-italic ">ētāwat</span> (Arjun. <span class="slant-italic ">p</span>. 109, 110.) thut er fast unglaubliche Fehlgriffe. Er will mit Unrecht Wilkins zurechtweisen, und entstellt ganz was dieser gesagt hatte. – Es wäre leicht, die Beispiele zu häufen.<br>Wenn mir wegen freimüthiger öffentlicher Äußerungen über das, was mir, in einem wissenschaftlichen Gebiet, irrig und verkehrt scheint, Eifersucht angeschuldigt wird, so muß ich es mir gefallen lassen. Mir ist schon manchmal schlimmeres begegnet. In diesem Falle wäre aber doch die Hypothese sehr unwahrscheinlich, theils wegen des oben angeführten, theils weil ich zur Ausführung meiner bösen Absichten fünf Jahre versäumt hätte. Ich hatte in der That wichtigeres zu thun.<br>Ich hoffe, Ew. Excellenz werden den unerfreulichen Inhalt dieses Briefes meinem lebhaften Wunsche, mich vor Ihnen zu rechtfertigen, zu gute halten. Es wäre freilich angenehmer, einem so überschauenden und tief eindringenden Geiste gegenüber sich mit würdigeren Gegenständen der Betrachtung zu beschäftigen.<br>Vielerlei Störungen lassen mich in meinen Arbeiten nicht so vorwärts kommen, wie ich wohl wünschte. Im Sommer strömen mir die Reisenden von allen Weltgegenden zu, und es wäre doch unfreundlich, sie an der Thür abzuweisen. Seit vier Jahren führe ich den Vorsitz in einem Verein für die Vergrößerung und Verschönerung der Stadt. Nun bin ich auch Mitglied des Municipal-Rathes geworden. Ich wollte es nicht ablehnen, in der Hoffnung, zuweilen etwas auch für die Universität ersprießliches zu fördern.<br>In den öffentlichen Blättern habe ich mich bisher vergeblich nach guten Nachrichten von Ihrem Herrn Bruder umgesehen. Ich schließe mit den herzlichsten Wünschen für die Fortdauer Ihrer Gesundheit, und bitte Ew. Excellenz den Ausdruck meiner unveränderlichen Gesinnungen zu genehmigen.<br>Gehorsamst<br>AWvSchlegel.<br>Die Zeilen am Schlusse Ihres Briefes las ich mit inniger Rührung. Jedoch dünkt mich, bei dem Verluste des theuersten Gegenstandes liegt etwas tröstliches und linderndes in der Erinnerung der vollkommenen Harmonie, worin man gelebt hat. Wenn aber auf innige Gemeinschaft eine Trennung der Geister und Gemüther folgt, eine Spaltung, welche bis zum empörtesten Unwillen steigt, über die öffentliche Rolle, die der Andere spielt, über die Grundsätze, die er lehrt, über seine verwerflichen wiewohl ohnmächtigen Bestrebungen, Aberglauben und Geistesknechtschaft zu fördern; wenn in dieser Lage dann die letzte Trennung durch den Tod erfolgt: dann ist die Trauer zugleich unendlich schmerzlich und peinlich. Dieß war mein Fall mit meinem Bruder Friedrich. Verloren hatte ich ihn längst, und diese Wunde hat seit Jahren geblutet. So hat jeder seine eignen Leiden.', '36_xml' => '<p>Bonn den 23sten Junius 1829.<lb/>Ew. Excellenz bitte ich um Erlaubniß, auf Ihr gestern empfangenes gehaltreiches Schreiben vorläufig nur einiges erwiedern zu dürfen. Ich habe eben eine sehr dringende Arbeit vor, worüber die Beantwortung, wenn sie ausführlich seyn sollte, gar zu lange verschoben bleiben könnte.<lb/>Ich werde gewiß nicht unterlassen, die Gründe für die neue Schreibung von neuem sorgfältig zu erwägen. Wäre ich aber noch so sehr von deren Statthaftigkeit und Zweckmäßigkeit überzeugt, so stände es nicht mehr in meiner Gewalt, sie in Ausübung zu bringen. Mein Hitôpadêsa ist gedruckt; vom Râmâyana ist der erste Band gedruckt, und wenn ich nun in dem zweiten die Methode plötzlich wechselte, so könnten die Leser mit Recht klagen, während das Töpferrad herumläuft, sey aus der <hi rend="slant:italic">amphora</hi> ein <hi rend="slant:italic">urceus</hi> geworden. Ferner möchte ich auch dem Râmâyana gern Eingang verschaffen. Es ist vorauszusehen, daß die Gelehrten in London, Paris und Calcutta sich gegen die Neuerung erklären werden. Ich bedarf aber einiges Absatzes, nicht um Gewinn zu haben, sondern nur um einen Theil der Kosten zu decken. Wenn dieß nicht erfolgt, so könnten leicht meine geringen Mittel erschöpft seyn, ehe ich das Werk zu Ende gebracht hätte. Die Subscription ist noch sehr kümmerlich, und jeder Band des Râmâyana kostet mir wenigstens 1000 Thaler. Alles zusammengenommen, Anschaffung kostbarer Bücher und Kunstsachen, Reisen, Unterstützung und Entschädigung meines Mitarbeiters, habe ich, mäßig angeschlagen, auf die Sanskrit-Studien schon über 5000 Thaler verwendet.<lb/>Da die festere Gränzbestimmung der Worttrennung Ew. Excellenz Beifall nicht gewonnen hat, so thut es mir nun wirklich leid, daß ich nicht alles ohne Zwischenräume gedruckt habe. Bei dem schließenden <hi rend="slant:italic">n</hi> habe ich Herrn Lassens Meynung nachgegeben. Solche unmerkliche Schritte ließen sich wohl wieder zurück thun.<lb/>Darüber, daß wir die Sylbentheilung nicht beobachten, können wir uns, glaube ich, beruhigen. In den alten Inschriften ist sie stark bezeichnet, in den Devanagari Manuscripten meistens weit weniger, und in den Bengalischen fließt alles in einander.<lb/>Ew. Excellenz glauben bei mir eine feindselige Gesinnung gegen Herrn Bopp wahrzunehmen. Folgendes sind die Thatsachen.<lb/>Ich habe ihn in sehr früher Zeit dem jetzt regierenden Könige von Baiern zur Unterstützung in England angelegentlich empfohlen, und mit Ihrem Herrn Bruder gemeinschaftlich etwas für ihn ausgewirkt; ich habe ihn in den Heidelberger Jahrbüchern dem Deutschen Publicum angekündigt, da noch niemand von ihm wußte; ich habe seinen Nalus mit Wärme aufgenommen, mit Nachdruck gelobt, und die Mängel nur leise berührt; ich habe seine Geschmacklosigkeit, seine holperichten Deutschen Verse, seine schülerhafte Latinität mit dem Mantel der Liebe bedeckt; ich habe ihm die Emendationen zum Nalus mitgetheilt, und ihm sogar die Handschrift anvertraut; ich habe ihn in der Vorrede zum Râmâyana ehrenvoll erwähnt, und ihm das Werk selbst zeitig, ehe es in den Buchhandel kam, zugeschickt. Ich habe also vom Anfange an bis auf den heutigen Tag das zuvorkommendste Betragen gegen ihn beobachtet.<lb/>Dafür habe ich nun sehr schlechten Dank erlebt. Schon vor einer Anzahl Jahren hat er mir einen übeln Streich gespielt, den ich ihm, wie aus obigem genugsam erhellet, nicht nachgetragen.<lb/>Eine vertrauliche Mittheilung von Einwürfen, wenn sie auch ganz ungegründet wären, ist immer ein freundschaftliches Verfahren. Denn wäre die Absicht feindlich, so würde man mit dem Angriffe gleich öffentlich hervortreten, damit er den Gegner unvorbereitet träfe.<lb/>Herr Bopp ist aber über die Nachweisung einiger Versehen in eine solche Entrüstung gerathen, er hat mir einen so ungehörigen Brief geschrieben, daß mir nichts übrig blieb, als die Fortsetzung des Briefwechsels höflich abzulehnen.<lb/>Jetzt da ich den vom Ministerium bewilligten Guß der kleinen Devanagari-Lettern verlange, bezeigt er sich äußerst ungefällig und legt mir Zögerungen und Hindernisse in den Weg.<lb/>Mein zweites Distichon besagt nichts weiter, als daß Herr Bopp einen ungültigen Sprachgebrauch zuweilen durch falsche Lesearten zu erweisen sucht. Davon liegen die Beispiele vor mir. Z. B. Arjuna p <hi rend="slant:italic">p</hi>. 77. Übrigens sind wohl keine Epigramme unschuldiger als die in einer fremden Sprache, welche kaum ein Dutzend Menschen in Deutschland verstehen; vollends wenn sie nur vertraulich mitgetheilt werden.<lb/>Herr Bopp hat allerdings grammatischen Sinn: wenn er nur die Indischen Grammatiker fleißiger studirt hätte, wenn er nicht immer Originalität anbringen wollte, wo sie nicht hingehört, so hätte er etwas recht gutes leisten mögen. Kritischer Sinn für die Unterscheidung des Ächten und Unächten oder Verfälschten mangelt ihm gänzlich. Deswegen macht er auch keinen Unterschied zwischen beglaubigten und unbeglaubigten Texten. In der Auslegungskunst ist er schwach. Z. B. in der Anmerkung über <hi rend="slant:italic">ētāwat</hi> (Arjun. <hi rend="slant:italic">p</hi>. 109, 110.) thut er fast unglaubliche Fehlgriffe. Er will mit Unrecht Wilkins zurechtweisen, und entstellt ganz was dieser gesagt hatte. – Es wäre leicht, die Beispiele zu häufen.<lb/>Wenn mir wegen freimüthiger öffentlicher Äußerungen über das, was mir, in einem wissenschaftlichen Gebiet, irrig und verkehrt scheint, Eifersucht angeschuldigt wird, so muß ich es mir gefallen lassen. Mir ist schon manchmal schlimmeres begegnet. In diesem Falle wäre aber doch die Hypothese sehr unwahrscheinlich, theils wegen des oben angeführten, theils weil ich zur Ausführung meiner bösen Absichten fünf Jahre versäumt hätte. Ich hatte in der That wichtigeres zu thun.<lb/>Ich hoffe, Ew. Excellenz werden den unerfreulichen Inhalt dieses Briefes meinem lebhaften Wunsche, mich vor Ihnen zu rechtfertigen, zu gute halten. Es wäre freilich angenehmer, einem so überschauenden und tief eindringenden Geiste gegenüber sich mit würdigeren Gegenständen der Betrachtung zu beschäftigen.<lb/>Vielerlei Störungen lassen mich in meinen Arbeiten nicht so vorwärts kommen, wie ich wohl wünschte. Im Sommer strömen mir die Reisenden von allen Weltgegenden zu, und es wäre doch unfreundlich, sie an der Thür abzuweisen. Seit vier Jahren führe ich den Vorsitz in einem Verein für die Vergrößerung und Verschönerung der Stadt. Nun bin ich auch Mitglied des Municipal-Rathes geworden. Ich wollte es nicht ablehnen, in der Hoffnung, zuweilen etwas auch für die Universität ersprießliches zu fördern.<lb/>In den öffentlichen Blättern habe ich mich bisher vergeblich nach guten Nachrichten von Ihrem Herrn Bruder umgesehen. Ich schließe mit den herzlichsten Wünschen für die Fortdauer Ihrer Gesundheit, und bitte Ew. Excellenz den Ausdruck meiner unveränderlichen Gesinnungen zu genehmigen.<lb/>Gehorsamst<lb/>AWvSchlegel.<lb/>Die Zeilen am Schlusse Ihres Briefes las ich mit inniger Rührung. Jedoch dünkt mich, bei dem Verluste des theuersten Gegenstandes liegt etwas tröstliches und linderndes in der Erinnerung der vollkommenen Harmonie, worin man gelebt hat. Wenn aber auf innige Gemeinschaft eine Trennung der Geister und Gemüther folgt, eine Spaltung, welche bis zum empörtesten Unwillen steigt, über die öffentliche Rolle, die der Andere spielt, über die Grundsätze, die er lehrt, über seine verwerflichen wiewohl ohnmächtigen Bestrebungen, Aberglauben und Geistesknechtschaft zu fördern; wenn in dieser Lage dann die letzte Trennung durch den Tod erfolgt: dann ist die Trauer zugleich unendlich schmerzlich und peinlich. Dieß war mein Fall mit meinem Bruder Friedrich. Verloren hatte ich ihn längst, und diese Wunde hat seit Jahren geblutet. So hat jeder seine eignen Leiden.</p>', '36_xml_standoff' => 'Bonn den 23sten Junius 1829.<lb/>Ew. Excellenz bitte ich um Erlaubniß, auf Ihr gestern empfangenes gehaltreiches Schreiben vorläufig nur einiges erwiedern zu dürfen. Ich habe eben eine sehr dringende Arbeit vor, worüber die Beantwortung, wenn sie ausführlich seyn sollte, gar zu lange verschoben bleiben könnte.<lb/>Ich werde gewiß nicht unterlassen, die Gründe für die neue Schreibung von neuem sorgfältig zu erwägen. Wäre ich aber noch so sehr von deren Statthaftigkeit und Zweckmäßigkeit überzeugt, so stände es nicht mehr in meiner Gewalt, sie in Ausübung zu bringen. Mein Hitôpadêsa ist gedruckt; vom Râmâyana ist der erste Band gedruckt, und wenn ich nun in dem zweiten die Methode plötzlich wechselte, so könnten die Leser mit Recht klagen, während das Töpferrad herumläuft, sey aus der <hi rend="slant:italic">amphora</hi> ein <hi rend="slant:italic">urceus</hi> geworden. Ferner möchte ich auch dem Râmâyana gern Eingang verschaffen. Es ist vorauszusehen, daß die Gelehrten in London, Paris und Calcutta sich gegen die Neuerung erklären werden. Ich bedarf aber einiges Absatzes, nicht um Gewinn zu haben, sondern nur um einen Theil der Kosten zu decken. Wenn dieß nicht erfolgt, so könnten leicht meine geringen Mittel erschöpft seyn, ehe ich das Werk zu Ende gebracht hätte. Die Subscription ist noch sehr kümmerlich, und jeder Band des Râmâyana kostet mir wenigstens 1000 Thaler. Alles zusammengenommen, Anschaffung kostbarer Bücher und Kunstsachen, Reisen, Unterstützung und Entschädigung meines Mitarbeiters, habe ich, mäßig angeschlagen, auf die Sanskrit-Studien schon über 5000 Thaler verwendet.<lb/>Da die festere Gränzbestimmung der Worttrennung Ew. Excellenz Beifall nicht gewonnen hat, so thut es mir nun wirklich leid, daß ich nicht alles ohne Zwischenräume gedruckt habe. Bei dem schließenden <hi rend="slant:italic">n</hi> habe ich Herrn Lassens Meynung nachgegeben. Solche unmerkliche Schritte ließen sich wohl wieder zurück thun.<lb/>Darüber, daß wir die Sylbentheilung nicht beobachten, können wir uns, glaube ich, beruhigen. In den alten Inschriften ist sie stark bezeichnet, in den Devanagari Manuscripten meistens weit weniger, und in den Bengalischen fließt alles in einander.<lb/>Ew. Excellenz glauben bei mir eine feindselige Gesinnung gegen Herrn Bopp wahrzunehmen. Folgendes sind die Thatsachen.<lb/>Ich habe ihn in sehr früher Zeit dem jetzt regierenden Könige von Baiern zur Unterstützung in England angelegentlich empfohlen, und mit Ihrem Herrn Bruder gemeinschaftlich etwas für ihn ausgewirkt; ich habe ihn in den Heidelberger Jahrbüchern dem Deutschen Publicum angekündigt, da noch niemand von ihm wußte; ich habe seinen Nalus mit Wärme aufgenommen, mit Nachdruck gelobt, und die Mängel nur leise berührt; ich habe seine Geschmacklosigkeit, seine holperichten Deutschen Verse, seine schülerhafte Latinität mit dem Mantel der Liebe bedeckt; ich habe ihm die Emendationen zum Nalus mitgetheilt, und ihm sogar die Handschrift anvertraut; ich habe ihn in der Vorrede zum Râmâyana ehrenvoll erwähnt, und ihm das Werk selbst zeitig, ehe es in den Buchhandel kam, zugeschickt. Ich habe also vom Anfange an bis auf den heutigen Tag das zuvorkommendste Betragen gegen ihn beobachtet.<lb/>Dafür habe ich nun sehr schlechten Dank erlebt. Schon vor einer Anzahl Jahren hat er mir einen übeln Streich gespielt, den ich ihm, wie aus obigem genugsam erhellet, nicht nachgetragen.<lb/>Eine vertrauliche Mittheilung von Einwürfen, wenn sie auch ganz ungegründet wären, ist immer ein freundschaftliches Verfahren. Denn wäre die Absicht feindlich, so würde man mit dem Angriffe gleich öffentlich hervortreten, damit er den Gegner unvorbereitet träfe.<lb/>Herr Bopp ist aber über die Nachweisung einiger Versehen in eine solche Entrüstung gerathen, er hat mir einen so ungehörigen Brief geschrieben, daß mir nichts übrig blieb, als die Fortsetzung des Briefwechsels höflich abzulehnen.<lb/>Jetzt da ich den vom Ministerium bewilligten Guß der kleinen Devanagari-Lettern verlange, bezeigt er sich äußerst ungefällig und legt mir Zögerungen und Hindernisse in den Weg.<lb/>Mein zweites Distichon besagt nichts weiter, als daß Herr Bopp einen ungültigen Sprachgebrauch zuweilen durch falsche Lesearten zu erweisen sucht. Davon liegen die Beispiele vor mir. Z. B. Arjuna p <hi rend="slant:italic">p</hi>. 77. Übrigens sind wohl keine Epigramme unschuldiger als die in einer fremden Sprache, welche kaum ein Dutzend Menschen in Deutschland verstehen; vollends wenn sie nur vertraulich mitgetheilt werden.<lb/>Herr Bopp hat allerdings grammatischen Sinn: wenn er nur die Indischen Grammatiker fleißiger studirt hätte, wenn er nicht immer Originalität anbringen wollte, wo sie nicht hingehört, so hätte er etwas recht gutes leisten mögen. Kritischer Sinn für die Unterscheidung des Ächten und Unächten oder Verfälschten mangelt ihm gänzlich. Deswegen macht er auch keinen Unterschied zwischen beglaubigten und unbeglaubigten Texten. In der Auslegungskunst ist er schwach. Z. B. in der Anmerkung über <hi rend="slant:italic">ētāwat</hi> (Arjun. <hi rend="slant:italic">p</hi>. 109, 110.) thut er fast unglaubliche Fehlgriffe. Er will mit Unrecht Wilkins zurechtweisen, und entstellt ganz was dieser gesagt hatte. – Es wäre leicht, die Beispiele zu häufen.<lb/>Wenn mir wegen freimüthiger öffentlicher Äußerungen über das, was mir, in einem wissenschaftlichen Gebiet, irrig und verkehrt scheint, Eifersucht angeschuldigt wird, so muß ich es mir gefallen lassen. Mir ist schon manchmal schlimmeres begegnet. In diesem Falle wäre aber doch die Hypothese sehr unwahrscheinlich, theils wegen des oben angeführten, theils weil ich zur Ausführung meiner bösen Absichten fünf Jahre versäumt hätte. Ich hatte in der That wichtigeres zu thun.<lb/>Ich hoffe, Ew. Excellenz werden den unerfreulichen Inhalt dieses Briefes meinem lebhaften Wunsche, mich vor Ihnen zu rechtfertigen, zu gute halten. Es wäre freilich angenehmer, einem so überschauenden und tief eindringenden Geiste gegenüber sich mit würdigeren Gegenständen der Betrachtung zu beschäftigen.<lb/>Vielerlei Störungen lassen mich in meinen Arbeiten nicht so vorwärts kommen, wie ich wohl wünschte. Im Sommer strömen mir die Reisenden von allen Weltgegenden zu, und es wäre doch unfreundlich, sie an der Thür abzuweisen. Seit vier Jahren führe ich den Vorsitz in einem Verein für die Vergrößerung und Verschönerung der Stadt. Nun bin ich auch Mitglied des Municipal-Rathes geworden. Ich wollte es nicht ablehnen, in der Hoffnung, zuweilen etwas auch für die Universität ersprießliches zu fördern.<lb/>In den öffentlichen Blättern habe ich mich bisher vergeblich nach guten Nachrichten von Ihrem Herrn Bruder umgesehen. Ich schließe mit den herzlichsten Wünschen für die Fortdauer Ihrer Gesundheit, und bitte Ew. Excellenz den Ausdruck meiner unveränderlichen Gesinnungen zu genehmigen.<lb/>Gehorsamst<lb/>AWvSchlegel.<lb/>Die Zeilen am Schlusse Ihres Briefes las ich mit inniger Rührung. Jedoch dünkt mich, bei dem Verluste des theuersten Gegenstandes liegt etwas tröstliches und linderndes in der Erinnerung der vollkommenen Harmonie, worin man gelebt hat. Wenn aber auf innige Gemeinschaft eine Trennung der Geister und Gemüther folgt, eine Spaltung, welche bis zum empörtesten Unwillen steigt, über die öffentliche Rolle, die der Andere spielt, über die Grundsätze, die er lehrt, über seine verwerflichen wiewohl ohnmächtigen Bestrebungen, Aberglauben und Geistesknechtschaft zu fördern; wenn in dieser Lage dann die letzte Trennung durch den Tod erfolgt: dann ist die Trauer zugleich unendlich schmerzlich und peinlich. Dieß war mein Fall mit meinem Bruder Friedrich. Verloren hatte ich ihn längst, und diese Wunde hat seit Jahren geblutet. So hat jeder seine eignen Leiden.', '36_briefid' => 'Leitzmann1908_AWSanWvHumboldt_23061829', '36_absender' => array( (int) 0 => array( 'ID' => '7125', 'content' => 'August Wilhelm von Schlegel', 'bemerkung' => '', 'altBegriff' => 'Schlegel, August Wilhelm von', 'LmAdd' => array( [maximum depth reached] ) ) ), '36_adressat' => array( (int) 0 => array( 'ID' => '7317', 'content' => 'Wilhelm von Humboldt', 'bemerkung' => '', 'altBegriff' => 'Humboldt, Wilhelm von', 'LmAdd' => array( [maximum depth reached] ) ) ), '36_datumvon' => '1829-06-23', '36_sprache' => array( (int) 0 => 'Deutsch' ), '36_absenderort' => array( (int) 0 => array( 'ID' => '887', 'content' => 'Bonn', 'bemerkung' => 'GND:1001909-1', 'altBegriff' => '', 'LmAdd' => array([maximum depth reached]) ) ), '36_leitd' => 'Briefwechsel zwischen Wilhelm von Humboldt und August Wilhelm Schlegel. Hg. v. Albert Leitzmann. Halle 1908, S. 242‒246.', '36_status' => 'Einmal kollationierter Druckvolltext ohne Registerauszeichnung', '36_Datum' => '1829-06-23', '36_facet_absender' => array( (int) 0 => 'August Wilhelm von Schlegel' ), '36_facet_absender_reverse' => array( (int) 0 => 'Schlegel, August Wilhelm von' ), '36_facet_adressat' => array( (int) 0 => 'Wilhelm von Humboldt' ), '36_facet_adressat_reverse' => array( (int) 0 => 'Humboldt, Wilhelm von' ), '36_facet_absenderort' => array( (int) 0 => 'Bonn' ), '36_facet_adressatort' => '', '36_facet_status' => 'Einmal kollationierter Druckvolltext ohne Registerauszeichnung', '36_facet_datengeberhand' => '', '36_facet_sprache' => array( (int) 0 => 'Deutsch' ), '36_facet_korrespondenten' => array( (int) 0 => 'Wilhelm von Humboldt' ), '36_Digitalisat_Druck_Server' => array( (int) 0 => 'AWS-aw-0234-0.jpg', (int) 1 => 'AWS-aw-0234-1.jpg', (int) 2 => 'AWS-aw-0234-2.jpg', (int) 3 => 'AWS-aw-0234-3.jpg', (int) 4 => 'AWS-aw-0234-4.jpg' ), '_label' => '', '_descr' => '', '_model' => 'Letter', '_model_title' => 'Letter', '_model_titles' => 'Letters', '_url' => '' ) $doctype_name = 'Letters' $captions = array( '36_dummy' => '', '36_absender' => 'Absender/Verfasser', '36_absverif1' => 'Verfasser Verifikation', '36_absender2' => 'Verfasser 2', '36_absverif2' => 'Verfasser 2 Verifikation', '36_absbrieftyp2' => 'Verfasser 2 Brieftyp', '36_absender3' => 'Verfasser 3', '36_absverif3' => 'Verfasser 3 Verifikation', '36_absbrieftyp3' => 'Verfasser 3 Brieftyp', '36_adressat' => 'Adressat/Empfänger', '36_adrverif1' => 'Empfänger Verifikation', '36_adressat2' => 'Empfänger 2', '36_adrverif2' => 'Empfänger 2 Verifikation', '36_adressat3' => 'Empfänger 3', '36_adrverif3' => 'Empfänger 3 Verifikation', '36_adressatfalsch' => 'Empfänger_falsch', '36_absenderort' => 'Ort Absender/Verfasser', '36_absortverif1' => 'Ort Verfasser Verifikation', '36_absortungenau' => 'Ort Verfasser ungenau', '36_absenderort2' => 'Ort Verfasser 2', '36_absortverif2' => 'Ort Verfasser 2 Verifikation', '36_absenderort3' => 'Ort Verfasser 3', '36_absortverif3' => 'Ort Verfasser 3 Verifikation', '36_adressatort' => 'Ort Adressat/Empfänger', '36_adrortverif' => 'Ort Empfänger Verifikation', '36_datumvon' => 'Datum von', '36_datumbis' => 'Datum bis', '36_altDat' => 'Datum/Datum manuell', '36_datumverif' => 'Datum Verifikation', '36_sortdatum' => 'Datum zum Sortieren', '36_wochentag' => 'Wochentag nicht erzeugen', '36_sortdatum1' => 'Briefsortierung', '36_fremddatierung' => 'Fremddatierung', '36_typ' => 'Brieftyp', '36_briefid' => 'Brief Identifier', '36_purl_web' => 'PURL web', '36_status' => 'Bearbeitungsstatus', '36_anmerkung' => 'Anmerkung (intern)', '36_anmerkungextern' => 'Anmerkung (extern)', '36_datengeber' => 'Datengeber', '36_purl' => 'OAI-Id', '36_leitd' => 'Druck 1:Bibliographische Angabe', '36_druck2' => 'Druck 2:Bibliographische Angabe', '36_druck3' => 'Druck 3:Bibliographische Angabe', '36_internhand' => 'Zugehörige Handschrift', '36_datengeberhand' => 'Datengeber', '36_purlhand' => 'OAI-Id', '36_purlhand_alt' => 'OAI-Id (alternative)', '36_signaturhand' => 'Signatur', '36_signaturhand_alt' => 'Signatur (alternative)', '36_h1prov' => 'Provenienz', '36_h1zahl' => 'Blatt-/Seitenzahl', '36_h1format' => 'Format', '36_h1besonder' => 'Besonderheiten', '36_hueberlieferung' => 'Ãœberlieferung', '36_infoinhalt' => 'Verschollen/erschlossen: Information über den Inhalt', '36_heditor' => 'Editor/in', '36_hredaktion' => 'Redakteur/in', '36_interndruck' => 'Zugehörige Druck', '36_band' => 'KFSA Band', '36_briefnr' => 'KFSA Brief-Nr.', '36_briefseite' => 'KFSA Seite', '36_incipit' => 'Incipit', '36_textgrundlage' => 'Textgrundlage Sigle', '36_uberstatus' => 'Ãœberlieferungsstatus', '36_gattung' => 'Gattung', '36_korrepsondentds' => 'Korrespondent_DS', '36_korrepsondentfs' => 'Korrespondent_FS', '36_ermitteltvon' => 'Ermittelt von', '36_metadatenintern' => 'Metadaten (intern)', '36_beilagen' => 'Beilage(en)', '36_abszusatz' => 'Verfasser Zusatzinfos', '36_adrzusatz' => 'Empfänger Zusatzinfos', '36_absortzusatz' => 'Verfasser Ort Zusatzinfos', '36_adrortzusatz' => 'Empfänger Ort Zusatzinfos', '36_datumzusatz' => 'Datum Zusatzinfos', '36_' => '', '36_KFSA Hand.hueberleiferung' => 'Ãœberlieferungsträger', '36_KFSA Hand.harchiv' => 'Archiv', '36_KFSA Hand.hsignatur' => 'Signatur', '36_KFSA Hand.hprovenienz' => 'Provenienz', '36_KFSA Hand.harchivlalt' => 'Archiv_alt', '36_KFSA Hand.hsignaturalt' => 'Signatur_alt', '36_KFSA Hand.hblattzahl' => 'Blattzahl', '36_KFSA Hand.hseitenzahl' => 'Seitenzahl', '36_KFSA Hand.hformat' => 'Format', '36_KFSA Hand.hadresse' => 'Adresse', '36_KFSA Hand.hvollstaendig' => 'Vollständigkeit', '36_KFSA Hand.hzusatzinfo' => 'H Zusatzinfos', '36_KFSA Druck.drliteratur' => 'Druck in', '36_KFSA Druck.drsigle' => 'Sigle', '36_KFSA Druck.drbandnrseite' => 'Bd./Nr./S.', '36_KFSA Druck.drfaksimile' => 'Faksimile', '36_KFSA Druck.drvollstaendig' => 'Vollständigkeit', '36_KFSA Druck.dzusatzinfo' => 'D Zusatzinfos', '36_KFSA Doku.dokliteratur' => 'Dokumentiert in', '36_KFSA Doku.doksigle' => 'Sigle', '36_KFSA Doku.dokbandnrseite' => 'Bd./Nr./S.', '36_KFSA Doku.dokfaksimile' => 'Faksimile', '36_KFSA Doku.dokvollstaendig' => 'Vollständigkeit', '36_KFSA Doku.dokzusatzinfo' => 'A Zusatzinfos', '36_Link Druck.url_titel_druck' => 'Titel/Bezeichnung', '36_Link Druck.url_image_druck' => 'Link zu Online-Dokument', '36_Link Hand.url_titel_hand' => 'Titel/Bezeichnung', '36_Link Hand.url_image_hand' => 'Link zu Online-Dokument', '36_preasentation' => 'Nicht in die Präsentation', '36_verlag' => 'Verlag', '36_anhang_tite0' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename0' => 'Image', '36_anhang_tite1' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename1' => 'Image', '36_anhang_tite2' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename2' => 'Image', '36_anhang_tite3' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename3' => 'Image', '36_anhang_tite4' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename4' => 'Image', '36_anhang_tite5' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename5' => 'Image', '36_anhang_tite6' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename6' => 'Image', '36_anhang_tite7' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename7' => 'Image', '36_anhang_tite8' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename8' => 'Image', '36_anhang_tite9' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename9' => 'Image', '36_anhang_titea' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcenamea' => 'Image', '36_anhang_titeb' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcenameb' => 'Image', '36_anhang_titec' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcenamec' => 'Image', '36_anhang_tited' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcenamed' => 'Image', '36_anhang_titee' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcenamee' => 'Image', '36_anhang_titeu' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcenameu' => 'Image', '36_anhang_titev' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcenamev' => 'Image', '36_anhang_titew' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcenamew' => 'Image', '36_anhang_titex' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcenamex' => 'Image', '36_anhang_titey' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcenamey' => 'Image', '36_anhang_titez' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcenamez' => 'Image', '36_anhang_tite10' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename10' => 'Image', '36_anhang_tite11' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename11' => 'Image', '36_anhang_tite12' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename12' => 'Image', '36_anhang_tite13' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename13' => 'Image', '36_anhang_tite14' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename14' => 'Image', '36_anhang_tite15' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename15' => 'Image', '36_anhang_tite16' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename16' => 'Image', '36_anhang_tite17' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename17' => 'Image', '36_anhang_tite18' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename18' => 'Image', '36_h_preasentation' => 'Nicht in die Präsentation', '36_anhang_titef' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcenamef' => 'Image', '36_anhang_titeg' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcenameg' => 'Image', '36_anhang_titeh' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcenameh' => 'Image', '36_anhang_titei' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcenamei' => 'Image', '36_anhang_titej' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcenamej' => 'Image', '36_anhang_titek' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcenamek' => 'Image', '36_anhang_titel' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcenamel' => 'Image', '36_anhang_titem' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcenamem' => 'Image', '36_anhang_titen' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcenamen' => 'Image', '36_anhang_titeo' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcenameo' => 'Image', '36_anhang_titep' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcenamep' => 'Image', '36_anhang_titeq' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcenameq' => 'Image', '36_anhang_titer' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcenamer' => 'Image', '36_anhang_tites' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcenames' => 'Image', '36_anhang_titet' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcenamet' => 'Image', '36_anhang_tite19' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename19' => 'Image', '36_anhang_tite20' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename20' => 'Image', '36_anhang_tite21' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename21' => 'Image', '36_anhang_tite22' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename22' => 'Image', '36_anhang_tite23' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename23' => 'Image', '36_anhang_tite24' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename24' => 'Image', '36_anhang_tite25' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename25' => 'Image', '36_anhang_tite26' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename26' => 'Image', '36_anhang_tite27' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename27' => 'Image', '36_anhang_tite28' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename28' => 'Image', '36_anhang_tite29' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename29' => 'Image', '36_anhang_tite30' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename30' => 'Image', '36_anhang_tite31' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename32' => 'Image', '36_anhang_tite33' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename33' => 'Image', '36_anhang_tite34' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename34' => 'Image', '36_Relationen.relation_art' => 'Art', '36_Relationen.relation_link' => 'Interner Link', '36_volltext' => 'Brieftext (Digitalisat Leitdruck oder Transkript Handschrift)', '36_History.hisbearbeiter' => 'Bearbeiter', '36_History.hisschritt' => 'Bearbeitungsschritt', '36_History.hisdatum' => 'Datum', '36_History.hisnotiz' => 'Notiz', '36_personen' => 'Personen', '36_werke' => 'Werke', '36_orte' => 'Orte', '36_themen' => 'Themen', '36_briedfehlt' => 'Fehlt', '36_briefbestellt' => 'Bestellt', '36_intrans' => 'Transkription', '36_intranskorr1' => 'Transkription Korrektur 1', '36_intranskorr2' => 'Transkription Korrektur 2', '36_intranscheck' => 'Transkription Korr. geprüft', '36_intranseintr' => 'Transkription Korr. eingetr', '36_inannotcheck' => 'Auszeichnungen Reg. geprüft', '36_inkollation' => 'Auszeichnungen Kollationierung', '36_inkollcheck' => 'Auszeichnungen Koll. geprüft', '36_himageupload' => 'H/h Digis hochgeladen', '36_dimageupload' => 'D Digis hochgeladen', '36_stand' => 'Bearbeitungsstand (Webseite)', '36_stand_d' => 'Bearbeitungsstand (Druck)', '36_timecreate' => 'Erstellt am', '36_timelastchg' => 'Zuletzt gespeichert am', '36_comment' => 'Kommentar(intern)', '36_accessid' => 'Access ID', '36_accessidalt' => 'Access ID-alt', '36_digifotos' => 'Digitalisat Fotos', '36_imagelink' => 'Imagelink', '36_vermekrbehler' => 'Notizen Behler', '36_vermekrotto' => 'Anmerkungen Otto', '36_vermekraccess' => 'Bearb-Vermerke Access', '36_zeugenbeschreib' => 'Zeugenbeschreibung', '36_sprache' => 'Sprache', '36_accessinfo1' => 'Archiv H (+ Signatur)', '36_korrekturbd36' => 'Korrekturen Bd. 36', '36_druckbd36' => 'Druckrelevant Bd. 36', '36_digitalisath1' => 'Digitalisat_H', '36_digitalisath2' => 'Digitalisat_h', '36_titelhs' => 'Titel_Hs', '36_accessinfo2' => 'Archiv H (+ Signatur)', '36_accessinfo3' => 'Sigle (Dokumentiert in + Bd./Nr./S.)', '36_accessinfo4' => 'Sigle (Druck in + Bd./Nr./S.)', '36_KFSA Hand.hschreibstoff' => 'Schreibstoff', '36_Relationen.relation_anmerkung' => null, '36_anhang_tite35' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename35' => 'Image', '36_anhang_tite36' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename36' => 'Image', '36_anhang_tite37' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename37' => 'Image', '36_anhang_tite38' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename38' => 'Image', '36_anhang_tite39' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename39' => 'Image', '36_anhang_tite40' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename40' => 'Image', '36_anhang_tite41' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename41' => 'Image', '36_anhang_tite42' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename42' => 'Image', '36_anhang_tite43' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename43' => 'Image', '36_anhang_tite44' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename44' => 'Image', '36_anhang_tite45' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename45' => 'Image', '36_anhang_tite46' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename46' => 'Image', '36_anhang_tite47' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename47' => 'Image', '36_anhang_tite48' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename48' => 'Image', '36_anhang_tite49' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename49' => 'Image', '36_anhang_tite50' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename50' => 'Image', '36_anhang_tite51' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename51' => 'Image', '36_anhang_tite52' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename52' => 'Image', '36_anhang_tite53' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename53' => 'Image', '36_anhang_tite54' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename54' => 'Image', '36_KFSA Hand.hbeschreibung' => 'Beschreibung', '36_KFSA Kritanhang.krit_infotyp' => 'Infotyp', '36_KFSA Kritanhang.krit_infotext' => 'Infotext', '36_datumspezif' => 'Datum Spezifikation', 'index_orte_10' => 'Orte', 'index_orte_10.content' => 'Orte', 'index_orte_10.comment' => 'Orte (Kommentar)', 'index_personen_11' => 'Personen', 'index_personen_11.content' => 'Personen', 'index_personen_11.comment' => 'Personen (Kommentar)', 'index_werke_12' => 'Werke', 'index_werke_12.content' => 'Werke', 'index_werke_12.comment' => 'Werke (Kommentar)', 'index_periodika_13' => 'Periodika', 'index_periodika_13.content' => 'Periodika', 'index_periodika_13.comment' => 'Periodika (Kommentar)', 'index_sachen_14' => 'Sachen', 'index_sachen_14.content' => 'Sachen', 'index_sachen_14.comment' => 'Sachen (Kommentar)', 'index_koerperschaften_15' => 'Koerperschaften', 'index_koerperschaften_15.content' => 'Koerperschaften', 'index_koerperschaften_15.comment' => 'Koerperschaften (Kommentar)', 'index_zitate_16' => 'Zitate', 'index_zitate_16.content' => 'Zitate', 'index_zitate_16.comment' => 'Zitate (Kommentar)', 'index_korrespondenzpartner_17' => 'Korrespondenzpartner', 'index_korrespondenzpartner_17.content' => 'Korrespondenzpartner', 'index_korrespondenzpartner_17.comment' => 'Korrespondenzpartner (Kommentar)', 'index_archive_18' => 'Archive', 'index_archive_18.content' => 'Archive', 'index_archive_18.comment' => 'Archive (Kommentar)', 'index_literatur_19' => 'Literatur', 'index_literatur_19.content' => 'Literatur', 'index_literatur_19.comment' => 'Literatur (Kommentar)', 'index_kunstwerke_kfsa_20' => 'Kunstwerke KFSA', 'index_kunstwerke_kfsa_20.content' => 'Kunstwerke KFSA', 'index_kunstwerke_kfsa_20.comment' => 'Kunstwerke KFSA (Kommentar)', 'index_druckwerke_kfsa_21' => 'Druckwerke KFSA', 'index_druckwerke_kfsa_21.content' => 'Druckwerke KFSA', 'index_druckwerke_kfsa_21.comment' => 'Druckwerke KFSA (Kommentar)', '36_fulltext' => 'XML Volltext', '36_html' => 'HTML Volltext', '36_publicHTML' => 'HTML Volltext', '36_plaintext' => 'Volltext', 'transcript.text' => 'Transkripte', 'folders' => 'Mappen', 'notes' => 'Notizen', 'notes.title' => 'Notizen (Titel)', 'notes.content' => 'Notizen', 'notes.category' => 'Notizen (Kategorie)', 'key' => 'FuD Schlüssel' ) $value = '„Bonn den 23sten Junius 1829.<br>Ew. Excellenz bitte ich um Erlaubniß, auf Ihr gestern empfangenes gehaltreiches Schreiben vorläufig nur einiges erwiedern zu [...]“' $key = 'Incipit' $adrModalInfo = array( 'ID' => '2949', 'project' => '1', 'timecreate' => '2013-10-17 13:02:22', 'timelastchg' => '2018-01-11 15:52:48', 'key' => 'AWS-ap-00av', 'docTyp' => array( 'name' => 'Person', 'id' => '39' ), '39_name' => 'Humboldt, Wilhelm von', '39_geschlecht' => 'm', '39_gebdatum' => '1767-06-22', '39_toddatum' => '1835-04-08', '39_pdb' => 'GND', '39_dbid' => '118554727', '39_quellen' => 'NDB@https://www.deutsche-biographie.de/gnd118554727.html#ndbcontent@ ADB@https://www.deutsche-biographie.de/gnd118554727.html#adbcontent@ WBIS@http://db.saur.de/WBIS/basicSearch.jsf@J023-835-2@ Wikipedia@https://de.wikipedia.org/wiki/Wilhelm_von_Humboldt@', '39_geburtsort' => array( 'ID' => '2275', 'content' => 'Potsdam', 'bemerkung' => 'GND:4046948-7', 'LmAdd' => array() ), '39_sterbeort' => array( 'ID' => '10056', 'content' => 'Tegel', 'bemerkung' => 'GND:5007835-5', 'LmAdd' => array() ), '39_lebenwirken' => 'Politiker, Sprachforscher, Publizist, Philosoph Wilhelm von Humboldt wuchs auf Schloss Tegel auf, dem Familienbesitz der Humboldts. Ab 1787 studierte Wilhelm zusammen mit seinem Bruder Alexander an der Universität in Frankfurt (Oder) Rechtswissenschaften. Ein Jahr später wechselte er an die Universität Göttingen, wo er den gleichfalls dort studierenden AWS kennenlernte. 1789 führte ihn eine Reise in das revolutionäre Paris. Anfang 1790 trat er nach Beendigung des Studiums in den Staatsdienst und erhielt eine Anstellung im Justizdepartement. 1791 heiratete er Caroline von Dacheröden, die Tochter eines preußischen Kammergerichtsrates. Im selben Jahr schied er aus dem Staatsdienst aus, um auf den Gütern der Familie von Dacheröden seine Studien der altgriechischen Sprache, Kultur, Kunst und Philosophie fortzusetzen. 1794 zog er nach Jena. Humboldt fungierte als konstruktiver Kritiker und gelehrter Ratgeber für die Protagonisten der Weimarer Klassik. Ab November 1797 lebte er in Paris, um seine Studien fortzuführen. Ausgiebige Reisen nach Spanien dienten auch der Erforschung der baskischen Kultur und Sprache. Von 1802 bis 1808 agierte Humboldt als preußischer Gesandter beim Heiligen Stuhl in Rom. Mit der Aufgabe der konsularischen Vertretung war Humboldt zeitlich nicht überfordert, so dass er genug Gelegenheit hatte, seine Studien weiter zu betreiben und sein Domizil zu einem gesellschaftlichen Mittelpunkt zu machen. 1809 wurde er Sektionschef für Kultus und Unterricht im Ministerium des Innern in Berlin. Humboldt galt als liberaler Bildungsreformer. Zu seinen Leistungen gehören ein neu gegliedertes Bildungssystem, das allen Schichten die Möglichkeit des Zugangs zu Bildung zusichern sollte, und die Vereinheitlichung der Abschlussprüfungen. Als weiterer Meilenstein kann Humboldts Beteiligung bei der Gründung der Universität Berlin gelten; zahlreiche renommierte Wissenschaftler konnten für die Lehrstühle gewonnen werden. Die Eröffnung der Universität im Oktober 1810 fand allerdings ohne Humboldt statt. Nach Auseinandersetzungen verließ er den Bildungssektor und ging als preußischer Gesandter nach Wien, später nach London. In dieser Funktion war er am Wiener Kongress beteiligt. 1819 schied er aus dem Staatsdienst aus und beschäftigte sich weiter mit sprachwissenschaftlichen Forschungen, darunter auch dem Sanskrit und dem Kâwi, der Sprache der indonesischen Insel Java. Wilhelms Bruder Alexander von Humboldt war ein bedeutender Naturforscher, die Brüder Humboldt gelten als die „preußischen Dioskuren“.', '39_namevar' => 'Humboldt, Friedrich Wilhelm Christian Karl Ferdinand von Humboldt, Carl W. von Humboldt, Wilhelm F. von Humboldt, Guillaume de Humboldt, Karl W. von Humboldt, Carl Wilhelm von Humboldt, G. de', '39_beziehung' => 'AWS kannte Wilhelm von Humboldt schon aus Göttinger Studentenzeiten, in Jena begegneten sie sich wieder. Schlegel war 1805 Gast Humboldts in Rom, zur Zeit von dessen preußischer Gesandtschaft. Humboldt und AWS korrespondierten auch über ihre sprachwissenschaftlichen Studien, von großer Kenntnis Humboldts zeugen die ausführlichen brieflichen Diskussionen über das Sanskrit. Humboldt steuerte Aufsätze zu Schlegels „Indischer Bibliothek“ bei. Beide Gelehrte begegneten sich mit großem Respekt, auch wenn sie nicht in allen fachlichen Überzeugungen übereinstimmten.', '39_status_person' => 'Vollständig', '39_sourcename0' => 'AWS-ap-00av-0.jpg', 'folders' => array( (int) 0 => 'Personen', (int) 1 => 'Personen' ), '_label' => '', '_descr' => '', '_model' => 'Person', '_model_title' => 'Person', '_model_titles' => 'People', '_url' => '' ) $version = 'version-01-20' $domain = 'https://august-wilhelm-schlegel.de' $url = 'https://august-wilhelm-schlegel.de/version-01-20' $purl_web = 'https://august-wilhelm-schlegel.de/version-01-20/letters/view/3168' $state = '15.01.2020' $citation = 'Digitale Edition der Korrespondenz August Wilhelm Schlegels [15.01.2020]; August Wilhelm von Schlegel an Wilhelm von Humboldt; 23.06.1829' $lettermsg1 = 'August Wilhelm Schlegel: Digitale Edition der Korrespondenz [Version-01-20]' $lettermsg2 = ' <a href="https://august-wilhelm-schlegel.de/version-01-20/letters/view/3168">https://august-wilhelm-schlegel.de/version-01-20/letters/view/3168</a>.' $changeLeit = array( (int) 0 => 'Briefwechsel zwischen Wilhelm von Humboldt und August Wilhelm Schlegel. Hg. v. Albert Leitzmann. Halle 1908' ) $sprache = 'Deutsch' $caption = array( 'exists' => '1', 'content' => 'Digitalisat Druck' ) $tab = 'druck' $n = (int) 1
include - APP/View/Letters/view.ctp, line 329 View::_evaluate() - APP/Lib/cakephp/lib/Cake/View/View.php, line 971 View::_render() - APP/Lib/cakephp/lib/Cake/View/View.php, line 933 View::render() - APP/Lib/cakephp/lib/Cake/View/View.php, line 473 Controller::render() - APP/Lib/cakephp/lib/Cake/Controller/Controller.php, line 968 Dispatcher::_invoke() - APP/Lib/cakephp/lib/Cake/Routing/Dispatcher.php, line 200 Dispatcher::dispatch() - APP/Lib/cakephp/lib/Cake/Routing/Dispatcher.php, line 167 [main] - APP/webroot/index.php, line 109
Bonn den 23sten Junius 1829.
Ew. Excellenz bitte ich um Erlaubniß, auf Ihr gestern empfangenes gehaltreiches Schreiben vorläufig nur einiges erwiedern zu dürfen. Ich habe eben eine sehr dringende Arbeit vor, worüber die Beantwortung, wenn sie ausführlich seyn sollte, gar zu lange verschoben bleiben könnte.
Ich werde gewiß nicht unterlassen, die Gründe für die neue Schreibung von neuem sorgfältig zu erwägen. Wäre ich aber noch so sehr von deren Statthaftigkeit und Zweckmäßigkeit überzeugt, so stände es nicht mehr in meiner Gewalt, sie in Ausübung zu bringen. Mein Hitôpadêsa ist gedruckt; vom Râmâyana ist der erste Band gedruckt, und wenn ich nun in dem zweiten die Methode plötzlich wechselte, so könnten die Leser mit Recht klagen, während das Töpferrad herumläuft, sey aus der amphora ein urceus geworden. Ferner möchte ich auch dem Râmâyana gern Eingang verschaffen. Es ist vorauszusehen, daß die Gelehrten in London, Paris und Calcutta sich gegen die Neuerung erklären werden. Ich bedarf aber einiges Absatzes, nicht um Gewinn zu haben, sondern nur um einen Theil der Kosten zu decken. Wenn dieß nicht erfolgt, so könnten leicht meine geringen Mittel erschöpft seyn, ehe ich das Werk zu Ende gebracht hätte. Die Subscription ist noch sehr kümmerlich, und jeder Band des Râmâyana kostet mir wenigstens 1000 Thaler. Alles zusammengenommen, Anschaffung kostbarer Bücher und Kunstsachen, Reisen, Unterstützung und Entschädigung meines Mitarbeiters, habe ich, mäßig angeschlagen, auf die Sanskrit-Studien schon über 5000 Thaler verwendet.
Da die festere Gränzbestimmung der Worttrennung Ew. Excellenz Beifall nicht gewonnen hat, so thut es mir nun wirklich leid, daß ich nicht alles ohne Zwischenräume gedruckt habe. Bei dem schließenden n habe ich Herrn Lassens Meynung nachgegeben. Solche unmerkliche Schritte ließen sich wohl wieder zurück thun.
Darüber, daß wir die Sylbentheilung nicht beobachten, können wir uns, glaube ich, beruhigen. In den alten Inschriften ist sie stark bezeichnet, in den Devanagari Manuscripten meistens weit weniger, und in den Bengalischen fließt alles in einander.
Ew. Excellenz glauben bei mir eine feindselige Gesinnung gegen Herrn Bopp wahrzunehmen. Folgendes sind die Thatsachen.
Ich habe ihn in sehr früher Zeit dem jetzt regierenden Könige von Baiern zur Unterstützung in England angelegentlich empfohlen, und mit Ihrem Herrn Bruder gemeinschaftlich etwas für ihn ausgewirkt; ich habe ihn in den Heidelberger Jahrbüchern dem Deutschen Publicum angekündigt, da noch niemand von ihm wußte; ich habe seinen Nalus mit Wärme aufgenommen, mit Nachdruck gelobt, und die Mängel nur leise berührt; ich habe seine Geschmacklosigkeit, seine holperichten Deutschen Verse, seine schülerhafte Latinität mit dem Mantel der Liebe bedeckt; ich habe ihm die Emendationen zum Nalus mitgetheilt, und ihm sogar die Handschrift anvertraut; ich habe ihn in der Vorrede zum Râmâyana ehrenvoll erwähnt, und ihm das Werk selbst zeitig, ehe es in den Buchhandel kam, zugeschickt. Ich habe also vom Anfange an bis auf den heutigen Tag das zuvorkommendste Betragen gegen ihn beobachtet.
Dafür habe ich nun sehr schlechten Dank erlebt. Schon vor einer Anzahl Jahren hat er mir einen übeln Streich gespielt, den ich ihm, wie aus obigem genugsam erhellet, nicht nachgetragen.
Eine vertrauliche Mittheilung von Einwürfen, wenn sie auch ganz ungegründet wären, ist immer ein freundschaftliches Verfahren. Denn wäre die Absicht feindlich, so würde man mit dem Angriffe gleich öffentlich hervortreten, damit er den Gegner unvorbereitet träfe.
Herr Bopp ist aber über die Nachweisung einiger Versehen in eine solche Entrüstung gerathen, er hat mir einen so ungehörigen Brief geschrieben, daß mir nichts übrig blieb, als die Fortsetzung des Briefwechsels höflich abzulehnen.
Jetzt da ich den vom Ministerium bewilligten Guß der kleinen Devanagari-Lettern verlange, bezeigt er sich äußerst ungefällig und legt mir Zögerungen und Hindernisse in den Weg.
Mein zweites Distichon besagt nichts weiter, als daß Herr Bopp einen ungültigen Sprachgebrauch zuweilen durch falsche Lesearten zu erweisen sucht. Davon liegen die Beispiele vor mir. Z. B. Arjuna p p. 77. Übrigens sind wohl keine Epigramme unschuldiger als die in einer fremden Sprache, welche kaum ein Dutzend Menschen in Deutschland verstehen; vollends wenn sie nur vertraulich mitgetheilt werden.
Herr Bopp hat allerdings grammatischen Sinn: wenn er nur die Indischen Grammatiker fleißiger studirt hätte, wenn er nicht immer Originalität anbringen wollte, wo sie nicht hingehört, so hätte er etwas recht gutes leisten mögen. Kritischer Sinn für die Unterscheidung des Ächten und Unächten oder Verfälschten mangelt ihm gänzlich. Deswegen macht er auch keinen Unterschied zwischen beglaubigten und unbeglaubigten Texten. In der Auslegungskunst ist er schwach. Z. B. in der Anmerkung über ētāwat (Arjun. p. 109, 110.) thut er fast unglaubliche Fehlgriffe. Er will mit Unrecht Wilkins zurechtweisen, und entstellt ganz was dieser gesagt hatte. – Es wäre leicht, die Beispiele zu häufen.
Wenn mir wegen freimüthiger öffentlicher Äußerungen über das, was mir, in einem wissenschaftlichen Gebiet, irrig und verkehrt scheint, Eifersucht angeschuldigt wird, so muß ich es mir gefallen lassen. Mir ist schon manchmal schlimmeres begegnet. In diesem Falle wäre aber doch die Hypothese sehr unwahrscheinlich, theils wegen des oben angeführten, theils weil ich zur Ausführung meiner bösen Absichten fünf Jahre versäumt hätte. Ich hatte in der That wichtigeres zu thun.
Ich hoffe, Ew. Excellenz werden den unerfreulichen Inhalt dieses Briefes meinem lebhaften Wunsche, mich vor Ihnen zu rechtfertigen, zu gute halten. Es wäre freilich angenehmer, einem so überschauenden und tief eindringenden Geiste gegenüber sich mit würdigeren Gegenständen der Betrachtung zu beschäftigen.
Vielerlei Störungen lassen mich in meinen Arbeiten nicht so vorwärts kommen, wie ich wohl wünschte. Im Sommer strömen mir die Reisenden von allen Weltgegenden zu, und es wäre doch unfreundlich, sie an der Thür abzuweisen. Seit vier Jahren führe ich den Vorsitz in einem Verein für die Vergrößerung und Verschönerung der Stadt. Nun bin ich auch Mitglied des Municipal-Rathes geworden. Ich wollte es nicht ablehnen, in der Hoffnung, zuweilen etwas auch für die Universität ersprießliches zu fördern.
In den öffentlichen Blättern habe ich mich bisher vergeblich nach guten Nachrichten von Ihrem Herrn Bruder umgesehen. Ich schließe mit den herzlichsten Wünschen für die Fortdauer Ihrer Gesundheit, und bitte Ew. Excellenz den Ausdruck meiner unveränderlichen Gesinnungen zu genehmigen.
Gehorsamst
AWvSchlegel.
Die Zeilen am Schlusse Ihres Briefes las ich mit inniger Rührung. Jedoch dünkt mich, bei dem Verluste des theuersten Gegenstandes liegt etwas tröstliches und linderndes in der Erinnerung der vollkommenen Harmonie, worin man gelebt hat. Wenn aber auf innige Gemeinschaft eine Trennung der Geister und Gemüther folgt, eine Spaltung, welche bis zum empörtesten Unwillen steigt, über die öffentliche Rolle, die der Andere spielt, über die Grundsätze, die er lehrt, über seine verwerflichen wiewohl ohnmächtigen Bestrebungen, Aberglauben und Geistesknechtschaft zu fördern; wenn in dieser Lage dann die letzte Trennung durch den Tod erfolgt: dann ist die Trauer zugleich unendlich schmerzlich und peinlich. Dieß war mein Fall mit meinem Bruder Friedrich. Verloren hatte ich ihn längst, und diese Wunde hat seit Jahren geblutet. So hat jeder seine eignen Leiden.
Ew. Excellenz bitte ich um Erlaubniß, auf Ihr gestern empfangenes gehaltreiches Schreiben vorläufig nur einiges erwiedern zu dürfen. Ich habe eben eine sehr dringende Arbeit vor, worüber die Beantwortung, wenn sie ausführlich seyn sollte, gar zu lange verschoben bleiben könnte.
Ich werde gewiß nicht unterlassen, die Gründe für die neue Schreibung von neuem sorgfältig zu erwägen. Wäre ich aber noch so sehr von deren Statthaftigkeit und Zweckmäßigkeit überzeugt, so stände es nicht mehr in meiner Gewalt, sie in Ausübung zu bringen. Mein Hitôpadêsa ist gedruckt; vom Râmâyana ist der erste Band gedruckt, und wenn ich nun in dem zweiten die Methode plötzlich wechselte, so könnten die Leser mit Recht klagen, während das Töpferrad herumläuft, sey aus der amphora ein urceus geworden. Ferner möchte ich auch dem Râmâyana gern Eingang verschaffen. Es ist vorauszusehen, daß die Gelehrten in London, Paris und Calcutta sich gegen die Neuerung erklären werden. Ich bedarf aber einiges Absatzes, nicht um Gewinn zu haben, sondern nur um einen Theil der Kosten zu decken. Wenn dieß nicht erfolgt, so könnten leicht meine geringen Mittel erschöpft seyn, ehe ich das Werk zu Ende gebracht hätte. Die Subscription ist noch sehr kümmerlich, und jeder Band des Râmâyana kostet mir wenigstens 1000 Thaler. Alles zusammengenommen, Anschaffung kostbarer Bücher und Kunstsachen, Reisen, Unterstützung und Entschädigung meines Mitarbeiters, habe ich, mäßig angeschlagen, auf die Sanskrit-Studien schon über 5000 Thaler verwendet.
Da die festere Gränzbestimmung der Worttrennung Ew. Excellenz Beifall nicht gewonnen hat, so thut es mir nun wirklich leid, daß ich nicht alles ohne Zwischenräume gedruckt habe. Bei dem schließenden n habe ich Herrn Lassens Meynung nachgegeben. Solche unmerkliche Schritte ließen sich wohl wieder zurück thun.
Darüber, daß wir die Sylbentheilung nicht beobachten, können wir uns, glaube ich, beruhigen. In den alten Inschriften ist sie stark bezeichnet, in den Devanagari Manuscripten meistens weit weniger, und in den Bengalischen fließt alles in einander.
Ew. Excellenz glauben bei mir eine feindselige Gesinnung gegen Herrn Bopp wahrzunehmen. Folgendes sind die Thatsachen.
Ich habe ihn in sehr früher Zeit dem jetzt regierenden Könige von Baiern zur Unterstützung in England angelegentlich empfohlen, und mit Ihrem Herrn Bruder gemeinschaftlich etwas für ihn ausgewirkt; ich habe ihn in den Heidelberger Jahrbüchern dem Deutschen Publicum angekündigt, da noch niemand von ihm wußte; ich habe seinen Nalus mit Wärme aufgenommen, mit Nachdruck gelobt, und die Mängel nur leise berührt; ich habe seine Geschmacklosigkeit, seine holperichten Deutschen Verse, seine schülerhafte Latinität mit dem Mantel der Liebe bedeckt; ich habe ihm die Emendationen zum Nalus mitgetheilt, und ihm sogar die Handschrift anvertraut; ich habe ihn in der Vorrede zum Râmâyana ehrenvoll erwähnt, und ihm das Werk selbst zeitig, ehe es in den Buchhandel kam, zugeschickt. Ich habe also vom Anfange an bis auf den heutigen Tag das zuvorkommendste Betragen gegen ihn beobachtet.
Dafür habe ich nun sehr schlechten Dank erlebt. Schon vor einer Anzahl Jahren hat er mir einen übeln Streich gespielt, den ich ihm, wie aus obigem genugsam erhellet, nicht nachgetragen.
Eine vertrauliche Mittheilung von Einwürfen, wenn sie auch ganz ungegründet wären, ist immer ein freundschaftliches Verfahren. Denn wäre die Absicht feindlich, so würde man mit dem Angriffe gleich öffentlich hervortreten, damit er den Gegner unvorbereitet träfe.
Herr Bopp ist aber über die Nachweisung einiger Versehen in eine solche Entrüstung gerathen, er hat mir einen so ungehörigen Brief geschrieben, daß mir nichts übrig blieb, als die Fortsetzung des Briefwechsels höflich abzulehnen.
Jetzt da ich den vom Ministerium bewilligten Guß der kleinen Devanagari-Lettern verlange, bezeigt er sich äußerst ungefällig und legt mir Zögerungen und Hindernisse in den Weg.
Mein zweites Distichon besagt nichts weiter, als daß Herr Bopp einen ungültigen Sprachgebrauch zuweilen durch falsche Lesearten zu erweisen sucht. Davon liegen die Beispiele vor mir. Z. B. Arjuna p p. 77. Übrigens sind wohl keine Epigramme unschuldiger als die in einer fremden Sprache, welche kaum ein Dutzend Menschen in Deutschland verstehen; vollends wenn sie nur vertraulich mitgetheilt werden.
Herr Bopp hat allerdings grammatischen Sinn: wenn er nur die Indischen Grammatiker fleißiger studirt hätte, wenn er nicht immer Originalität anbringen wollte, wo sie nicht hingehört, so hätte er etwas recht gutes leisten mögen. Kritischer Sinn für die Unterscheidung des Ächten und Unächten oder Verfälschten mangelt ihm gänzlich. Deswegen macht er auch keinen Unterschied zwischen beglaubigten und unbeglaubigten Texten. In der Auslegungskunst ist er schwach. Z. B. in der Anmerkung über ētāwat (Arjun. p. 109, 110.) thut er fast unglaubliche Fehlgriffe. Er will mit Unrecht Wilkins zurechtweisen, und entstellt ganz was dieser gesagt hatte. – Es wäre leicht, die Beispiele zu häufen.
Wenn mir wegen freimüthiger öffentlicher Äußerungen über das, was mir, in einem wissenschaftlichen Gebiet, irrig und verkehrt scheint, Eifersucht angeschuldigt wird, so muß ich es mir gefallen lassen. Mir ist schon manchmal schlimmeres begegnet. In diesem Falle wäre aber doch die Hypothese sehr unwahrscheinlich, theils wegen des oben angeführten, theils weil ich zur Ausführung meiner bösen Absichten fünf Jahre versäumt hätte. Ich hatte in der That wichtigeres zu thun.
Ich hoffe, Ew. Excellenz werden den unerfreulichen Inhalt dieses Briefes meinem lebhaften Wunsche, mich vor Ihnen zu rechtfertigen, zu gute halten. Es wäre freilich angenehmer, einem so überschauenden und tief eindringenden Geiste gegenüber sich mit würdigeren Gegenständen der Betrachtung zu beschäftigen.
Vielerlei Störungen lassen mich in meinen Arbeiten nicht so vorwärts kommen, wie ich wohl wünschte. Im Sommer strömen mir die Reisenden von allen Weltgegenden zu, und es wäre doch unfreundlich, sie an der Thür abzuweisen. Seit vier Jahren führe ich den Vorsitz in einem Verein für die Vergrößerung und Verschönerung der Stadt. Nun bin ich auch Mitglied des Municipal-Rathes geworden. Ich wollte es nicht ablehnen, in der Hoffnung, zuweilen etwas auch für die Universität ersprießliches zu fördern.
In den öffentlichen Blättern habe ich mich bisher vergeblich nach guten Nachrichten von Ihrem Herrn Bruder umgesehen. Ich schließe mit den herzlichsten Wünschen für die Fortdauer Ihrer Gesundheit, und bitte Ew. Excellenz den Ausdruck meiner unveränderlichen Gesinnungen zu genehmigen.
Gehorsamst
AWvSchlegel.
Die Zeilen am Schlusse Ihres Briefes las ich mit inniger Rührung. Jedoch dünkt mich, bei dem Verluste des theuersten Gegenstandes liegt etwas tröstliches und linderndes in der Erinnerung der vollkommenen Harmonie, worin man gelebt hat. Wenn aber auf innige Gemeinschaft eine Trennung der Geister und Gemüther folgt, eine Spaltung, welche bis zum empörtesten Unwillen steigt, über die öffentliche Rolle, die der Andere spielt, über die Grundsätze, die er lehrt, über seine verwerflichen wiewohl ohnmächtigen Bestrebungen, Aberglauben und Geistesknechtschaft zu fördern; wenn in dieser Lage dann die letzte Trennung durch den Tod erfolgt: dann ist die Trauer zugleich unendlich schmerzlich und peinlich. Dieß war mein Fall mit meinem Bruder Friedrich. Verloren hatte ich ihn längst, und diese Wunde hat seit Jahren geblutet. So hat jeder seine eignen Leiden.