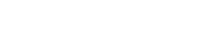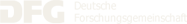Notice (8): Undefined offset: 0 [APP/View/Letters/view.ctp, line 339]
Code Context
/version-04-20/letters/view/12115" data-language=""></ul></div><div id="zoomImage" style="height:695px" class="open-sea-dragon" data-src="<?php echo $this->Html->url($dzi_imagesHand[0]) ?>" data-language="<?=$this->Session->read('Config.language')?>"></div>
$viewFile = '/var/www/awschlegel/version-04-20/app/View/Letters/view.ctp' $dataForView = array( 'html' => '[Freitag] Bern, den 3. Januar 1812.<br>Liebe Albertine!<br>Obgleich ich meinen kleinen Mann, der Dir ein glückliches neues Jahr wünscht, schon als Brief rechnen könnte, antworte ich zunächst auf Dein ganz reizendes Schreiben, weil ich großen Wert darauf lege, daß zwischen uns ein reger Briefwechsel zustandekommt. Du machst richtige und feine Bemerkungen über den Geist Deiner Frau Mutter, und ich teile ganz und gar Deine Eindrücke. Ich glaube, Deine Klagen über die Langeweile, die Dir Deine Umgebung einflößt, werden sofort verstummen, sobald sie erst wiederhergestellt ist. Das wird, wie ich hoffe, bald der Fall sein, besonders wenn Du dafür sorgst, daß sie sich ordentlich pflegt. So unpäßlich, wie sie ist, hat sie natürlich keine Lust, die Unterhaltung zu leiten, denn sie ist ja in Wahrheit nicht nur selber anregend – sie hat auch die Gabe, andere anregend zu machen, wofern diese nur ein wenig Anlage dazu haben.<br>Du weißt doch sicher genau, daß Bern nicht eine Stadt ist, in der man sich fabelhaft amüsiert; trotzdem bot die Stadt in den letzten Tagen des Jahres ganz gegen ihre Gewohnheit ein bewegtes Bild. Es war Weihnachtsmarkt; alle Buden hatten viel Flitterkram für Kinder und für Große ausgelegt; Jeder macht hier nämlich dem anderen zu Neujahr Geschenke: Eltern und Kinder, Frauen und Männer, Brüder und Schwestern, Freunde untereinander u. s. w. ... Das ist wirklich nett und nachahmenswert. Ich glaube, ich würde mir die Geschenke nicht so genau ansehen, auch wenn sie einige Tage zu spät kämen. Am Abend vor dem Neujahrstag liefen einige Masken aus dem Volke durch die Arkaden, genau so wie bei Eurem Karneval. Am 1. Januar war ich auf einem Subskriptionsball, der alle vierzehn Tage stattfindet und zu dem man mich als Fremden eingeladen hatte. Der Saal ist sehr hübsch; er hat Estraden und Logen, die ringsherum laufen, und es wurden Berner Allemanden so kräftig getanzt, daß man meinte, der Fußboden müsse springen. Am gleichen Abend war ich noch bei einem sehr lustigen Essen. Eine Lotterie von allen möglichen Kleinigkeiten wurde veranstaltet und mit pompösen Worten angekündigt. Ich erhielt zwei sogenannte Paradiesvogelfedern. Während der Vorbereitung zur Lotterie gab es ein paar ausgelassene Darbietungen, und Herr Heer, Landammann von Glarus und augenblicklich hier als Abgeordneter, der gewöhnlich sehr schweigsam ist, trug plötzlich eine Schweizer Dialekterzählung vor; dabei machte er Grimassen, die so sehr mit seinem an sich finsteren Gesicht in Gegensatz standen, daß ich eine Viertelstunde lang lachen mußte.<br>Die Kälte ist noch immer außerordentlich stark – die eine Hälfte des Tages verbringe ich damit, mich am Ofen zu wärmen, die andere damit, wieder durchzufrieren, indem ich mich von ihm entferne, wie gerade jetzt. Ich will nun nicht mit dem Satz schließen, den Fr[au] von St[aël] so sehr haßt: ›ich schließe, weil der Postwagen abgeht‹, aber ich muß doch Schluß machen, weil meine Finger vor Kälte ganz starr sind. Ich füge nur noch hinzu, daß ich Albert sehr dankbar für die Lateinstunden bin, die er Dir gibt; er tut auch gut daran, Dir ab und zu einen Klaps zu geben, ob Du es richtig oder falsch machst: die Dinge prägen sich so dem Gedächtnis besser ein.<br>Leb’ wohl, meine liebe und wahrhaft liebenswürdige Albertine. Ich werde oft hier nach Dir gefragt, denn es hat sich in der Gesellschaft ein – zweifellos übertriebenes – Gerücht – wie alle Gerüchte, die von außen kommen – verbreitet, Du seiest ganz reizend.', 'isaprint' => true, 'isnewtranslation' => false, 'statemsg' => 'betamsg15', 'cittitle' => '', 'description' => 'August Wilhelm von Schlegel an Albertine Ida Gustavine de Broglie am 03.01.1812, Bern', 'adressatort' => 'Unknown', 'absendeort' => 'Bern <a class="gndmetadata" target="_blank" href="http://d-nb.info/gnd/2004253-X">GND</a>', 'date' => '03.01.1812', 'adressat' => array( (int) 1460 => array( 'ID' => '1460', 'project' => '1', 'timecreate' => '2013-03-25 11:56:53', 'timelastchg' => '2018-01-07 18:40:17', 'key' => 'AWS-ap-004k', 'docTyp' => array( [maximum depth reached] ), '39_toddatum' => '1838-09-22', '39_name' => 'Broglie, Albertine Ida Gustavine de', '39_gebdatum' => '1797-06-08', '39_pdb' => 'GND', '39_geschlecht' => 'w', '39_dbid' => '173169228 ', '39_geburtsort' => array( [maximum depth reached] ), '39_quellen' => 'WBIS@http://db.saur.de/WBIS/basicSearch.jsf@F28150@ Wikipedia@https://en.wikipedia.org/wiki/Albertine,_baroness_Sta%C3%ABl_von_Holstein@', '39_namevar' => 'Broglie, Albertine Ida Gustavine de Staël-Holstein de', '39_sterbeort' => array( [maximum depth reached] ), '39_beziehung' => 'AWS war als Hauslehrer der Kinder Germaine de Staël-Holsteins ab 1804 in Coppet tätig; er hatte ein gutes Verhältnis zu ihnen. Auch nach dem Tod de Staëls im Jahr 1817 wurde AWS wie ein Mitglied der Familie behandelt, für Albertine und ihren Bruder Auguste war er wie ein Vater. Schlegel und Albertine führten eine umfangreiche Korrespondenz, die von großer Vertrautheit zeugt.', '39_lebenwirken' => 'Schriftstellerin Albertine Ida Gustavine de Broglie war die Tochter von Germaine de Staël-Holstein und Benjamin Constant, einem der Liebhaber de Staëls. Sie folgte ihrer Mutter an verschiedene Wirkungsorte. Albertine heiratete den Herzog von Broglie, Achille-Léon-Victor, im Jahr 1816. Ihr Ehemann war ein engagierter Politiker, der verschiedene Ministerposten innehatte. Sie führte einen Salon in Paris, in welchem sich Politiker, Literaten, Philosophen und Künstler trafen. Sie schrieb religiöse und moralische Schriften und lebte am liebsten, anders als ihre Mutter, zurückgezogen in Coppet. Zahlreiche Essays erschienen postum unter dem Titel „Fragments sur divers sujets de religion et de morale“ (1840).', '39_status_person' => 'Vollständig', '39_sourcename0' => 'AWS-ap-004k-0.jpg', 'folders' => array( [maximum depth reached] ), '_label' => '', '_descr' => '', '_model' => 'Person', '_model_title' => 'Person', '_model_titles' => 'People', '_url' => '' ) ), 'adrCitation' => 'Albertine Ida Gustavine de Broglie', 'absender' => array(), 'absCitation' => 'August Wilhelm von Schlegel', 'percount' => (int) 1, 'notabs' => false, 'tabs' => array( 'text' => array( 'content' => 'Volltext Druck', 'exists' => '1' ), 'druck' => array( 'exists' => '1', 'content' => 'Digitalisat Druck' ), 'related' => array( 'data' => array( [maximum depth reached] ), 'exists' => '1', 'content' => 'Zugehörige Dokumente' ) ), 'parallelview' => array( (int) 0 => '1', (int) 1 => '1', (int) 2 => '1' ), 'dzi_imagesHand' => array(), 'dzi_imagesDruck' => array( (int) 0 => '/cake_fud/files/temp/images/dzi/AWS-aw-05oh-0.tif.jpg.xml', (int) 1 => '/cake_fud/files/temp/images/dzi/AWS-aw-05oh-1.tif.jpg.xml' ), 'indexesintext' => array(), 'right' => '', 'left' => 'text', 'handschrift' => array(), 'druck' => array( 'Bibliographische Angabe' => 'Pange, Pauline de: August Wilhelm Schlegel und Frau von Staël. Eine schicksalhafte Begegnung. Nach unveröffentlichten Briefen erzählt von Pauline Gräfin de Pange. Dt. Ausg. von Willy Grabert. Hamburg 1940, S. 269–270.', 'Incipit' => '„[Freitag] Bern, den 3. Januar 1812.<br>Liebe Albertine!<br>Obgleich ich meinen kleinen Mann, der Dir ein glückliches neues Jahr wünscht, schon als Brief [...]“' ), 'docmain' => array( 'ID' => '12115', 'project' => '1', 'timecreate' => '2018-07-04 19:37:01', 'timelastchg' => '2018-09-20 16:28:39', 'key' => 'AWS-aw-05oh', 'docTyp' => array( 'name' => 'Brief', 'id' => '36' ), '36_html' => '[Freitag] Bern, den 3. Januar 1812.<br>Liebe Albertine!<br>Obgleich ich meinen kleinen Mann, der Dir ein glückliches neues Jahr wünscht, schon als Brief rechnen könnte, antworte ich zunächst auf Dein ganz reizendes Schreiben, weil ich großen Wert darauf lege, daß zwischen uns ein reger Briefwechsel zustandekommt. Du machst richtige und feine Bemerkungen über den Geist Deiner Frau Mutter, und ich teile ganz und gar Deine Eindrücke. Ich glaube, Deine Klagen über die Langeweile, die Dir Deine Umgebung einflößt, werden sofort verstummen, sobald sie erst wiederhergestellt ist. Das wird, wie ich hoffe, bald der Fall sein, besonders wenn Du dafür sorgst, daß sie sich ordentlich pflegt. So unpäßlich, wie sie ist, hat sie natürlich keine Lust, die Unterhaltung zu leiten, denn sie ist ja in Wahrheit nicht nur selber anregend – sie hat auch die Gabe, andere anregend zu machen, wofern diese nur ein wenig Anlage dazu haben.<br>Du weißt doch sicher genau, daß Bern nicht eine Stadt ist, in der man sich fabelhaft amüsiert; trotzdem bot die Stadt in den letzten Tagen des Jahres ganz gegen ihre Gewohnheit ein bewegtes Bild. Es war Weihnachtsmarkt; alle Buden hatten viel Flitterkram für Kinder und für Große ausgelegt; Jeder macht hier nämlich dem anderen zu Neujahr Geschenke: Eltern und Kinder, Frauen und Männer, Brüder und Schwestern, Freunde untereinander u. s. w. ... Das ist wirklich nett und nachahmenswert. Ich glaube, ich würde mir die Geschenke nicht so genau ansehen, auch wenn sie einige Tage zu spät kämen. Am Abend vor dem Neujahrstag liefen einige Masken aus dem Volke durch die Arkaden, genau so wie bei Eurem Karneval. Am 1. Januar war ich auf einem Subskriptionsball, der alle vierzehn Tage stattfindet und zu dem man mich als Fremden eingeladen hatte. Der Saal ist sehr hübsch; er hat Estraden und Logen, die ringsherum laufen, und es wurden Berner Allemanden so kräftig getanzt, daß man meinte, der Fußboden müsse springen. Am gleichen Abend war ich noch bei einem sehr lustigen Essen. Eine Lotterie von allen möglichen Kleinigkeiten wurde veranstaltet und mit pompösen Worten angekündigt. Ich erhielt zwei sogenannte Paradiesvogelfedern. Während der Vorbereitung zur Lotterie gab es ein paar ausgelassene Darbietungen, und Herr Heer, Landammann von Glarus und augenblicklich hier als Abgeordneter, der gewöhnlich sehr schweigsam ist, trug plötzlich eine Schweizer Dialekterzählung vor; dabei machte er Grimassen, die so sehr mit seinem an sich finsteren Gesicht in Gegensatz standen, daß ich eine Viertelstunde lang lachen mußte.<br>Die Kälte ist noch immer außerordentlich stark – die eine Hälfte des Tages verbringe ich damit, mich am Ofen zu wärmen, die andere damit, wieder durchzufrieren, indem ich mich von ihm entferne, wie gerade jetzt. Ich will nun nicht mit dem Satz schließen, den Fr[au] von St[aël] so sehr haßt: ›ich schließe, weil der Postwagen abgeht‹, aber ich muß doch Schluß machen, weil meine Finger vor Kälte ganz starr sind. Ich füge nur noch hinzu, daß ich Albert sehr dankbar für die Lateinstunden bin, die er Dir gibt; er tut auch gut daran, Dir ab und zu einen Klaps zu geben, ob Du es richtig oder falsch machst: die Dinge prägen sich so dem Gedächtnis besser ein.<br>Leb’ wohl, meine liebe und wahrhaft liebenswürdige Albertine. Ich werde oft hier nach Dir gefragt, denn es hat sich in der Gesellschaft ein – zweifellos übertriebenes – Gerücht – wie alle Gerüchte, die von außen kommen – verbreitet, Du seiest ganz reizend.', '36_xml' => '<p>[Freitag] Bern, den 3. Januar 1812.<lb/>Liebe Albertine!<lb/>Obgleich ich meinen kleinen Mann, der Dir ein glückliches neues Jahr wünscht, schon als Brief rechnen könnte, antworte ich zunächst auf Dein ganz reizendes Schreiben, weil ich großen Wert darauf lege, daß zwischen uns ein reger Briefwechsel zustandekommt. Du machst richtige und feine Bemerkungen über den Geist Deiner Frau Mutter, und ich teile ganz und gar Deine Eindrücke. Ich glaube, Deine Klagen über die Langeweile, die Dir Deine Umgebung einflößt, werden sofort verstummen, sobald sie erst wiederhergestellt ist. Das wird, wie ich hoffe, bald der Fall sein, besonders wenn Du dafür sorgst, daß sie sich ordentlich pflegt. So unpäßlich, wie sie ist, hat sie natürlich keine Lust, die Unterhaltung zu leiten, denn sie ist ja in Wahrheit nicht nur selber anregend – sie hat auch die Gabe, andere anregend zu machen, wofern diese nur ein wenig Anlage dazu haben.<lb/>Du weißt doch sicher genau, daß Bern nicht eine Stadt ist, in der man sich fabelhaft amüsiert; trotzdem bot die Stadt in den letzten Tagen des Jahres ganz gegen ihre Gewohnheit ein bewegtes Bild. Es war Weihnachtsmarkt; alle Buden hatten viel Flitterkram für Kinder und für Große ausgelegt; Jeder macht hier nämlich dem anderen zu Neujahr Geschenke: Eltern und Kinder, Frauen und Männer, Brüder und Schwestern, Freunde untereinander u. s. w. ... Das ist wirklich nett und nachahmenswert. Ich glaube, ich würde mir die Geschenke nicht so genau ansehen, auch wenn sie einige Tage zu spät kämen. Am Abend vor dem Neujahrstag liefen einige Masken aus dem Volke durch die Arkaden, genau so wie bei Eurem Karneval. Am 1. Januar war ich auf einem Subskriptionsball, der alle vierzehn Tage stattfindet und zu dem man mich als Fremden eingeladen hatte. Der Saal ist sehr hübsch; er hat Estraden und Logen, die ringsherum laufen, und es wurden Berner Allemanden so kräftig getanzt, daß man meinte, der Fußboden müsse springen. Am gleichen Abend war ich noch bei einem sehr lustigen Essen. Eine Lotterie von allen möglichen Kleinigkeiten wurde veranstaltet und mit pompösen Worten angekündigt. Ich erhielt zwei sogenannte Paradiesvogelfedern. Während der Vorbereitung zur Lotterie gab es ein paar ausgelassene Darbietungen, und Herr Heer, Landammann von Glarus und augenblicklich hier als Abgeordneter, der gewöhnlich sehr schweigsam ist, trug plötzlich eine Schweizer Dialekterzählung vor; dabei machte er Grimassen, die so sehr mit seinem an sich finsteren Gesicht in Gegensatz standen, daß ich eine Viertelstunde lang lachen mußte.<lb/>Die Kälte ist noch immer außerordentlich stark – die eine Hälfte des Tages verbringe ich damit, mich am Ofen zu wärmen, die andere damit, wieder durchzufrieren, indem ich mich von ihm entferne, wie gerade jetzt. Ich will nun nicht mit dem Satz schließen, den Fr[au] von St[aël] so sehr haßt: ›ich schließe, weil der Postwagen abgeht‹, aber ich muß doch Schluß machen, weil meine Finger vor Kälte ganz starr sind. Ich füge nur noch hinzu, daß ich Albert sehr dankbar für die Lateinstunden bin, die er Dir gibt; er tut auch gut daran, Dir ab und zu einen Klaps zu geben, ob Du es richtig oder falsch machst: die Dinge prägen sich so dem Gedächtnis besser ein.<lb/>Leb’ wohl, meine liebe und wahrhaft liebenswürdige Albertine. Ich werde oft hier nach Dir gefragt, denn es hat sich in der Gesellschaft ein – zweifellos übertriebenes – Gerücht – wie alle Gerüchte, die von außen kommen – verbreitet, Du seiest ganz reizend.</p>', '36_xml_standoff' => '[Freitag] Bern, den 3. Januar 1812.<lb/>Liebe Albertine!<lb/>Obgleich ich meinen kleinen Mann, der Dir ein glückliches neues Jahr wünscht, schon als Brief rechnen könnte, antworte ich zunächst auf Dein ganz reizendes Schreiben, weil ich großen Wert darauf lege, daß zwischen uns ein reger Briefwechsel zustandekommt. Du machst richtige und feine Bemerkungen über den Geist Deiner Frau Mutter, und ich teile ganz und gar Deine Eindrücke. Ich glaube, Deine Klagen über die Langeweile, die Dir Deine Umgebung einflößt, werden sofort verstummen, sobald sie erst wiederhergestellt ist. Das wird, wie ich hoffe, bald der Fall sein, besonders wenn Du dafür sorgst, daß sie sich ordentlich pflegt. So unpäßlich, wie sie ist, hat sie natürlich keine Lust, die Unterhaltung zu leiten, denn sie ist ja in Wahrheit nicht nur selber anregend – sie hat auch die Gabe, andere anregend zu machen, wofern diese nur ein wenig Anlage dazu haben.<lb/>Du weißt doch sicher genau, daß Bern nicht eine Stadt ist, in der man sich fabelhaft amüsiert; trotzdem bot die Stadt in den letzten Tagen des Jahres ganz gegen ihre Gewohnheit ein bewegtes Bild. Es war Weihnachtsmarkt; alle Buden hatten viel Flitterkram für Kinder und für Große ausgelegt; Jeder macht hier nämlich dem anderen zu Neujahr Geschenke: Eltern und Kinder, Frauen und Männer, Brüder und Schwestern, Freunde untereinander u. s. w. ... Das ist wirklich nett und nachahmenswert. Ich glaube, ich würde mir die Geschenke nicht so genau ansehen, auch wenn sie einige Tage zu spät kämen. Am Abend vor dem Neujahrstag liefen einige Masken aus dem Volke durch die Arkaden, genau so wie bei Eurem Karneval. Am 1. Januar war ich auf einem Subskriptionsball, der alle vierzehn Tage stattfindet und zu dem man mich als Fremden eingeladen hatte. Der Saal ist sehr hübsch; er hat Estraden und Logen, die ringsherum laufen, und es wurden Berner Allemanden so kräftig getanzt, daß man meinte, der Fußboden müsse springen. Am gleichen Abend war ich noch bei einem sehr lustigen Essen. Eine Lotterie von allen möglichen Kleinigkeiten wurde veranstaltet und mit pompösen Worten angekündigt. Ich erhielt zwei sogenannte Paradiesvogelfedern. Während der Vorbereitung zur Lotterie gab es ein paar ausgelassene Darbietungen, und Herr Heer, Landammann von Glarus und augenblicklich hier als Abgeordneter, der gewöhnlich sehr schweigsam ist, trug plötzlich eine Schweizer Dialekterzählung vor; dabei machte er Grimassen, die so sehr mit seinem an sich finsteren Gesicht in Gegensatz standen, daß ich eine Viertelstunde lang lachen mußte.<lb/>Die Kälte ist noch immer außerordentlich stark – die eine Hälfte des Tages verbringe ich damit, mich am Ofen zu wärmen, die andere damit, wieder durchzufrieren, indem ich mich von ihm entferne, wie gerade jetzt. Ich will nun nicht mit dem Satz schließen, den Fr[au] von St[aël] so sehr haßt: ›ich schließe, weil der Postwagen abgeht‹, aber ich muß doch Schluß machen, weil meine Finger vor Kälte ganz starr sind. Ich füge nur noch hinzu, daß ich Albert sehr dankbar für die Lateinstunden bin, die er Dir gibt; er tut auch gut daran, Dir ab und zu einen Klaps zu geben, ob Du es richtig oder falsch machst: die Dinge prägen sich so dem Gedächtnis besser ein.<lb/>Leb’ wohl, meine liebe und wahrhaft liebenswürdige Albertine. Ich werde oft hier nach Dir gefragt, denn es hat sich in der Gesellschaft ein – zweifellos übertriebenes – Gerücht – wie alle Gerüchte, die von außen kommen – verbreitet, Du seiest ganz reizend.', '36_absender' => array( (int) 0 => array( [maximum depth reached] ) ), '36_adressat' => array( (int) 0 => array( [maximum depth reached] ) ), '36_datumvon' => '1812-01-03', '36_absenderort' => array( (int) 0 => array( [maximum depth reached] ) ), '36_briefid' => 'Pange1940Dt_AWSanAlbertinedeBroglie_03011812', '36_sprache' => array( (int) 0 => 'Deutsch' ), '36_leitd' => 'Pange, Pauline de: August Wilhelm Schlegel und Frau von Staël. Eine schicksalhafte Begegnung. Nach unveröffentlichten Briefen erzählt von Pauline Gräfin de Pange. Dt. Ausg. von Willy Grabert. Hamburg 1940, S. 269–270.', '36_status' => 'Einmal kollationierter Druckvolltext ohne Registerauszeichnung', '36_anmerkungextern' => 'Aus rechtlichen Gründen wird vorerst die deutsche Übersetzung angezeigt.', '36_Relationen' => array( (int) 0 => array( [maximum depth reached] ) ), '36_Datum' => '1812-01-03', '36_facet_absender' => array( (int) 0 => 'August Wilhelm von Schlegel' ), '36_facet_absender_reverse' => array( (int) 0 => 'Schlegel, August Wilhelm von' ), '36_facet_adressat' => array( (int) 0 => 'Albertine Ida Gustavine de Broglie' ), '36_facet_adressat_reverse' => array( (int) 0 => 'Broglie, Albertine Ida Gustavine de' ), '36_facet_absenderort' => array( (int) 0 => 'Bern' ), '36_facet_adressatort' => '', '36_facet_status' => 'Einmal kollationierter Druckvolltext ohne Registerauszeichnung', '36_facet_datengeberhand' => '', '36_facet_sprache' => array( (int) 0 => 'Deutsch' ), '36_facet_korrespondenten' => array( (int) 0 => 'Albertine Ida Gustavine de Broglie' ), '36_Digitalisat_Druck_Server' => array( (int) 0 => 'AWS-aw-05oh-0.tif', (int) 1 => 'AWS-aw-05oh-1.tif' ), '_label' => '', '_descr' => '', '_model' => 'Letter', '_model_title' => 'Letter', '_model_titles' => 'Letters', '_url' => '' ), 'doctype_name' => 'Letters', 'captions' => array( '36_dummy' => '', '36_absender' => 'Absender/Verfasser', '36_absverif1' => 'Verfasser Verifikation', '36_absender2' => 'Verfasser 2', '36_absverif2' => 'Verfasser 2 Verifikation', '36_absbrieftyp2' => 'Verfasser 2 Brieftyp', '36_absender3' => 'Verfasser 3', '36_absverif3' => 'Verfasser 3 Verifikation', '36_absbrieftyp3' => 'Verfasser 3 Brieftyp', '36_adressat' => 'Adressat/Empfänger', '36_adrverif1' => 'Empfänger Verifikation', '36_adressat2' => 'Empfänger 2', '36_adrverif2' => 'Empfänger 2 Verifikation', '36_adressat3' => 'Empfänger 3', '36_adrverif3' => 'Empfänger 3 Verifikation', '36_adressatfalsch' => 'Empfänger_falsch', '36_absenderort' => 'Ort Absender/Verfasser', '36_absortverif1' => 'Ort Verfasser Verifikation', '36_absortungenau' => 'Ort Verfasser ungenau', '36_absenderort2' => 'Ort Verfasser 2', '36_absortverif2' => 'Ort Verfasser 2 Verifikation', '36_absenderort3' => 'Ort Verfasser 3', '36_absortverif3' => 'Ort Verfasser 3 Verifikation', '36_adressatort' => 'Ort Adressat/Empfänger', '36_adrortverif' => 'Ort Empfänger Verifikation', '36_datumvon' => 'Datum von', '36_datumbis' => 'Datum bis', '36_altDat' => 'Datum/Datum manuell', '36_datumverif' => 'Datum Verifikation', '36_sortdatum' => 'Datum zum Sortieren', '36_wochentag' => 'Wochentag nicht erzeugen', '36_sortdatum1' => 'Briefsortierung', '36_fremddatierung' => 'Fremddatierung', '36_typ' => 'Brieftyp', '36_briefid' => 'Brief Identifier', '36_purl_web' => 'PURL web', '36_status' => 'Bearbeitungsstatus', '36_anmerkung' => 'Anmerkung (intern)', '36_anmerkungextern' => 'Anmerkung (extern)', '36_datengeber' => 'Datengeber', '36_purl' => 'OAI-Id', '36_leitd' => 'Druck 1:Bibliographische Angabe', '36_druck2' => 'Druck 2:Bibliographische Angabe', '36_druck3' => 'Druck 3:Bibliographische Angabe', '36_internhand' => 'Zugehörige Handschrift', '36_datengeberhand' => 'Datengeber', '36_purlhand' => 'OAI-Id', '36_purlhand_alt' => 'OAI-Id (alternative)', '36_signaturhand' => 'Signatur', '36_signaturhand_alt' => 'Signatur (alternative)', '36_h1prov' => 'Provenienz', '36_h1zahl' => 'Blatt-/Seitenzahl', '36_h1format' => 'Format', '36_h1besonder' => 'Besonderheiten', '36_hueberlieferung' => 'Ãœberlieferung', '36_infoinhalt' => 'Verschollen/erschlossen: Information über den Inhalt', '36_heditor' => 'Editor/in', '36_hredaktion' => 'Redakteur/in', '36_interndruck' => 'Zugehörige Druck', '36_band' => 'KFSA Band', '36_briefnr' => 'KFSA Brief-Nr.', '36_briefseite' => 'KFSA Seite', '36_incipit' => 'Incipit', '36_textgrundlage' => 'Textgrundlage Sigle', '36_uberstatus' => 'Ãœberlieferungsstatus', '36_gattung' => 'Gattung', '36_korrepsondentds' => 'Korrespondent_DS', '36_korrepsondentfs' => 'Korrespondent_FS', '36_ermitteltvon' => 'Ermittelt von', '36_metadatenintern' => 'Metadaten (intern)', '36_beilagen' => 'Beilage(en)', '36_abszusatz' => 'Verfasser Zusatzinfos', '36_adrzusatz' => 'Empfänger Zusatzinfos', '36_absortzusatz' => 'Verfasser Ort Zusatzinfos', '36_adrortzusatz' => 'Empfänger Ort Zusatzinfos', '36_datumzusatz' => 'Datum Zusatzinfos', '36_' => '', '36_KFSA Hand.hueberleiferung' => 'Ãœberlieferungsträger', '36_KFSA Hand.harchiv' => 'Archiv', '36_KFSA Hand.hsignatur' => 'Signatur', '36_KFSA Hand.hprovenienz' => 'Provenienz', '36_KFSA Hand.harchivlalt' => 'Archiv_alt', '36_KFSA Hand.hsignaturalt' => 'Signatur_alt', '36_KFSA Hand.hblattzahl' => 'Blattzahl', '36_KFSA Hand.hseitenzahl' => 'Seitenzahl', '36_KFSA Hand.hformat' => 'Format', '36_KFSA Hand.hadresse' => 'Adresse', '36_KFSA Hand.hvollstaendig' => 'Vollständigkeit', '36_KFSA Hand.hzusatzinfo' => 'H Zusatzinfos', '36_KFSA Druck.drliteratur' => 'Druck in', '36_KFSA Druck.drsigle' => 'Sigle', '36_KFSA Druck.drbandnrseite' => 'Bd./Nr./S.', '36_KFSA Druck.drfaksimile' => 'Faksimile', '36_KFSA Druck.drvollstaendig' => 'Vollständigkeit', '36_KFSA Druck.dzusatzinfo' => 'D Zusatzinfos', '36_KFSA Doku.dokliteratur' => 'Dokumentiert in', '36_KFSA Doku.doksigle' => 'Sigle', '36_KFSA Doku.dokbandnrseite' => 'Bd./Nr./S.', '36_KFSA Doku.dokfaksimile' => 'Faksimile', '36_KFSA Doku.dokvollstaendig' => 'Vollständigkeit', '36_KFSA Doku.dokzusatzinfo' => 'A Zusatzinfos', '36_Link Druck.url_titel_druck' => 'Titel/Bezeichnung', '36_Link Druck.url_image_druck' => 'Link zu Online-Dokument', '36_Link Hand.url_titel_hand' => 'Titel/Bezeichnung', '36_Link Hand.url_image_hand' => 'Link zu Online-Dokument', '36_preasentation' => 'Nicht in die Präsentation', '36_verlag' => 'Verlag', '36_anhang_tite0' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename0' => 'Image', '36_anhang_tite1' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename1' => 'Image', '36_anhang_tite2' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename2' => 'Image', '36_anhang_tite3' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename3' => 'Image', '36_anhang_tite4' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename4' => 'Image', '36_anhang_tite5' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename5' => 'Image', '36_anhang_tite6' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename6' => 'Image', '36_anhang_tite7' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename7' => 'Image', '36_anhang_tite8' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename8' => 'Image', '36_anhang_tite9' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename9' => 'Image', '36_anhang_titea' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcenamea' => 'Image', '36_anhang_titeb' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcenameb' => 'Image', '36_anhang_titec' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcenamec' => 'Image', '36_anhang_tited' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcenamed' => 'Image', '36_anhang_titee' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcenamee' => 'Image', '36_anhang_titeu' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcenameu' => 'Image', '36_anhang_titev' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcenamev' => 'Image', '36_anhang_titew' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcenamew' => 'Image', '36_anhang_titex' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcenamex' => 'Image', '36_anhang_titey' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcenamey' => 'Image', '36_anhang_titez' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcenamez' => 'Image', '36_anhang_tite10' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename10' => 'Image', '36_anhang_tite11' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename11' => 'Image', '36_anhang_tite12' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename12' => 'Image', '36_anhang_tite13' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename13' => 'Image', '36_anhang_tite14' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename14' => 'Image', '36_anhang_tite15' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename15' => 'Image', '36_anhang_tite16' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename16' => 'Image', '36_anhang_tite17' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename17' => 'Image', '36_anhang_tite18' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename18' => 'Image', '36_h_preasentation' => 'Nicht in die Präsentation', '36_anhang_titef' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcenamef' => 'Image', '36_anhang_titeg' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcenameg' => 'Image', '36_anhang_titeh' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcenameh' => 'Image', '36_anhang_titei' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcenamei' => 'Image', '36_anhang_titej' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcenamej' => 'Image', '36_anhang_titek' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcenamek' => 'Image', '36_anhang_titel' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcenamel' => 'Image', '36_anhang_titem' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcenamem' => 'Image', '36_anhang_titen' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcenamen' => 'Image', '36_anhang_titeo' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcenameo' => 'Image', '36_anhang_titep' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcenamep' => 'Image', '36_anhang_titeq' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcenameq' => 'Image', '36_anhang_titer' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcenamer' => 'Image', '36_anhang_tites' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcenames' => 'Image', '36_anhang_titet' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcenamet' => 'Image', '36_anhang_tite19' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename19' => 'Image', '36_anhang_tite20' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename20' => 'Image', '36_anhang_tite21' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename21' => 'Image', '36_anhang_tite22' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename22' => 'Image', '36_anhang_tite23' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename23' => 'Image', '36_anhang_tite24' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename24' => 'Image', '36_anhang_tite25' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename25' => 'Image', '36_anhang_tite26' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename26' => 'Image', '36_anhang_tite27' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename27' => 'Image', '36_anhang_tite28' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename28' => 'Image', '36_anhang_tite29' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename29' => 'Image', '36_anhang_tite30' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename30' => 'Image', '36_anhang_tite31' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename32' => 'Image', '36_anhang_tite33' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename33' => 'Image', '36_anhang_tite34' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename34' => 'Image', '36_Relationen.relation_art' => 'Art', '36_Relationen.relation_link' => 'Interner Link', '36_volltext' => 'Brieftext (Digitalisat Leitdruck oder Transkript Handschrift)', '36_History.hisbearbeiter' => 'Bearbeiter', '36_History.hisschritt' => 'Bearbeitungsschritt', '36_History.hisdatum' => 'Datum', '36_History.hisnotiz' => 'Notiz', '36_personen' => 'Personen', '36_werke' => 'Werke', '36_orte' => 'Orte', '36_themen' => 'Themen', '36_briedfehlt' => 'Fehlt', '36_briefbestellt' => 'Bestellt', '36_intrans' => 'Transkription', '36_intranskorr1' => 'Transkription Korrektur 1', '36_intranskorr2' => 'Transkription Korrektur 2', '36_intranscheck' => 'Transkription Korr. geprüft', '36_intranseintr' => 'Transkription Korr. eingetr', '36_inannotcheck' => 'Auszeichnungen Reg. geprüft', '36_inkollation' => 'Auszeichnungen Kollationierung', '36_inkollcheck' => 'Auszeichnungen Koll. geprüft', '36_himageupload' => 'H/h Digis hochgeladen', '36_dimageupload' => 'D Digis hochgeladen', '36_stand' => 'Bearbeitungsstand (Webseite)', '36_stand_d' => 'Bearbeitungsstand (Druck)', '36_timecreate' => 'Erstellt am', '36_timelastchg' => 'Zuletzt gespeichert am', '36_comment' => 'Kommentar(intern)', '36_accessid' => 'Access ID', '36_accessidalt' => 'Access ID-alt', '36_digifotos' => 'Digitalisat Fotos', '36_imagelink' => 'Imagelink', '36_vermekrbehler' => 'Notizen Behler', '36_vermekrotto' => 'Anmerkungen Otto', '36_vermekraccess' => 'Bearb-Vermerke Access', '36_zeugenbeschreib' => 'Zeugenbeschreibung', '36_sprache' => 'Sprache', '36_accessinfo1' => 'Archiv H (+ Signatur)', '36_korrekturbd36' => 'Korrekturen Bd. 36', '36_druckbd36' => 'Druckrelevant Bd. 36', '36_digitalisath1' => 'Digitalisat_H', '36_digitalisath2' => 'Digitalisat_h', '36_titelhs' => 'Titel_Hs', '36_accessinfo2' => 'Archiv H (+ Signatur)', '36_accessinfo3' => 'Sigle (Dokumentiert in + Bd./Nr./S.)', '36_accessinfo4' => 'Sigle (Druck in + Bd./Nr./S.)', '36_KFSA Hand.hschreibstoff' => 'Schreibstoff', '36_Relationen.relation_anmerkung' => null, '36_anhang_tite35' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename35' => 'Image', '36_anhang_tite36' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename36' => 'Image', '36_anhang_tite37' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename37' => 'Image', '36_anhang_tite38' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename38' => 'Image', '36_anhang_tite39' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename39' => 'Image', '36_anhang_tite40' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename40' => 'Image', '36_anhang_tite41' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename41' => 'Image', '36_anhang_tite42' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename42' => 'Image', '36_anhang_tite43' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename43' => 'Image', '36_anhang_tite44' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename44' => 'Image', '36_anhang_tite45' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename45' => 'Image', '36_anhang_tite46' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename46' => 'Image', '36_anhang_tite47' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename47' => 'Image', '36_anhang_tite48' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename48' => 'Image', '36_anhang_tite49' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename49' => 'Image', '36_anhang_tite50' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename50' => 'Image', '36_anhang_tite51' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename51' => 'Image', '36_anhang_tite52' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename52' => 'Image', '36_anhang_tite53' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename53' => 'Image', '36_anhang_tite54' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename54' => 'Image', '36_KFSA Hand.hbeschreibung' => 'Beschreibung', '36_KFSA Kritanhang.krit_infotyp' => 'Infotyp', '36_KFSA Kritanhang.krit_infotext' => 'Infotext', '36_datumspezif' => 'Datum Spezifikation', 'index_orte_10' => 'Orte', 'index_orte_10.content' => 'Orte', 'index_orte_10.comment' => 'Orte (Kommentar)', 'index_personen_11' => 'Personen', 'index_personen_11.content' => 'Personen', 'index_personen_11.comment' => 'Personen (Kommentar)', 'index_werke_12' => 'Werke', 'index_werke_12.content' => 'Werke', 'index_werke_12.comment' => 'Werke (Kommentar)', 'index_periodika_13' => 'Periodika', 'index_periodika_13.content' => 'Periodika', 'index_periodika_13.comment' => 'Periodika (Kommentar)', 'index_sachen_14' => 'Sachen', 'index_sachen_14.content' => 'Sachen', 'index_sachen_14.comment' => 'Sachen (Kommentar)', 'index_koerperschaften_15' => 'Koerperschaften', 'index_koerperschaften_15.content' => 'Koerperschaften', 'index_koerperschaften_15.comment' => 'Koerperschaften (Kommentar)', 'index_zitate_16' => 'Zitate', 'index_zitate_16.content' => 'Zitate', 'index_zitate_16.comment' => 'Zitate (Kommentar)', 'index_korrespondenzpartner_17' => 'Korrespondenzpartner', 'index_korrespondenzpartner_17.content' => 'Korrespondenzpartner', 'index_korrespondenzpartner_17.comment' => 'Korrespondenzpartner (Kommentar)', 'index_archive_18' => 'Archive', 'index_archive_18.content' => 'Archive', 'index_archive_18.comment' => 'Archive (Kommentar)', 'index_literatur_19' => 'Literatur', 'index_literatur_19.content' => 'Literatur', 'index_literatur_19.comment' => 'Literatur (Kommentar)', 'index_kunstwerke_kfsa_20' => 'Kunstwerke KFSA', 'index_kunstwerke_kfsa_20.content' => 'Kunstwerke KFSA', 'index_kunstwerke_kfsa_20.comment' => 'Kunstwerke KFSA (Kommentar)', 'index_druckwerke_kfsa_21' => 'Druckwerke KFSA', 'index_druckwerke_kfsa_21.content' => 'Druckwerke KFSA', 'index_druckwerke_kfsa_21.comment' => 'Druckwerke KFSA (Kommentar)', '36_fulltext' => 'XML Volltext', '36_html' => 'HTML Volltext', '36_publicHTML' => 'HTML Volltext', '36_plaintext' => 'Volltext', 'transcript.text' => 'Transkripte', 'folders' => 'Mappen', 'notes' => 'Notizen', 'notes.title' => 'Notizen (Titel)', 'notes.content' => 'Notizen', 'notes.category' => 'Notizen (Kategorie)', 'key' => 'FuD Schlüssel' ) ) $html = '[Freitag] Bern, den 3. Januar 1812.<br>Liebe Albertine!<br>Obgleich ich meinen kleinen Mann, der Dir ein glückliches neues Jahr wünscht, schon als Brief rechnen könnte, antworte ich zunächst auf Dein ganz reizendes Schreiben, weil ich großen Wert darauf lege, daß zwischen uns ein reger Briefwechsel zustandekommt. Du machst richtige und feine Bemerkungen über den Geist Deiner Frau Mutter, und ich teile ganz und gar Deine Eindrücke. Ich glaube, Deine Klagen über die Langeweile, die Dir Deine Umgebung einflößt, werden sofort verstummen, sobald sie erst wiederhergestellt ist. Das wird, wie ich hoffe, bald der Fall sein, besonders wenn Du dafür sorgst, daß sie sich ordentlich pflegt. So unpäßlich, wie sie ist, hat sie natürlich keine Lust, die Unterhaltung zu leiten, denn sie ist ja in Wahrheit nicht nur selber anregend – sie hat auch die Gabe, andere anregend zu machen, wofern diese nur ein wenig Anlage dazu haben.<br>Du weißt doch sicher genau, daß Bern nicht eine Stadt ist, in der man sich fabelhaft amüsiert; trotzdem bot die Stadt in den letzten Tagen des Jahres ganz gegen ihre Gewohnheit ein bewegtes Bild. Es war Weihnachtsmarkt; alle Buden hatten viel Flitterkram für Kinder und für Große ausgelegt; Jeder macht hier nämlich dem anderen zu Neujahr Geschenke: Eltern und Kinder, Frauen und Männer, Brüder und Schwestern, Freunde untereinander u. s. w. ... Das ist wirklich nett und nachahmenswert. Ich glaube, ich würde mir die Geschenke nicht so genau ansehen, auch wenn sie einige Tage zu spät kämen. Am Abend vor dem Neujahrstag liefen einige Masken aus dem Volke durch die Arkaden, genau so wie bei Eurem Karneval. Am 1. Januar war ich auf einem Subskriptionsball, der alle vierzehn Tage stattfindet und zu dem man mich als Fremden eingeladen hatte. Der Saal ist sehr hübsch; er hat Estraden und Logen, die ringsherum laufen, und es wurden Berner Allemanden so kräftig getanzt, daß man meinte, der Fußboden müsse springen. Am gleichen Abend war ich noch bei einem sehr lustigen Essen. Eine Lotterie von allen möglichen Kleinigkeiten wurde veranstaltet und mit pompösen Worten angekündigt. Ich erhielt zwei sogenannte Paradiesvogelfedern. Während der Vorbereitung zur Lotterie gab es ein paar ausgelassene Darbietungen, und Herr Heer, Landammann von Glarus und augenblicklich hier als Abgeordneter, der gewöhnlich sehr schweigsam ist, trug plötzlich eine Schweizer Dialekterzählung vor; dabei machte er Grimassen, die so sehr mit seinem an sich finsteren Gesicht in Gegensatz standen, daß ich eine Viertelstunde lang lachen mußte.<br>Die Kälte ist noch immer außerordentlich stark – die eine Hälfte des Tages verbringe ich damit, mich am Ofen zu wärmen, die andere damit, wieder durchzufrieren, indem ich mich von ihm entferne, wie gerade jetzt. Ich will nun nicht mit dem Satz schließen, den Fr[au] von St[aël] so sehr haßt: ›ich schließe, weil der Postwagen abgeht‹, aber ich muß doch Schluß machen, weil meine Finger vor Kälte ganz starr sind. Ich füge nur noch hinzu, daß ich Albert sehr dankbar für die Lateinstunden bin, die er Dir gibt; er tut auch gut daran, Dir ab und zu einen Klaps zu geben, ob Du es richtig oder falsch machst: die Dinge prägen sich so dem Gedächtnis besser ein.<br>Leb’ wohl, meine liebe und wahrhaft liebenswürdige Albertine. Ich werde oft hier nach Dir gefragt, denn es hat sich in der Gesellschaft ein – zweifellos übertriebenes – Gerücht – wie alle Gerüchte, die von außen kommen – verbreitet, Du seiest ganz reizend.' $isaprint = true $isnewtranslation = false $statemsg = 'betamsg15' $cittitle = '' $description = 'August Wilhelm von Schlegel an Albertine Ida Gustavine de Broglie am 03.01.1812, Bern' $adressatort = 'Unknown' $absendeort = 'Bern <a class="gndmetadata" target="_blank" href="http://d-nb.info/gnd/2004253-X">GND</a>' $date = '03.01.1812' $adressat = array( (int) 1460 => array( 'ID' => '1460', 'project' => '1', 'timecreate' => '2013-03-25 11:56:53', 'timelastchg' => '2018-01-07 18:40:17', 'key' => 'AWS-ap-004k', 'docTyp' => array( 'name' => 'Person', 'id' => '39' ), '39_toddatum' => '1838-09-22', '39_name' => 'Broglie, Albertine Ida Gustavine de', '39_gebdatum' => '1797-06-08', '39_pdb' => 'GND', '39_geschlecht' => 'w', '39_dbid' => '173169228 ', '39_geburtsort' => array( 'ID' => '171', 'content' => 'Paris', 'bemerkung' => 'GND:4044660-8', 'LmAdd' => array([maximum depth reached]) ), '39_quellen' => 'WBIS@http://db.saur.de/WBIS/basicSearch.jsf@F28150@ Wikipedia@https://en.wikipedia.org/wiki/Albertine,_baroness_Sta%C3%ABl_von_Holstein@', '39_namevar' => 'Broglie, Albertine Ida Gustavine de Staël-Holstein de', '39_sterbeort' => array( 'ID' => '6627', 'content' => 'Broglie (Eure)', 'bemerkung' => '', 'LmAdd' => array([maximum depth reached]) ), '39_beziehung' => 'AWS war als Hauslehrer der Kinder Germaine de Staël-Holsteins ab 1804 in Coppet tätig; er hatte ein gutes Verhältnis zu ihnen. Auch nach dem Tod de Staëls im Jahr 1817 wurde AWS wie ein Mitglied der Familie behandelt, für Albertine und ihren Bruder Auguste war er wie ein Vater. Schlegel und Albertine führten eine umfangreiche Korrespondenz, die von großer Vertrautheit zeugt.', '39_lebenwirken' => 'Schriftstellerin Albertine Ida Gustavine de Broglie war die Tochter von Germaine de Staël-Holstein und Benjamin Constant, einem der Liebhaber de Staëls. Sie folgte ihrer Mutter an verschiedene Wirkungsorte. Albertine heiratete den Herzog von Broglie, Achille-Léon-Victor, im Jahr 1816. Ihr Ehemann war ein engagierter Politiker, der verschiedene Ministerposten innehatte. Sie führte einen Salon in Paris, in welchem sich Politiker, Literaten, Philosophen und Künstler trafen. Sie schrieb religiöse und moralische Schriften und lebte am liebsten, anders als ihre Mutter, zurückgezogen in Coppet. Zahlreiche Essays erschienen postum unter dem Titel „Fragments sur divers sujets de religion et de morale“ (1840).', '39_status_person' => 'Vollständig', '39_sourcename0' => 'AWS-ap-004k-0.jpg', 'folders' => array( (int) 0 => 'Personen', (int) 1 => 'Personen' ), '_label' => '', '_descr' => '', '_model' => 'Person', '_model_title' => 'Person', '_model_titles' => 'People', '_url' => '' ) ) $adrCitation = 'Albertine Ida Gustavine de Broglie' $absender = array() $absCitation = 'August Wilhelm von Schlegel' $percount = (int) 2 $notabs = false $tabs = array( 'text' => array( 'content' => 'Volltext Druck', 'exists' => '1' ), 'druck' => array( 'exists' => '1', 'content' => 'Digitalisat Druck' ), 'related' => array( 'data' => array( (int) 3041 => array( [maximum depth reached] ) ), 'exists' => '1', 'content' => 'Zugehörige Dokumente' ) ) $parallelview = array( (int) 0 => '1', (int) 1 => '1', (int) 2 => '1' ) $dzi_imagesHand = array() $dzi_imagesDruck = array( (int) 0 => '/cake_fud/files/temp/images/dzi/AWS-aw-05oh-0.tif.jpg.xml', (int) 1 => '/cake_fud/files/temp/images/dzi/AWS-aw-05oh-1.tif.jpg.xml' ) $indexesintext = array() $right = '' $left = 'text' $handschrift = array() $druck = array( 'Bibliographische Angabe' => 'Pange, Pauline de: August Wilhelm Schlegel und Frau von Staël. Eine schicksalhafte Begegnung. Nach unveröffentlichten Briefen erzählt von Pauline Gräfin de Pange. Dt. Ausg. von Willy Grabert. Hamburg 1940, S. 269–270.', 'Incipit' => '„[Freitag] Bern, den 3. Januar 1812.<br>Liebe Albertine!<br>Obgleich ich meinen kleinen Mann, der Dir ein glückliches neues Jahr wünscht, schon als Brief [...]“' ) $docmain = array( 'ID' => '12115', 'project' => '1', 'timecreate' => '2018-07-04 19:37:01', 'timelastchg' => '2018-09-20 16:28:39', 'key' => 'AWS-aw-05oh', 'docTyp' => array( 'name' => 'Brief', 'id' => '36' ), '36_html' => '[Freitag] Bern, den 3. Januar 1812.<br>Liebe Albertine!<br>Obgleich ich meinen kleinen Mann, der Dir ein glückliches neues Jahr wünscht, schon als Brief rechnen könnte, antworte ich zunächst auf Dein ganz reizendes Schreiben, weil ich großen Wert darauf lege, daß zwischen uns ein reger Briefwechsel zustandekommt. Du machst richtige und feine Bemerkungen über den Geist Deiner Frau Mutter, und ich teile ganz und gar Deine Eindrücke. Ich glaube, Deine Klagen über die Langeweile, die Dir Deine Umgebung einflößt, werden sofort verstummen, sobald sie erst wiederhergestellt ist. Das wird, wie ich hoffe, bald der Fall sein, besonders wenn Du dafür sorgst, daß sie sich ordentlich pflegt. So unpäßlich, wie sie ist, hat sie natürlich keine Lust, die Unterhaltung zu leiten, denn sie ist ja in Wahrheit nicht nur selber anregend – sie hat auch die Gabe, andere anregend zu machen, wofern diese nur ein wenig Anlage dazu haben.<br>Du weißt doch sicher genau, daß Bern nicht eine Stadt ist, in der man sich fabelhaft amüsiert; trotzdem bot die Stadt in den letzten Tagen des Jahres ganz gegen ihre Gewohnheit ein bewegtes Bild. Es war Weihnachtsmarkt; alle Buden hatten viel Flitterkram für Kinder und für Große ausgelegt; Jeder macht hier nämlich dem anderen zu Neujahr Geschenke: Eltern und Kinder, Frauen und Männer, Brüder und Schwestern, Freunde untereinander u. s. w. ... Das ist wirklich nett und nachahmenswert. Ich glaube, ich würde mir die Geschenke nicht so genau ansehen, auch wenn sie einige Tage zu spät kämen. Am Abend vor dem Neujahrstag liefen einige Masken aus dem Volke durch die Arkaden, genau so wie bei Eurem Karneval. Am 1. Januar war ich auf einem Subskriptionsball, der alle vierzehn Tage stattfindet und zu dem man mich als Fremden eingeladen hatte. Der Saal ist sehr hübsch; er hat Estraden und Logen, die ringsherum laufen, und es wurden Berner Allemanden so kräftig getanzt, daß man meinte, der Fußboden müsse springen. Am gleichen Abend war ich noch bei einem sehr lustigen Essen. Eine Lotterie von allen möglichen Kleinigkeiten wurde veranstaltet und mit pompösen Worten angekündigt. Ich erhielt zwei sogenannte Paradiesvogelfedern. Während der Vorbereitung zur Lotterie gab es ein paar ausgelassene Darbietungen, und Herr Heer, Landammann von Glarus und augenblicklich hier als Abgeordneter, der gewöhnlich sehr schweigsam ist, trug plötzlich eine Schweizer Dialekterzählung vor; dabei machte er Grimassen, die so sehr mit seinem an sich finsteren Gesicht in Gegensatz standen, daß ich eine Viertelstunde lang lachen mußte.<br>Die Kälte ist noch immer außerordentlich stark – die eine Hälfte des Tages verbringe ich damit, mich am Ofen zu wärmen, die andere damit, wieder durchzufrieren, indem ich mich von ihm entferne, wie gerade jetzt. Ich will nun nicht mit dem Satz schließen, den Fr[au] von St[aël] so sehr haßt: ›ich schließe, weil der Postwagen abgeht‹, aber ich muß doch Schluß machen, weil meine Finger vor Kälte ganz starr sind. Ich füge nur noch hinzu, daß ich Albert sehr dankbar für die Lateinstunden bin, die er Dir gibt; er tut auch gut daran, Dir ab und zu einen Klaps zu geben, ob Du es richtig oder falsch machst: die Dinge prägen sich so dem Gedächtnis besser ein.<br>Leb’ wohl, meine liebe und wahrhaft liebenswürdige Albertine. Ich werde oft hier nach Dir gefragt, denn es hat sich in der Gesellschaft ein – zweifellos übertriebenes – Gerücht – wie alle Gerüchte, die von außen kommen – verbreitet, Du seiest ganz reizend.', '36_xml' => '<p>[Freitag] Bern, den 3. Januar 1812.<lb/>Liebe Albertine!<lb/>Obgleich ich meinen kleinen Mann, der Dir ein glückliches neues Jahr wünscht, schon als Brief rechnen könnte, antworte ich zunächst auf Dein ganz reizendes Schreiben, weil ich großen Wert darauf lege, daß zwischen uns ein reger Briefwechsel zustandekommt. Du machst richtige und feine Bemerkungen über den Geist Deiner Frau Mutter, und ich teile ganz und gar Deine Eindrücke. Ich glaube, Deine Klagen über die Langeweile, die Dir Deine Umgebung einflößt, werden sofort verstummen, sobald sie erst wiederhergestellt ist. Das wird, wie ich hoffe, bald der Fall sein, besonders wenn Du dafür sorgst, daß sie sich ordentlich pflegt. So unpäßlich, wie sie ist, hat sie natürlich keine Lust, die Unterhaltung zu leiten, denn sie ist ja in Wahrheit nicht nur selber anregend – sie hat auch die Gabe, andere anregend zu machen, wofern diese nur ein wenig Anlage dazu haben.<lb/>Du weißt doch sicher genau, daß Bern nicht eine Stadt ist, in der man sich fabelhaft amüsiert; trotzdem bot die Stadt in den letzten Tagen des Jahres ganz gegen ihre Gewohnheit ein bewegtes Bild. Es war Weihnachtsmarkt; alle Buden hatten viel Flitterkram für Kinder und für Große ausgelegt; Jeder macht hier nämlich dem anderen zu Neujahr Geschenke: Eltern und Kinder, Frauen und Männer, Brüder und Schwestern, Freunde untereinander u. s. w. ... Das ist wirklich nett und nachahmenswert. Ich glaube, ich würde mir die Geschenke nicht so genau ansehen, auch wenn sie einige Tage zu spät kämen. Am Abend vor dem Neujahrstag liefen einige Masken aus dem Volke durch die Arkaden, genau so wie bei Eurem Karneval. Am 1. Januar war ich auf einem Subskriptionsball, der alle vierzehn Tage stattfindet und zu dem man mich als Fremden eingeladen hatte. Der Saal ist sehr hübsch; er hat Estraden und Logen, die ringsherum laufen, und es wurden Berner Allemanden so kräftig getanzt, daß man meinte, der Fußboden müsse springen. Am gleichen Abend war ich noch bei einem sehr lustigen Essen. Eine Lotterie von allen möglichen Kleinigkeiten wurde veranstaltet und mit pompösen Worten angekündigt. Ich erhielt zwei sogenannte Paradiesvogelfedern. Während der Vorbereitung zur Lotterie gab es ein paar ausgelassene Darbietungen, und Herr Heer, Landammann von Glarus und augenblicklich hier als Abgeordneter, der gewöhnlich sehr schweigsam ist, trug plötzlich eine Schweizer Dialekterzählung vor; dabei machte er Grimassen, die so sehr mit seinem an sich finsteren Gesicht in Gegensatz standen, daß ich eine Viertelstunde lang lachen mußte.<lb/>Die Kälte ist noch immer außerordentlich stark – die eine Hälfte des Tages verbringe ich damit, mich am Ofen zu wärmen, die andere damit, wieder durchzufrieren, indem ich mich von ihm entferne, wie gerade jetzt. Ich will nun nicht mit dem Satz schließen, den Fr[au] von St[aël] so sehr haßt: ›ich schließe, weil der Postwagen abgeht‹, aber ich muß doch Schluß machen, weil meine Finger vor Kälte ganz starr sind. Ich füge nur noch hinzu, daß ich Albert sehr dankbar für die Lateinstunden bin, die er Dir gibt; er tut auch gut daran, Dir ab und zu einen Klaps zu geben, ob Du es richtig oder falsch machst: die Dinge prägen sich so dem Gedächtnis besser ein.<lb/>Leb’ wohl, meine liebe und wahrhaft liebenswürdige Albertine. Ich werde oft hier nach Dir gefragt, denn es hat sich in der Gesellschaft ein – zweifellos übertriebenes – Gerücht – wie alle Gerüchte, die von außen kommen – verbreitet, Du seiest ganz reizend.</p>', '36_xml_standoff' => '[Freitag] Bern, den 3. Januar 1812.<lb/>Liebe Albertine!<lb/>Obgleich ich meinen kleinen Mann, der Dir ein glückliches neues Jahr wünscht, schon als Brief rechnen könnte, antworte ich zunächst auf Dein ganz reizendes Schreiben, weil ich großen Wert darauf lege, daß zwischen uns ein reger Briefwechsel zustandekommt. Du machst richtige und feine Bemerkungen über den Geist Deiner Frau Mutter, und ich teile ganz und gar Deine Eindrücke. Ich glaube, Deine Klagen über die Langeweile, die Dir Deine Umgebung einflößt, werden sofort verstummen, sobald sie erst wiederhergestellt ist. Das wird, wie ich hoffe, bald der Fall sein, besonders wenn Du dafür sorgst, daß sie sich ordentlich pflegt. So unpäßlich, wie sie ist, hat sie natürlich keine Lust, die Unterhaltung zu leiten, denn sie ist ja in Wahrheit nicht nur selber anregend – sie hat auch die Gabe, andere anregend zu machen, wofern diese nur ein wenig Anlage dazu haben.<lb/>Du weißt doch sicher genau, daß Bern nicht eine Stadt ist, in der man sich fabelhaft amüsiert; trotzdem bot die Stadt in den letzten Tagen des Jahres ganz gegen ihre Gewohnheit ein bewegtes Bild. Es war Weihnachtsmarkt; alle Buden hatten viel Flitterkram für Kinder und für Große ausgelegt; Jeder macht hier nämlich dem anderen zu Neujahr Geschenke: Eltern und Kinder, Frauen und Männer, Brüder und Schwestern, Freunde untereinander u. s. w. ... Das ist wirklich nett und nachahmenswert. Ich glaube, ich würde mir die Geschenke nicht so genau ansehen, auch wenn sie einige Tage zu spät kämen. Am Abend vor dem Neujahrstag liefen einige Masken aus dem Volke durch die Arkaden, genau so wie bei Eurem Karneval. Am 1. Januar war ich auf einem Subskriptionsball, der alle vierzehn Tage stattfindet und zu dem man mich als Fremden eingeladen hatte. Der Saal ist sehr hübsch; er hat Estraden und Logen, die ringsherum laufen, und es wurden Berner Allemanden so kräftig getanzt, daß man meinte, der Fußboden müsse springen. Am gleichen Abend war ich noch bei einem sehr lustigen Essen. Eine Lotterie von allen möglichen Kleinigkeiten wurde veranstaltet und mit pompösen Worten angekündigt. Ich erhielt zwei sogenannte Paradiesvogelfedern. Während der Vorbereitung zur Lotterie gab es ein paar ausgelassene Darbietungen, und Herr Heer, Landammann von Glarus und augenblicklich hier als Abgeordneter, der gewöhnlich sehr schweigsam ist, trug plötzlich eine Schweizer Dialekterzählung vor; dabei machte er Grimassen, die so sehr mit seinem an sich finsteren Gesicht in Gegensatz standen, daß ich eine Viertelstunde lang lachen mußte.<lb/>Die Kälte ist noch immer außerordentlich stark – die eine Hälfte des Tages verbringe ich damit, mich am Ofen zu wärmen, die andere damit, wieder durchzufrieren, indem ich mich von ihm entferne, wie gerade jetzt. Ich will nun nicht mit dem Satz schließen, den Fr[au] von St[aël] so sehr haßt: ›ich schließe, weil der Postwagen abgeht‹, aber ich muß doch Schluß machen, weil meine Finger vor Kälte ganz starr sind. Ich füge nur noch hinzu, daß ich Albert sehr dankbar für die Lateinstunden bin, die er Dir gibt; er tut auch gut daran, Dir ab und zu einen Klaps zu geben, ob Du es richtig oder falsch machst: die Dinge prägen sich so dem Gedächtnis besser ein.<lb/>Leb’ wohl, meine liebe und wahrhaft liebenswürdige Albertine. Ich werde oft hier nach Dir gefragt, denn es hat sich in der Gesellschaft ein – zweifellos übertriebenes – Gerücht – wie alle Gerüchte, die von außen kommen – verbreitet, Du seiest ganz reizend.', '36_absender' => array( (int) 0 => array( 'ID' => '7125', 'content' => 'August Wilhelm von Schlegel', 'bemerkung' => '', 'altBegriff' => 'Schlegel, August Wilhelm von', 'LmAdd' => array( [maximum depth reached] ) ) ), '36_adressat' => array( (int) 0 => array( 'ID' => '7660', 'content' => 'Albertine Ida Gustavine de Broglie', 'bemerkung' => '', 'altBegriff' => 'Broglie, Albertine Ida Gustavine de', 'LmAdd' => array( [maximum depth reached] ) ) ), '36_datumvon' => '1812-01-03', '36_absenderort' => array( (int) 0 => array( 'ID' => '226', 'content' => 'Bern', 'bemerkung' => 'GND:2004253-X', 'altBegriff' => '', 'LmAdd' => array([maximum depth reached]) ) ), '36_briefid' => 'Pange1940Dt_AWSanAlbertinedeBroglie_03011812', '36_sprache' => array( (int) 0 => 'Deutsch' ), '36_leitd' => 'Pange, Pauline de: August Wilhelm Schlegel und Frau von Staël. Eine schicksalhafte Begegnung. Nach unveröffentlichten Briefen erzählt von Pauline Gräfin de Pange. Dt. Ausg. von Willy Grabert. Hamburg 1940, S. 269–270.', '36_status' => 'Einmal kollationierter Druckvolltext ohne Registerauszeichnung', '36_anmerkungextern' => 'Aus rechtlichen Gründen wird vorerst die deutsche Übersetzung angezeigt.', '36_Relationen' => array( (int) 0 => array( 'relation_art' => 'Original', 'relation_link' => '3041', 'subID' => '270' ) ), '36_Datum' => '1812-01-03', '36_facet_absender' => array( (int) 0 => 'August Wilhelm von Schlegel' ), '36_facet_absender_reverse' => array( (int) 0 => 'Schlegel, August Wilhelm von' ), '36_facet_adressat' => array( (int) 0 => 'Albertine Ida Gustavine de Broglie' ), '36_facet_adressat_reverse' => array( (int) 0 => 'Broglie, Albertine Ida Gustavine de' ), '36_facet_absenderort' => array( (int) 0 => 'Bern' ), '36_facet_adressatort' => '', '36_facet_status' => 'Einmal kollationierter Druckvolltext ohne Registerauszeichnung', '36_facet_datengeberhand' => '', '36_facet_sprache' => array( (int) 0 => 'Deutsch' ), '36_facet_korrespondenten' => array( (int) 0 => 'Albertine Ida Gustavine de Broglie' ), '36_Digitalisat_Druck_Server' => array( (int) 0 => 'AWS-aw-05oh-0.tif', (int) 1 => 'AWS-aw-05oh-1.tif' ), '_label' => '', '_descr' => '', '_model' => 'Letter', '_model_title' => 'Letter', '_model_titles' => 'Letters', '_url' => '' ) $doctype_name = 'Letters' $captions = array( '36_dummy' => '', '36_absender' => 'Absender/Verfasser', '36_absverif1' => 'Verfasser Verifikation', '36_absender2' => 'Verfasser 2', '36_absverif2' => 'Verfasser 2 Verifikation', '36_absbrieftyp2' => 'Verfasser 2 Brieftyp', '36_absender3' => 'Verfasser 3', '36_absverif3' => 'Verfasser 3 Verifikation', '36_absbrieftyp3' => 'Verfasser 3 Brieftyp', '36_adressat' => 'Adressat/Empfänger', '36_adrverif1' => 'Empfänger Verifikation', '36_adressat2' => 'Empfänger 2', '36_adrverif2' => 'Empfänger 2 Verifikation', '36_adressat3' => 'Empfänger 3', '36_adrverif3' => 'Empfänger 3 Verifikation', '36_adressatfalsch' => 'Empfänger_falsch', '36_absenderort' => 'Ort Absender/Verfasser', '36_absortverif1' => 'Ort Verfasser Verifikation', '36_absortungenau' => 'Ort Verfasser ungenau', '36_absenderort2' => 'Ort Verfasser 2', '36_absortverif2' => 'Ort Verfasser 2 Verifikation', '36_absenderort3' => 'Ort Verfasser 3', '36_absortverif3' => 'Ort Verfasser 3 Verifikation', '36_adressatort' => 'Ort Adressat/Empfänger', '36_adrortverif' => 'Ort Empfänger Verifikation', '36_datumvon' => 'Datum von', '36_datumbis' => 'Datum bis', '36_altDat' => 'Datum/Datum manuell', '36_datumverif' => 'Datum Verifikation', '36_sortdatum' => 'Datum zum Sortieren', '36_wochentag' => 'Wochentag nicht erzeugen', '36_sortdatum1' => 'Briefsortierung', '36_fremddatierung' => 'Fremddatierung', '36_typ' => 'Brieftyp', '36_briefid' => 'Brief Identifier', '36_purl_web' => 'PURL web', '36_status' => 'Bearbeitungsstatus', '36_anmerkung' => 'Anmerkung (intern)', '36_anmerkungextern' => 'Anmerkung (extern)', '36_datengeber' => 'Datengeber', '36_purl' => 'OAI-Id', '36_leitd' => 'Druck 1:Bibliographische Angabe', '36_druck2' => 'Druck 2:Bibliographische Angabe', '36_druck3' => 'Druck 3:Bibliographische Angabe', '36_internhand' => 'Zugehörige Handschrift', '36_datengeberhand' => 'Datengeber', '36_purlhand' => 'OAI-Id', '36_purlhand_alt' => 'OAI-Id (alternative)', '36_signaturhand' => 'Signatur', '36_signaturhand_alt' => 'Signatur (alternative)', '36_h1prov' => 'Provenienz', '36_h1zahl' => 'Blatt-/Seitenzahl', '36_h1format' => 'Format', '36_h1besonder' => 'Besonderheiten', '36_hueberlieferung' => 'Ãœberlieferung', '36_infoinhalt' => 'Verschollen/erschlossen: Information über den Inhalt', '36_heditor' => 'Editor/in', '36_hredaktion' => 'Redakteur/in', '36_interndruck' => 'Zugehörige Druck', '36_band' => 'KFSA Band', '36_briefnr' => 'KFSA Brief-Nr.', '36_briefseite' => 'KFSA Seite', '36_incipit' => 'Incipit', '36_textgrundlage' => 'Textgrundlage Sigle', '36_uberstatus' => 'Ãœberlieferungsstatus', '36_gattung' => 'Gattung', '36_korrepsondentds' => 'Korrespondent_DS', '36_korrepsondentfs' => 'Korrespondent_FS', '36_ermitteltvon' => 'Ermittelt von', '36_metadatenintern' => 'Metadaten (intern)', '36_beilagen' => 'Beilage(en)', '36_abszusatz' => 'Verfasser Zusatzinfos', '36_adrzusatz' => 'Empfänger Zusatzinfos', '36_absortzusatz' => 'Verfasser Ort Zusatzinfos', '36_adrortzusatz' => 'Empfänger Ort Zusatzinfos', '36_datumzusatz' => 'Datum Zusatzinfos', '36_' => '', '36_KFSA Hand.hueberleiferung' => 'Ãœberlieferungsträger', '36_KFSA Hand.harchiv' => 'Archiv', '36_KFSA Hand.hsignatur' => 'Signatur', '36_KFSA Hand.hprovenienz' => 'Provenienz', '36_KFSA Hand.harchivlalt' => 'Archiv_alt', '36_KFSA Hand.hsignaturalt' => 'Signatur_alt', '36_KFSA Hand.hblattzahl' => 'Blattzahl', '36_KFSA Hand.hseitenzahl' => 'Seitenzahl', '36_KFSA Hand.hformat' => 'Format', '36_KFSA Hand.hadresse' => 'Adresse', '36_KFSA Hand.hvollstaendig' => 'Vollständigkeit', '36_KFSA Hand.hzusatzinfo' => 'H Zusatzinfos', '36_KFSA Druck.drliteratur' => 'Druck in', '36_KFSA Druck.drsigle' => 'Sigle', '36_KFSA Druck.drbandnrseite' => 'Bd./Nr./S.', '36_KFSA Druck.drfaksimile' => 'Faksimile', '36_KFSA Druck.drvollstaendig' => 'Vollständigkeit', '36_KFSA Druck.dzusatzinfo' => 'D Zusatzinfos', '36_KFSA Doku.dokliteratur' => 'Dokumentiert in', '36_KFSA Doku.doksigle' => 'Sigle', '36_KFSA Doku.dokbandnrseite' => 'Bd./Nr./S.', '36_KFSA Doku.dokfaksimile' => 'Faksimile', '36_KFSA Doku.dokvollstaendig' => 'Vollständigkeit', '36_KFSA Doku.dokzusatzinfo' => 'A Zusatzinfos', '36_Link Druck.url_titel_druck' => 'Titel/Bezeichnung', '36_Link Druck.url_image_druck' => 'Link zu Online-Dokument', '36_Link Hand.url_titel_hand' => 'Titel/Bezeichnung', '36_Link Hand.url_image_hand' => 'Link zu Online-Dokument', '36_preasentation' => 'Nicht in die Präsentation', '36_verlag' => 'Verlag', '36_anhang_tite0' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename0' => 'Image', '36_anhang_tite1' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename1' => 'Image', '36_anhang_tite2' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename2' => 'Image', '36_anhang_tite3' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename3' => 'Image', '36_anhang_tite4' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename4' => 'Image', '36_anhang_tite5' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename5' => 'Image', '36_anhang_tite6' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename6' => 'Image', '36_anhang_tite7' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename7' => 'Image', '36_anhang_tite8' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename8' => 'Image', '36_anhang_tite9' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename9' => 'Image', '36_anhang_titea' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcenamea' => 'Image', '36_anhang_titeb' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcenameb' => 'Image', '36_anhang_titec' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcenamec' => 'Image', '36_anhang_tited' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcenamed' => 'Image', '36_anhang_titee' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcenamee' => 'Image', '36_anhang_titeu' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcenameu' => 'Image', '36_anhang_titev' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcenamev' => 'Image', '36_anhang_titew' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcenamew' => 'Image', '36_anhang_titex' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcenamex' => 'Image', '36_anhang_titey' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcenamey' => 'Image', '36_anhang_titez' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcenamez' => 'Image', '36_anhang_tite10' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename10' => 'Image', '36_anhang_tite11' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename11' => 'Image', '36_anhang_tite12' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename12' => 'Image', '36_anhang_tite13' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename13' => 'Image', '36_anhang_tite14' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename14' => 'Image', '36_anhang_tite15' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename15' => 'Image', '36_anhang_tite16' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename16' => 'Image', '36_anhang_tite17' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename17' => 'Image', '36_anhang_tite18' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename18' => 'Image', '36_h_preasentation' => 'Nicht in die Präsentation', '36_anhang_titef' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcenamef' => 'Image', '36_anhang_titeg' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcenameg' => 'Image', '36_anhang_titeh' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcenameh' => 'Image', '36_anhang_titei' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcenamei' => 'Image', '36_anhang_titej' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcenamej' => 'Image', '36_anhang_titek' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcenamek' => 'Image', '36_anhang_titel' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcenamel' => 'Image', '36_anhang_titem' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcenamem' => 'Image', '36_anhang_titen' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcenamen' => 'Image', '36_anhang_titeo' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcenameo' => 'Image', '36_anhang_titep' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcenamep' => 'Image', '36_anhang_titeq' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcenameq' => 'Image', '36_anhang_titer' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcenamer' => 'Image', '36_anhang_tites' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcenames' => 'Image', '36_anhang_titet' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcenamet' => 'Image', '36_anhang_tite19' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename19' => 'Image', '36_anhang_tite20' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename20' => 'Image', '36_anhang_tite21' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename21' => 'Image', '36_anhang_tite22' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename22' => 'Image', '36_anhang_tite23' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename23' => 'Image', '36_anhang_tite24' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename24' => 'Image', '36_anhang_tite25' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename25' => 'Image', '36_anhang_tite26' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename26' => 'Image', '36_anhang_tite27' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename27' => 'Image', '36_anhang_tite28' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename28' => 'Image', '36_anhang_tite29' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename29' => 'Image', '36_anhang_tite30' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename30' => 'Image', '36_anhang_tite31' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename32' => 'Image', '36_anhang_tite33' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename33' => 'Image', '36_anhang_tite34' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename34' => 'Image', '36_Relationen.relation_art' => 'Art', '36_Relationen.relation_link' => 'Interner Link', '36_volltext' => 'Brieftext (Digitalisat Leitdruck oder Transkript Handschrift)', '36_History.hisbearbeiter' => 'Bearbeiter', '36_History.hisschritt' => 'Bearbeitungsschritt', '36_History.hisdatum' => 'Datum', '36_History.hisnotiz' => 'Notiz', '36_personen' => 'Personen', '36_werke' => 'Werke', '36_orte' => 'Orte', '36_themen' => 'Themen', '36_briedfehlt' => 'Fehlt', '36_briefbestellt' => 'Bestellt', '36_intrans' => 'Transkription', '36_intranskorr1' => 'Transkription Korrektur 1', '36_intranskorr2' => 'Transkription Korrektur 2', '36_intranscheck' => 'Transkription Korr. geprüft', '36_intranseintr' => 'Transkription Korr. eingetr', '36_inannotcheck' => 'Auszeichnungen Reg. geprüft', '36_inkollation' => 'Auszeichnungen Kollationierung', '36_inkollcheck' => 'Auszeichnungen Koll. geprüft', '36_himageupload' => 'H/h Digis hochgeladen', '36_dimageupload' => 'D Digis hochgeladen', '36_stand' => 'Bearbeitungsstand (Webseite)', '36_stand_d' => 'Bearbeitungsstand (Druck)', '36_timecreate' => 'Erstellt am', '36_timelastchg' => 'Zuletzt gespeichert am', '36_comment' => 'Kommentar(intern)', '36_accessid' => 'Access ID', '36_accessidalt' => 'Access ID-alt', '36_digifotos' => 'Digitalisat Fotos', '36_imagelink' => 'Imagelink', '36_vermekrbehler' => 'Notizen Behler', '36_vermekrotto' => 'Anmerkungen Otto', '36_vermekraccess' => 'Bearb-Vermerke Access', '36_zeugenbeschreib' => 'Zeugenbeschreibung', '36_sprache' => 'Sprache', '36_accessinfo1' => 'Archiv H (+ Signatur)', '36_korrekturbd36' => 'Korrekturen Bd. 36', '36_druckbd36' => 'Druckrelevant Bd. 36', '36_digitalisath1' => 'Digitalisat_H', '36_digitalisath2' => 'Digitalisat_h', '36_titelhs' => 'Titel_Hs', '36_accessinfo2' => 'Archiv H (+ Signatur)', '36_accessinfo3' => 'Sigle (Dokumentiert in + Bd./Nr./S.)', '36_accessinfo4' => 'Sigle (Druck in + Bd./Nr./S.)', '36_KFSA Hand.hschreibstoff' => 'Schreibstoff', '36_Relationen.relation_anmerkung' => null, '36_anhang_tite35' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename35' => 'Image', '36_anhang_tite36' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename36' => 'Image', '36_anhang_tite37' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename37' => 'Image', '36_anhang_tite38' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename38' => 'Image', '36_anhang_tite39' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename39' => 'Image', '36_anhang_tite40' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename40' => 'Image', '36_anhang_tite41' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename41' => 'Image', '36_anhang_tite42' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename42' => 'Image', '36_anhang_tite43' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename43' => 'Image', '36_anhang_tite44' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename44' => 'Image', '36_anhang_tite45' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename45' => 'Image', '36_anhang_tite46' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename46' => 'Image', '36_anhang_tite47' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename47' => 'Image', '36_anhang_tite48' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename48' => 'Image', '36_anhang_tite49' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename49' => 'Image', '36_anhang_tite50' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename50' => 'Image', '36_anhang_tite51' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename51' => 'Image', '36_anhang_tite52' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename52' => 'Image', '36_anhang_tite53' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename53' => 'Image', '36_anhang_tite54' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename54' => 'Image', '36_KFSA Hand.hbeschreibung' => 'Beschreibung', '36_KFSA Kritanhang.krit_infotyp' => 'Infotyp', '36_KFSA Kritanhang.krit_infotext' => 'Infotext', '36_datumspezif' => 'Datum Spezifikation', 'index_orte_10' => 'Orte', 'index_orte_10.content' => 'Orte', 'index_orte_10.comment' => 'Orte (Kommentar)', 'index_personen_11' => 'Personen', 'index_personen_11.content' => 'Personen', 'index_personen_11.comment' => 'Personen (Kommentar)', 'index_werke_12' => 'Werke', 'index_werke_12.content' => 'Werke', 'index_werke_12.comment' => 'Werke (Kommentar)', 'index_periodika_13' => 'Periodika', 'index_periodika_13.content' => 'Periodika', 'index_periodika_13.comment' => 'Periodika (Kommentar)', 'index_sachen_14' => 'Sachen', 'index_sachen_14.content' => 'Sachen', 'index_sachen_14.comment' => 'Sachen (Kommentar)', 'index_koerperschaften_15' => 'Koerperschaften', 'index_koerperschaften_15.content' => 'Koerperschaften', 'index_koerperschaften_15.comment' => 'Koerperschaften (Kommentar)', 'index_zitate_16' => 'Zitate', 'index_zitate_16.content' => 'Zitate', 'index_zitate_16.comment' => 'Zitate (Kommentar)', 'index_korrespondenzpartner_17' => 'Korrespondenzpartner', 'index_korrespondenzpartner_17.content' => 'Korrespondenzpartner', 'index_korrespondenzpartner_17.comment' => 'Korrespondenzpartner (Kommentar)', 'index_archive_18' => 'Archive', 'index_archive_18.content' => 'Archive', 'index_archive_18.comment' => 'Archive (Kommentar)', 'index_literatur_19' => 'Literatur', 'index_literatur_19.content' => 'Literatur', 'index_literatur_19.comment' => 'Literatur (Kommentar)', 'index_kunstwerke_kfsa_20' => 'Kunstwerke KFSA', 'index_kunstwerke_kfsa_20.content' => 'Kunstwerke KFSA', 'index_kunstwerke_kfsa_20.comment' => 'Kunstwerke KFSA (Kommentar)', 'index_druckwerke_kfsa_21' => 'Druckwerke KFSA', 'index_druckwerke_kfsa_21.content' => 'Druckwerke KFSA', 'index_druckwerke_kfsa_21.comment' => 'Druckwerke KFSA (Kommentar)', '36_fulltext' => 'XML Volltext', '36_html' => 'HTML Volltext', '36_publicHTML' => 'HTML Volltext', '36_plaintext' => 'Volltext', 'transcript.text' => 'Transkripte', 'folders' => 'Mappen', 'notes' => 'Notizen', 'notes.title' => 'Notizen (Titel)', 'notes.content' => 'Notizen', 'notes.category' => 'Notizen (Kategorie)', 'key' => 'FuD Schlüssel' ) $query_id = '67401c444e216' $value = '„[Freitag] Bern, den 3. Januar 1812.<br>Liebe Albertine!<br>Obgleich ich meinen kleinen Mann, der Dir ein glückliches neues Jahr wünscht, schon als Brief [...]“' $key = 'Incipit' $adrModalInfo = array( 'ID' => '1460', 'project' => '1', 'timecreate' => '2013-03-25 11:56:53', 'timelastchg' => '2018-01-07 18:40:17', 'key' => 'AWS-ap-004k', 'docTyp' => array( 'name' => 'Person', 'id' => '39' ), '39_toddatum' => '1838-09-22', '39_name' => 'Broglie, Albertine Ida Gustavine de', '39_gebdatum' => '1797-06-08', '39_pdb' => 'GND', '39_geschlecht' => 'w', '39_dbid' => '173169228 ', '39_geburtsort' => array( 'ID' => '171', 'content' => 'Paris', 'bemerkung' => 'GND:4044660-8', 'LmAdd' => array() ), '39_quellen' => 'WBIS@http://db.saur.de/WBIS/basicSearch.jsf@F28150@ Wikipedia@https://en.wikipedia.org/wiki/Albertine,_baroness_Sta%C3%ABl_von_Holstein@', '39_namevar' => 'Broglie, Albertine Ida Gustavine de Staël-Holstein de', '39_sterbeort' => array( 'ID' => '6627', 'content' => 'Broglie (Eure)', 'bemerkung' => '', 'LmAdd' => array() ), '39_beziehung' => 'AWS war als Hauslehrer der Kinder Germaine de Staël-Holsteins ab 1804 in Coppet tätig; er hatte ein gutes Verhältnis zu ihnen. Auch nach dem Tod de Staëls im Jahr 1817 wurde AWS wie ein Mitglied der Familie behandelt, für Albertine und ihren Bruder Auguste war er wie ein Vater. Schlegel und Albertine führten eine umfangreiche Korrespondenz, die von großer Vertrautheit zeugt.', '39_lebenwirken' => 'Schriftstellerin Albertine Ida Gustavine de Broglie war die Tochter von Germaine de Staël-Holstein und Benjamin Constant, einem der Liebhaber de Staëls. Sie folgte ihrer Mutter an verschiedene Wirkungsorte. Albertine heiratete den Herzog von Broglie, Achille-Léon-Victor, im Jahr 1816. Ihr Ehemann war ein engagierter Politiker, der verschiedene Ministerposten innehatte. Sie führte einen Salon in Paris, in welchem sich Politiker, Literaten, Philosophen und Künstler trafen. Sie schrieb religiöse und moralische Schriften und lebte am liebsten, anders als ihre Mutter, zurückgezogen in Coppet. Zahlreiche Essays erschienen postum unter dem Titel „Fragments sur divers sujets de religion et de morale“ (1840).', '39_status_person' => 'Vollständig', '39_sourcename0' => 'AWS-ap-004k-0.jpg', 'folders' => array( (int) 0 => 'Personen', (int) 1 => 'Personen' ), '_label' => '', '_descr' => '', '_model' => 'Person', '_model_title' => 'Person', '_model_titles' => 'People', '_url' => '' ) $version = 'version-04-20' $domain = 'https://august-wilhelm-schlegel.de' $url = 'https://august-wilhelm-schlegel.de/version-04-20' $purl_web = 'https://august-wilhelm-schlegel.de/version-04-20/letters/view/12115' $state = '01.04.2020' $citation = 'Digitale Edition der Korrespondenz August Wilhelm Schlegels [01.04.2020]; August Wilhelm von Schlegel an Albertine Ida Gustavine de Broglie; 03.01.1812' $lettermsg1 = 'August Wilhelm Schlegel: Digitale Edition der Korrespondenz [Version-04-20]' $lettermsg2 = ' <a href="https://august-wilhelm-schlegel.de/version-04-20/letters/view/12115">https://august-wilhelm-schlegel.de/version-04-20/letters/view/12115</a>.' $changeLeit = array( (int) 0 => 'Pange', (int) 1 => ' Pauline de: August Wilhelm Schlegel und Frau von Staël. Eine schicksalhafte Begegnung. Nach unveröffentlichten Briefen erzählt von Pauline Gräfin de Pange. Dt. Ausg. von Willy Grabert. Hamburg 1940' ) $sprache = 'Deutsch' $caption = array( 'data' => array( (int) 3041 => array( 'id' => '3041', 'art' => 'Original', 'datum' => '03.01.1812', 'signatur' => 'Pange, Pauline de: Auguste-Guillaume Schlegel et Madame de Staël d’apres des documents inédits. Paris 1938, S. 340‒341.', 'image' => array( [maximum depth reached] ) ) ), 'exists' => '1', 'content' => 'Zugehörige Dokumente' ) $tab = 'related' $n = (int) 1
include - APP/View/Letters/view.ctp, line 339 View::_evaluate() - APP/Lib/cakephp/lib/Cake/View/View.php, line 971 View::_render() - APP/Lib/cakephp/lib/Cake/View/View.php, line 933 View::render() - APP/Lib/cakephp/lib/Cake/View/View.php, line 473 Controller::render() - APP/Lib/cakephp/lib/Cake/Controller/Controller.php, line 968 Dispatcher::_invoke() - APP/Lib/cakephp/lib/Cake/Routing/Dispatcher.php, line 200 Dispatcher::dispatch() - APP/Lib/cakephp/lib/Cake/Routing/Dispatcher.php, line 167 [main] - APP/webroot/index.php, line 109
[Freitag] Bern, den 3. Januar 1812.
Liebe Albertine!
Obgleich ich meinen kleinen Mann, der Dir ein glückliches neues Jahr wünscht, schon als Brief rechnen könnte, antworte ich zunächst auf Dein ganz reizendes Schreiben, weil ich großen Wert darauf lege, daß zwischen uns ein reger Briefwechsel zustandekommt. Du machst richtige und feine Bemerkungen über den Geist Deiner Frau Mutter, und ich teile ganz und gar Deine Eindrücke. Ich glaube, Deine Klagen über die Langeweile, die Dir Deine Umgebung einflößt, werden sofort verstummen, sobald sie erst wiederhergestellt ist. Das wird, wie ich hoffe, bald der Fall sein, besonders wenn Du dafür sorgst, daß sie sich ordentlich pflegt. So unpäßlich, wie sie ist, hat sie natürlich keine Lust, die Unterhaltung zu leiten, denn sie ist ja in Wahrheit nicht nur selber anregend – sie hat auch die Gabe, andere anregend zu machen, wofern diese nur ein wenig Anlage dazu haben.
Du weißt doch sicher genau, daß Bern nicht eine Stadt ist, in der man sich fabelhaft amüsiert; trotzdem bot die Stadt in den letzten Tagen des Jahres ganz gegen ihre Gewohnheit ein bewegtes Bild. Es war Weihnachtsmarkt; alle Buden hatten viel Flitterkram für Kinder und für Große ausgelegt; Jeder macht hier nämlich dem anderen zu Neujahr Geschenke: Eltern und Kinder, Frauen und Männer, Brüder und Schwestern, Freunde untereinander u. s. w. ... Das ist wirklich nett und nachahmenswert. Ich glaube, ich würde mir die Geschenke nicht so genau ansehen, auch wenn sie einige Tage zu spät kämen. Am Abend vor dem Neujahrstag liefen einige Masken aus dem Volke durch die Arkaden, genau so wie bei Eurem Karneval. Am 1. Januar war ich auf einem Subskriptionsball, der alle vierzehn Tage stattfindet und zu dem man mich als Fremden eingeladen hatte. Der Saal ist sehr hübsch; er hat Estraden und Logen, die ringsherum laufen, und es wurden Berner Allemanden so kräftig getanzt, daß man meinte, der Fußboden müsse springen. Am gleichen Abend war ich noch bei einem sehr lustigen Essen. Eine Lotterie von allen möglichen Kleinigkeiten wurde veranstaltet und mit pompösen Worten angekündigt. Ich erhielt zwei sogenannte Paradiesvogelfedern. Während der Vorbereitung zur Lotterie gab es ein paar ausgelassene Darbietungen, und Herr Heer, Landammann von Glarus und augenblicklich hier als Abgeordneter, der gewöhnlich sehr schweigsam ist, trug plötzlich eine Schweizer Dialekterzählung vor; dabei machte er Grimassen, die so sehr mit seinem an sich finsteren Gesicht in Gegensatz standen, daß ich eine Viertelstunde lang lachen mußte.
Die Kälte ist noch immer außerordentlich stark – die eine Hälfte des Tages verbringe ich damit, mich am Ofen zu wärmen, die andere damit, wieder durchzufrieren, indem ich mich von ihm entferne, wie gerade jetzt. Ich will nun nicht mit dem Satz schließen, den Fr[au] von St[aël] so sehr haßt: ›ich schließe, weil der Postwagen abgeht‹, aber ich muß doch Schluß machen, weil meine Finger vor Kälte ganz starr sind. Ich füge nur noch hinzu, daß ich Albert sehr dankbar für die Lateinstunden bin, die er Dir gibt; er tut auch gut daran, Dir ab und zu einen Klaps zu geben, ob Du es richtig oder falsch machst: die Dinge prägen sich so dem Gedächtnis besser ein.
Leb’ wohl, meine liebe und wahrhaft liebenswürdige Albertine. Ich werde oft hier nach Dir gefragt, denn es hat sich in der Gesellschaft ein – zweifellos übertriebenes – Gerücht – wie alle Gerüchte, die von außen kommen – verbreitet, Du seiest ganz reizend.
Liebe Albertine!
Obgleich ich meinen kleinen Mann, der Dir ein glückliches neues Jahr wünscht, schon als Brief rechnen könnte, antworte ich zunächst auf Dein ganz reizendes Schreiben, weil ich großen Wert darauf lege, daß zwischen uns ein reger Briefwechsel zustandekommt. Du machst richtige und feine Bemerkungen über den Geist Deiner Frau Mutter, und ich teile ganz und gar Deine Eindrücke. Ich glaube, Deine Klagen über die Langeweile, die Dir Deine Umgebung einflößt, werden sofort verstummen, sobald sie erst wiederhergestellt ist. Das wird, wie ich hoffe, bald der Fall sein, besonders wenn Du dafür sorgst, daß sie sich ordentlich pflegt. So unpäßlich, wie sie ist, hat sie natürlich keine Lust, die Unterhaltung zu leiten, denn sie ist ja in Wahrheit nicht nur selber anregend – sie hat auch die Gabe, andere anregend zu machen, wofern diese nur ein wenig Anlage dazu haben.
Du weißt doch sicher genau, daß Bern nicht eine Stadt ist, in der man sich fabelhaft amüsiert; trotzdem bot die Stadt in den letzten Tagen des Jahres ganz gegen ihre Gewohnheit ein bewegtes Bild. Es war Weihnachtsmarkt; alle Buden hatten viel Flitterkram für Kinder und für Große ausgelegt; Jeder macht hier nämlich dem anderen zu Neujahr Geschenke: Eltern und Kinder, Frauen und Männer, Brüder und Schwestern, Freunde untereinander u. s. w. ... Das ist wirklich nett und nachahmenswert. Ich glaube, ich würde mir die Geschenke nicht so genau ansehen, auch wenn sie einige Tage zu spät kämen. Am Abend vor dem Neujahrstag liefen einige Masken aus dem Volke durch die Arkaden, genau so wie bei Eurem Karneval. Am 1. Januar war ich auf einem Subskriptionsball, der alle vierzehn Tage stattfindet und zu dem man mich als Fremden eingeladen hatte. Der Saal ist sehr hübsch; er hat Estraden und Logen, die ringsherum laufen, und es wurden Berner Allemanden so kräftig getanzt, daß man meinte, der Fußboden müsse springen. Am gleichen Abend war ich noch bei einem sehr lustigen Essen. Eine Lotterie von allen möglichen Kleinigkeiten wurde veranstaltet und mit pompösen Worten angekündigt. Ich erhielt zwei sogenannte Paradiesvogelfedern. Während der Vorbereitung zur Lotterie gab es ein paar ausgelassene Darbietungen, und Herr Heer, Landammann von Glarus und augenblicklich hier als Abgeordneter, der gewöhnlich sehr schweigsam ist, trug plötzlich eine Schweizer Dialekterzählung vor; dabei machte er Grimassen, die so sehr mit seinem an sich finsteren Gesicht in Gegensatz standen, daß ich eine Viertelstunde lang lachen mußte.
Die Kälte ist noch immer außerordentlich stark – die eine Hälfte des Tages verbringe ich damit, mich am Ofen zu wärmen, die andere damit, wieder durchzufrieren, indem ich mich von ihm entferne, wie gerade jetzt. Ich will nun nicht mit dem Satz schließen, den Fr[au] von St[aël] so sehr haßt: ›ich schließe, weil der Postwagen abgeht‹, aber ich muß doch Schluß machen, weil meine Finger vor Kälte ganz starr sind. Ich füge nur noch hinzu, daß ich Albert sehr dankbar für die Lateinstunden bin, die er Dir gibt; er tut auch gut daran, Dir ab und zu einen Klaps zu geben, ob Du es richtig oder falsch machst: die Dinge prägen sich so dem Gedächtnis besser ein.
Leb’ wohl, meine liebe und wahrhaft liebenswürdige Albertine. Ich werde oft hier nach Dir gefragt, denn es hat sich in der Gesellschaft ein – zweifellos übertriebenes – Gerücht – wie alle Gerüchte, die von außen kommen – verbreitet, Du seiest ganz reizend.
· Original , 03.01.1812
· Pange, Pauline de: Auguste-Guillaume Schlegel et Madame de Staël d’apres des documents inédits. Paris 1938, S. 340‒341.
· Pange, Pauline de: Auguste-Guillaume Schlegel et Madame de Staël d’apres des documents inédits. Paris 1938, S. 340‒341.