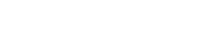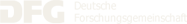Notice (8): Undefined offset: 0 [APP/View/Letters/view.ctp, line 339]
Code Context
/version-04-20/letters/view/3165" data-language=""></ul></div><div id="zoomImage" style="height:695px" class="open-sea-dragon" data-src="<?php echo $this->Html->url($dzi_imagesHand[0]) ?>" data-language="<?=$this->Session->read('Config.language')?>"></div>
$viewFile = '/var/www/awschlegel/version-04-20/app/View/Letters/view.ctp' $dataForView = array( 'html' => '<span class="index-887 tp-101698 ">Bonn</span> den 21sten Februar 1826.<br>Ew. Excellenz haben die gerechteste Ursache von der Welt, ungehalten zu seyn. Daß Sie den Briefwechsel eine Zeitlang hatten ruhen lassen, war ganz in der Ordnung, und Ew. Excellenz durften darüber keine Sylbe verlieren. Ich besitze eine reichhaltige Sammlung Ihrer Briefe, woraus ich oft neue Anregung und Belehrung schöpfe. Jede Bereicherung ist unendlich willkommen. Wenn aber Ew. Excellenz unter so tiefen und weitumfassenden Forschungen, die Sie mit unermüdlicher Thätigkeit verfolgen, keine Muße finden, mir zu schreiben, so bescheide ich mich gern, daß mein persönliches Interesse gegen das allgemeine zurückstehen muß, und bin zufrieden, wenn ich nur auf andern Wegen die Gewißheit von Ihrer ununterbrochenen Heiterkeit und Gesundheit erhalte; und dieß war in jenem Zeitraume der Fall. Daß ich hingegen eine solche Sendung, wie Ihre letzte ist, so lange unbeantwortet lassen konnte, ist unerhört und unverantwortlich. Ich will nicht versuchen, es zu entschuldigen; erklären könnte ich es wohl aus der Beschaffenheit der Störungen, die ununterbrochen auf einander folgten, und mit solchen Studien ganz unverträglich sind. Unter andern mußte ich, gleich nach Empfang <span class="doc-3144 ">Ihres Schreibens</span>, außer dem Rectorat über zwei Monate die Stelle des Regierungs-Bevollmächtigten vertreten. Doch ich müßte meinen ganzen zeitherigen Lebenslauf erzählen, und dieß wäre ein unnützer Zeitverlust. Ich komme lieber gleich zur Hauptsache.<br>Ew. Excellenz können nicht bezweifeln, daß ich mich sehr glücklich schätze, mit <span class="index-9946 tp-101719 ">Ihren Bemerkungen über die Bhagavad Gita</span> <span class="index-2322 tp-101718 ">meine Indische Bibliothek</span> auszuzieren. Das <span class="index-2543 tp-101720 ">meiner Übersetzung</span> ertheilte Lob ist freilich wohl etwas zu stark, um es selbst abdrucken zu lassen: aber wer mag sich entschließen, so etwas auszuschlagen? Nur des Sanskrit kundige Leser können das einzelne verstehen; aber alle denkenden Leser werden bei den vortrefflichen allgemeinen Bemerkungen ihre Rechnung finden. Leider kann ich noch nicht melden, daß an der Indischen Bibliothek wirklich gedruckt wird. Im Kopfe habe ich den Stoff zu mehreren Heften fertig, aber auf dem Papiere sehr weniges. Wie sehr ich gestört gewesen, können Ew. Excellenz eben daraus ermessen, daß ich, ungeachtet des neuen Antriebes, den Ihr Aufsatz mir gab, dennoch kein Heft zu Stande gebracht.<br>Ich war schon lange gesonnen, <span class="weight-bold ">Nachträge zur Kritik und Auslegung der Bhagavad Gita </span>zu geben: da werden sich nun die Ihrigen vortrefflich anschließen. Wäre es aber nicht gut, <span class="index-14597 tp-101722 ">die betreffenden Stellen von </span><span class="index-14597 tp-101722 index-3590 tp-101721 ">Langlois</span> französisch mit abzudrucken? Meine etwanigen Nebenbemerkungen, beistimmend, bestätigend oder bezweifelnd, möchten, wenn Ew. Excellenz es genehmigen, in kleinerer Schrift unter die einzelnen Abschnitte, oder als Noten unter den Text gesetzt werden.<br>Die Erlaubniß, etwas als unrichtig wegzustreichen, ist mir zu bedenklich, um Gebrauch davon zu machen. Wo ich für jetzt nicht beistimmen kann, wird es meistens disputable Punkte betreffen. Indessen lege ich auf einem besondern Blatte einiges vor, was vielleicht Ew. Excellenz zur Zurücknahme oder Modification weniger Zeilen veranlassen könnte, und erwarte darüber Ihre Entscheidung.<br>Kaum wage ich eine schüchterne Bitte um die Auslassung eines einzigen Wortes, welches nur zweimal vorkommt. Es ist das Wort <span class="weight-bold ">pantheistisch</span>. Da hier die Lehre der Bhagavad Gita nicht im Ganzen erörtert wird, so kann es ja entbehrt werden, es dürfte bloß heißen: „in diesem System“. Überdieß steht es bei einem Satze, worin die christlichen Mystiker wohl so ziemlich mit dem Verfasser der Bhagavad Gita übereinstimmen. Hier bildet es ein Präjudiz als ob die Sache schon ausgemacht wäre. Wenn die Behauptung im allgemeinen ausgeführt wird, dann ist es etwas andres. <span class="index-8 tp-101723 ">Mein Bruder</span> hat schon früher die Lehre der Bhagavad Gita für Pantheismus erklärt. Ich habe ihm widersprochen, und behauptet, was ihn hiezu vermocht, seyen starke Ausdrücke von der dynamischen Allgegenwart. Ist zum reinen Theismus durchaus die Lehre von der Extramundanität der Gottheit erfoderlich? Die Immanenz des Weltalls lehrt <span class="index-3764 tp-101724 ">die Bhagavad Gita</span> freilich, unbeschadet der Emanation. Ist es im strengen Pantheismus möglich, die Gottheit von der Natur zu unterscheiden? Hört nicht alle Religion, alles ich und du, zwischen dem Gemüthe und der Gottheit auf? Ist damit die Lehre von der Vermittlung, von einer Herablassung der Gottheit um die Creatur zu sich heraufzuziehen, verträglich, welche doch so klar in der Bhagavad Gita vorgetragen wird? Ich habe ehemals die Schriften der Mystiker viel gelesen: mich dünkt, sie theilen sich in zwei Hauptclassen, die Theosophen und die Mystiker des Gefühls. Meines Erachtens stimmt mein Indischer Weiser so ziemlich mit den theosophischen Mystikern überein; weniger mit den letzteren, weil bei diesen der Sinn für die Natur ganz erloschen ist, welcher bei ihm in ursprünglicher mythologischer Fülle lebt.<br>Bei den scharfsinnigen Bemerkungen über die Bildung des philosophischen Sprachgebrauchs wage ich es, folgendes Ihrer Beurtheilung vorzulegen. In der Regel sind freilich die metaphysischen Ausdrücke von sinnlichen Vorstellungen übertragen; sollte es nicht aber auch in einigen Sprachen, und namentlich im Sanskrit, ursprünglich metaphysische Wörter geben? Z. B. <span class="slant-italic ">dēha</span> von <span class="slant-italic ">dih</span>, wie <span class="slant-italic ">dēs͗a</span> von <span class="slant-italic ">dis͗</span>, ganz etymologisch richtig. Nun heißt aber <span class="slant-italic ">dih</span> beschmieren, beflecken, besudeln. <span class="index-2553 tp-101747 ">Wilson</span> giebt zwar eine zweite Bedeutung, von der er es ableiten will. Aber ich kann mich nicht erinnern, das Verbum und insbesondre das häufige Participium <span class="slant-italic ">digdha</span> jemals anders als in der obigen Bedeutung gefunden zu haben. Auch steht in <span class="index-7022 tp-101726 ">dem Wurzel-Wörterbuch</span> bei <span class="index-3715 tp-101725 ">Carey</span> bloß <span class="slant-italic ">lipi</span>, in <span class="index-5662 tp-101728 ">der Englischen Übersetzung</span> bei <span class="index-3481 tp-101727 ">Wilkins</span> ebenfalls. Wunderlich genug steht aber dabei bloß Eine mit seiner Auslegung gar nicht übereinstimmende Definition <span class="slant-italic ">upachayē</span>, welches die zweite Bedeutung von Wilson ist. Wieder einmal ein Beispiel, wie unsere Elementar-Bücher noch beschaffen sind, und wie man sich überall selbst helfen, und die Augen offen haben muß! Wenn die zweite Bedeutung sich nicht praktisch bewährt, so bin ich sehr geneigt zu glauben, sie sei bloß von Indischen Grammatikern zum Behuf der Ableitung von <span class="slant-italic ">dēha</span> ersonnen. Ist es aber von <span class="slant-italic ">dih</span> in der Bedeutung von <span class="slant-italic ">lipi</span>, so liegt ja in dem einfachen Worte, wie im Keim, die ganze <span class="index-146 tp-101729 ">Platonische</span> Lehre. Auch die andre Ableitung hat schon etwas wissenschaftliches. – Wie dem aber auch sei, das ist gewiß, daß bei den Indiern die Speculation so uralt und ihr Einfluß so überwiegend war, daß der metaphysische Sprachgebrauch in das Leben, wenigstens in die epische Poesie zurückgekehrt ist, und diese Erscheinung ist einzig in ihrer Art.<br>Meine Ansicht hängt freilich mit andern vielleicht paradoxen und deswegen besser esoterisch bleibenden Meynungen zusammen. Ich glaube nämlich, daß es ursprünglich tellurische, siderische und spirituale Sprachen giebt. Dieß würde auf die Eintheilung nach den drei <span class="slant-italic ">gûńa</span>’s hinauslaufen. Reine Exemplare von den drei Gattungen lassen sich freilich nicht nachweisen, man dürfte aber wohl versuchen, die Sprachen nach dem vorwaltenden Prinzip zu classifiziren.<br>Während ich dieses schrieb, empfing ich <span class="index-20049 tp-101730 ">Ihre Abhandlung über die Buchstabenschrift</span>, die ich sogleich verschlungen habe. In der Hauptsache bin ich ganz einverstanden. Mein einziger Zweifel ist nur der, ob nicht jene urweltliche Genialität, die bei der Erfindung der Buchstabenschrift gewaltet, jenes klare Bewußtseyn von den mit den Sprachorganen vorgenommenen und möglicher Weise vorzunehmenden Handlungen, von der symbolischen Bedeutung der Laute, ihrer Beziehung zu einander u. s. w.; ob, sage ich, jenes der Sprache bei ihrer Ausbildung nicht dieselben Dienste habe leisten können, als das materielle Vorhandenseyn der Buchstabenschrift?<br>Die Abweichung unsrer Ansichten – ich sage es mit Mistrauen gegen meine eigne Meynung – bezieht sich auf den Ursprung, und den frühesten Gang der menschlichen Cultur. Ich kann unmöglich die ersten großen Grundlagen als den späten und allmähligen Erfolg eines experimentirenden Herumtappens betrachten; sie scheinen mir ein genialischer Wurf zu seyn, wo alles mit Einemmale da ist, wie beim Anfange des organischen Lebens. Die Urväter des Menschengeschlechtes – einige, nicht alle; denn ich fürchte, ich bin in der dreifachen Ketzerei begriffen, ein Präadamit, ein Coadamit und ein Postadamit zu seyn – vergleiche ich mit Menschen, welche die Fähigkeit besessen hätten, in einem dunkeln Schacht durch die Kraft ihrer eignen Augen zu sehen, während unsre Bergleute sich der Lampen und Laternen bedienen müssen. <span class="index-942 tp-101731 ">Julius Caesar</span> sagte, die Schrift habe das Gedächtniß zu Grunde gerichtet. Ist es nicht mit allen Dingen so? Je vollkommner die Hülfsmittel, desto mehr erlischt der inwohnende Sinn, das angebohrne Talent. Divinatorische Durchschauung der Natur, und von außen her erworbene Erfahrung scheinen mir die beiden Pole der menschlichen Cultur zu seyn; jenes der positive, dieses der negative. Wenn einmal in einem Zeitalter, wo das letzte Princip herrschend ist, jenes durchblitzt, so nimmt selbst das Experiment einen neuen Schwung, und die mechanischen Physiker, welche die Ideen läugnen, werden mehr von ihnen geleitet, als sie selbst wissen.<br>Um auf die Buchstabenschrift zurückzukommen, sie wäre also – da ihr Wesen in der Analyse der articulirten Laute besteht – <span class="slant-italic ">virtualiter</span> schon in der ältesten Zeit vorhanden gewesen, wenn es auch an zubereiteten Stoffen fehlte, um sie in Ausübung zu bringen.<br>Auch darin bin ich ganz einverstanden, daß eine gewisse todte und einförmige Regelmäßigkeit gar keine Vollkommenheit der Sprachen ist. <span class="index-113 tp-101732 ">Adelung</span> hatte ganz richtig bemerkt, daß in der Deutschen Sprache die starke Conjugation (nach ihm die anomale) der schwachen mehr und mehr Platz einräume. Aber der geistlose Grammatiker hielt dieß für eine Vervollkommung, während es doch nur eine Abstumpfung ist. Die Mannigfaltigkeit der Formen, zB. der Declinationen und Conjugationen scheint mir, wenigstens imaginativ, bedeutsam gewesen zu seyn, was nachher verloren ging. <span class="index-1899 tp-101733 ">Grimm</span> betrachtet alle Anomalien als später und zufällig entstanden. Dieses gilt von den meisten, aber ich muß auch ursprüngliche, symbolische Anomalien annehmen, z. B. die der Personal-Pronomina in unsrer Sprachfamilie, und diesen Gesichtspunkt vermißte ich in <span class="index-2426 tp-101734 ">Bopps</span> <span class="index-9960 tp-101735 ">sonst vortrefflicher Abhandlung</span>. Eben so ist es mit der <span class="weight-bold ">grammatischen Homonymie</span>, wenn nämlich ganz verschiedene Biegungen gleich lauten. Dieses Gebrechen entsteht meistens aus der Abstumpfung, und nimmt daher bei nicht fixirten Sprachen, wie bisher bei der unsrigen, immer zu. Sollte es nicht aber auch ursprüngliche grammatische Homonymien geben, die symbolisch sind? ZB. logisch betrachtet ist es gleichgültig ob Subject und Object belebte Wesen oder unbelebte Dinge sind; imaginativ aber keinesweges, denn das Unbelebte handelt und leidet nicht eigentlich: es wirkt und erfährt Wirkungen. Diese neutrale Stellung wird nun durch die Gleichheit des Accusativus und Nominativus der Neutra [angedeutet], welche deswegen im Sanskrit, im Griechischen und Lateinischen eine wahre Schönheit ist. Im Deutschen ist es keine Schönheit mehr, weil so viele masculina und sämtliche feminina diese Eigenschaft mit den neutris gemein haben.<br>Ich kehre von meinen endlosen Abschweifungen zurück, um zu <span class="index-20049 tp-101736 ">Ihrer Abhandlung</span> eine kleine historische Bemerkung nachzutragen. Sie bemerken <span class="slant-italic ">p</span>. 1, daß die Chinesen die Europäische Buchstabenschrift verschmäht haben. Aber die Unmöglichkeit, sie ihrer Sprache anzueignen, erhellet doch noch weit stärker aus der unläugbaren Thatsache, daß die Indische Buchstabenschrift von den ersten Buddhistischen Missionaren überbracht worden war. <span class="index-3543 tp-101737 ">Rémusat</span> hat in <span class="index-20067 tp-101773 ">einem eignen Aufsatze</span>, ich weiß nicht mehr in <span class="index-5233 tp-101774 ">welcher Zeitschrift</span>, die Weise geschildert, wie ein chinesischer Autor von dieser fremden Theorie der Laute Rechenschaft giebt. <span class="index-19507 tp-101738 ">Der Baron Schilling von Canstadt</span> hat mir ein chinesisches Buch gezeigt, wo in einer Columne indische Sylben standen, in der nächsten die Lautbezeichnung, in chinesischer Schrift, in einer dritten die Bedeutung. Ohne Zweifel waren es <span class="slant-italic ">mantra</span>’s, ich hatte nicht Muße es näher zu untersuchen.<br>Nun noch einiges über meine französischen Kritiker und meine zu machenden Antikritiken. Wird es Ew. Excellenz unangenehm seyn, wenn ich in der Nachbarschaft Ihres so milden und ruhigen Aufsatzes mir einigen Spott über <span class="index-900 tp-101739 ">Chézy</span> und <span class="index-3590 tp-101740 ">Langlois</span> erlaube? Nach Ihrer gütigen Gesinnung für mich hatten die Artikel des letzteren Sie indignirt, und Sie hatten die magistrale Recension noch nicht gelesen. Auf <span class="index-2385 tp-101741 ">Colebrooke</span> haben sie denselben Eindruck gemacht. Er <span class="doc-4128 ">schrieb mir</span>: <span class="slant-italic ">The articles, to which you allude in </span><span class="slant-italic index-3520 tp-101742 ">the Journal Asiatique</span><span class="slant-italic ">, had not escaped me. I regretted to observe the tone of them. Such is not the spirit, which fellow-labourers in the great cause of Oriental litterature should evince towards each other</span>. Nun stellen Sie sich meine Ataraxie vor: bis jetzt eben, wo ich Ihre Bemerkungen genau von neuem durchging, hatte ich jene kaum flüchtig gelesen. Freilich wußte ich im voraus, daß Chézys Eifersucht zu einer wahren Wuth gesteigert war. Dieses dauert noch immer fort, und ist eine wahre Tragi-Komödie. Seine Absicht war im <span class="slant-italic ">Journal Asiatique</span> mich noch weit gröber anzugreifen, aber Rémusat protestirte nachdrücklich dagegen, und so wurden dem Langlois die Höflichkeiten in seinem ersten Artikel abgedrungen.<br>In <span class="index-292 tp-101743 ">London</span> bat ich Colebrooke, für meine Rechnung Commentare des Bhagavad Gita aus <span class="index-2552 tp-101744 ">Calcutta</span> zu verschreiben. Ich gedachte erst jede Beantwortung der Kritiken bis auf deren Ankunft zu verschieben, weil es sonst gewissermaßen ein Kampf mit ungleichen Waffen ist, da meine Gegner sich immer auf die Autorität des Scholiasten berufen. Indessen, da die Commentare leider nicht ankommen, so werden die Delinquenten doch nun wohl bei den nächsten Assisen vorgenommen werden müssen. Ich besitze nur das 2<span class="offset-4 underline-1 ">te</span> Capitel der Subôdhinê, in meiner eignen Abschrift; und dieses leistet mir schon gute Dienste. Zuverläßig hat Langlois – folglich auch Chézy – den Commentator häufig misverstanden. Er hat <span class="slant-italic ">Cahier</span> 34, <span class="slant-italic ">p</span>. 248 <span class="slant-italic ">ad</span> Bh.G. XI, 22, nicht gemerkt, daß das von ihm abgeschriebene Scholion eine Citation aus <span class="index-3870 tp-101745 ">den Véda’s</span> enthält.<br>Folgendes hätte mir gleich beim Empfange Ihres Schreibens einfallen sollen, und ich hole es mit Beschämung nach. <span class="index-2566 tp-101746 ">Mein Schüler</span> hat einen vollständigen und sauber geschriebenen <span class="slant-italic ">Index Verborum </span>zur Bhagavad Gita verfertigt: könnte dieser Ew. Excellenz bei der Beschäftigung mit dem Inhalte bequem seyn, so bin ich bereit ihn auf eine Zeitlang zu übersenden. Freilich müßte ich ihn bei der Antikritik zur Hand haben, aber diese kann ich wohl vorher abthun.<br>Ich bin fast entschlossen, sie französisch zu schreiben, damit sie doch an die rechte Adresse gelangt.<br>Wenn die Tugend in einer Mitte zwischen zwei Extremen besteht, so übe ich sie beim Briefwechsel gewiß nicht aus, indem ich entweder gar nicht oder endlos lange Briefe schreibe. Ich schließe mit dem Versprechen, mich wo möglich in beiden Punkten zu bessern. Mit unwandelbarer Verehrung und Ergebenheit<br>Ew. Excellenz<br>gehorsamster <br>AWvSchlegel.<br>Eine Sendung von einigen gedruckten Sachen, lateinischen und deutschen, wird hoffentlich richtig angekommen seyn.', 'isaprint' => true, 'isnewtranslation' => false, 'statemsg' => 'betamsg13', 'cittitle' => '', 'description' => 'August Wilhelm von Schlegel an Wilhelm von Humboldt am 21.02.1826, Bonn', 'adressatort' => 'Unknown', 'absendeort' => 'Bonn <a class="gndmetadata" target="_blank" href="http://d-nb.info/gnd/1001909-1">GND</a>', 'date' => '21.02.1826', 'adressat' => array( (int) 2949 => array( 'ID' => '2949', 'project' => '1', 'timecreate' => '2013-10-17 13:02:22', 'timelastchg' => '2018-01-11 15:52:48', 'key' => 'AWS-ap-00av', 'docTyp' => array( [maximum depth reached] ), '39_name' => 'Humboldt, Wilhelm von', '39_geschlecht' => 'm', '39_gebdatum' => '1767-06-22', '39_toddatum' => '1835-04-08', '39_pdb' => 'GND', '39_dbid' => '118554727', '39_quellen' => 'NDB@https://www.deutsche-biographie.de/gnd118554727.html#ndbcontent@ ADB@https://www.deutsche-biographie.de/gnd118554727.html#adbcontent@ WBIS@http://db.saur.de/WBIS/basicSearch.jsf@J023-835-2@ Wikipedia@https://de.wikipedia.org/wiki/Wilhelm_von_Humboldt@', '39_geburtsort' => array( [maximum depth reached] ), '39_sterbeort' => array( [maximum depth reached] ), '39_lebenwirken' => 'Politiker, Sprachforscher, Publizist, Philosoph Wilhelm von Humboldt wuchs auf Schloss Tegel auf, dem Familienbesitz der Humboldts. Ab 1787 studierte Wilhelm zusammen mit seinem Bruder Alexander an der Universität in Frankfurt (Oder) Rechtswissenschaften. Ein Jahr später wechselte er an die Universität Göttingen, wo er den gleichfalls dort studierenden AWS kennenlernte. 1789 führte ihn eine Reise in das revolutionäre Paris. Anfang 1790 trat er nach Beendigung des Studiums in den Staatsdienst und erhielt eine Anstellung im Justizdepartement. 1791 heiratete er Caroline von Dacheröden, die Tochter eines preußischen Kammergerichtsrates. Im selben Jahr schied er aus dem Staatsdienst aus, um auf den Gütern der Familie von Dacheröden seine Studien der altgriechischen Sprache, Kultur, Kunst und Philosophie fortzusetzen. 1794 zog er nach Jena. Humboldt fungierte als konstruktiver Kritiker und gelehrter Ratgeber für die Protagonisten der Weimarer Klassik. Ab November 1797 lebte er in Paris, um seine Studien fortzuführen. Ausgiebige Reisen nach Spanien dienten auch der Erforschung der baskischen Kultur und Sprache. Von 1802 bis 1808 agierte Humboldt als preußischer Gesandter beim Heiligen Stuhl in Rom. Mit der Aufgabe der konsularischen Vertretung war Humboldt zeitlich nicht überfordert, so dass er genug Gelegenheit hatte, seine Studien weiter zu betreiben und sein Domizil zu einem gesellschaftlichen Mittelpunkt zu machen. 1809 wurde er Sektionschef für Kultus und Unterricht im Ministerium des Innern in Berlin. Humboldt galt als liberaler Bildungsreformer. Zu seinen Leistungen gehören ein neu gegliedertes Bildungssystem, das allen Schichten die Möglichkeit des Zugangs zu Bildung zusichern sollte, und die Vereinheitlichung der Abschlussprüfungen. Als weiterer Meilenstein kann Humboldts Beteiligung bei der Gründung der Universität Berlin gelten; zahlreiche renommierte Wissenschaftler konnten für die Lehrstühle gewonnen werden. Die Eröffnung der Universität im Oktober 1810 fand allerdings ohne Humboldt statt. Nach Auseinandersetzungen verließ er den Bildungssektor und ging als preußischer Gesandter nach Wien, später nach London. In dieser Funktion war er am Wiener Kongress beteiligt. 1819 schied er aus dem Staatsdienst aus und beschäftigte sich weiter mit sprachwissenschaftlichen Forschungen, darunter auch dem Sanskrit und dem Kâwi, der Sprache der indonesischen Insel Java. Wilhelms Bruder Alexander von Humboldt war ein bedeutender Naturforscher, die Brüder Humboldt gelten als die „preußischen Dioskuren“.', '39_namevar' => 'Humboldt, Friedrich Wilhelm Christian Karl Ferdinand von Humboldt, Carl W. von Humboldt, Wilhelm F. von Humboldt, Guillaume de Humboldt, Karl W. von Humboldt, Carl Wilhelm von Humboldt, G. de', '39_beziehung' => 'AWS kannte Wilhelm von Humboldt schon aus Göttinger Studentenzeiten, in Jena begegneten sie sich wieder. Schlegel war 1805 Gast Humboldts in Rom, zur Zeit von dessen preußischer Gesandtschaft. Humboldt und AWS korrespondierten auch über ihre sprachwissenschaftlichen Studien, von großer Kenntnis Humboldts zeugen die ausführlichen brieflichen Diskussionen über das Sanskrit. Humboldt steuerte Aufsätze zu Schlegels „Indischer Bibliothek“ bei. Beide Gelehrte begegneten sich mit großem Respekt, auch wenn sie nicht in allen fachlichen Überzeugungen übereinstimmten.', '39_status_person' => 'Vollständig', '39_sourcename0' => 'AWS-ap-00av-0.jpg', 'folders' => array( [maximum depth reached] ), '_label' => '', '_descr' => '', '_model' => 'Person', '_model_title' => 'Person', '_model_titles' => 'People', '_url' => '' ) ), 'adrCitation' => 'Wilhelm von Humboldt', 'absender' => array(), 'absCitation' => 'August Wilhelm von Schlegel', 'percount' => (int) 1, 'notabs' => false, 'tabs' => array( 'text' => array( 'content' => 'Volltext Druck', 'exists' => '1' ), 'druck' => array( 'exists' => '1', 'content' => 'Digitalisat Druck' ) ), 'parallelview' => array( (int) 0 => '1', (int) 1 => '1' ), 'dzi_imagesHand' => array(), 'dzi_imagesDruck' => array( (int) 0 => '/cake_fud/files/temp/images/dzi/AWS-aw-0231-0.jpg.xml', (int) 1 => '/cake_fud/files/temp/images/dzi/AWS-aw-0231-1.jpg.xml', (int) 2 => '/cake_fud/files/temp/images/dzi/AWS-aw-0231-2.jpg.xml', (int) 3 => '/cake_fud/files/temp/images/dzi/AWS-aw-0231-3.jpg.xml', (int) 4 => '/cake_fud/files/temp/images/dzi/AWS-aw-0231-4.jpg.xml', (int) 5 => '/cake_fud/files/temp/images/dzi/AWS-aw-0231-5.jpg.xml', (int) 6 => '/cake_fud/files/temp/images/dzi/AWS-aw-0231-6.jpg.xml', (int) 7 => '/cake_fud/files/temp/images/dzi/AWS-aw-0231-7.jpg.xml', (int) 8 => '/cake_fud/files/temp/images/dzi/AWS-aw-0231-8.jpg.xml', (int) 9 => '/cake_fud/files/temp/images/dzi/AWS-aw-0231-9.jpg.xml' ), 'indexesintext' => array( 'Namen' => array( (int) 0 => array( [maximum depth reached] ), (int) 1 => array( [maximum depth reached] ), (int) 2 => array( [maximum depth reached] ), (int) 3 => array( [maximum depth reached] ), (int) 4 => array( [maximum depth reached] ), (int) 5 => array( [maximum depth reached] ), (int) 6 => array( [maximum depth reached] ), (int) 7 => array( [maximum depth reached] ), (int) 8 => array( [maximum depth reached] ), (int) 9 => array( [maximum depth reached] ), (int) 10 => array( [maximum depth reached] ), (int) 11 => array( [maximum depth reached] ), (int) 12 => array( [maximum depth reached] ), (int) 13 => array( [maximum depth reached] ), (int) 14 => array( [maximum depth reached] ) ), 'Orte' => array( (int) 0 => array( [maximum depth reached] ), (int) 1 => array( [maximum depth reached] ), (int) 2 => array( [maximum depth reached] ) ), 'Werke' => array( (int) 0 => array( [maximum depth reached] ), (int) 1 => array( [maximum depth reached] ), (int) 2 => array( [maximum depth reached] ), (int) 3 => array( [maximum depth reached] ), (int) 4 => array( [maximum depth reached] ), (int) 5 => array( [maximum depth reached] ), (int) 6 => array( [maximum depth reached] ), (int) 7 => array( [maximum depth reached] ), (int) 8 => array( [maximum depth reached] ), (int) 9 => array( [maximum depth reached] ), (int) 10 => array( [maximum depth reached] ) ), 'Periodika' => array( (int) 0 => array( [maximum depth reached] ), (int) 1 => array( [maximum depth reached] ) ) ), 'right' => '', 'left' => 'druck', 'handschrift' => array(), 'druck' => array( 'Bibliographische Angabe' => 'Briefwechsel zwischen Wilhelm von Humboldt und August Wilhelm Schlegel. Hg. v. Albert Leitzmann. Halle 1908, S. 183‒192.', 'Incipit' => '„Bonn den 21sten Februar 1826.<br>Ew. Excellenz haben die gerechteste Ursache von der Welt, ungehalten zu seyn. Daß Sie den Briefwechsel eine [...]“' ), 'docmain' => array( 'ID' => '3165', 'project' => '1', 'timecreate' => '2013-11-12 08:46:40', 'timelastchg' => '2020-03-04 15:25:51', 'key' => 'AWS-aw-0231', 'docTyp' => array( 'name' => 'Brief', 'id' => '36' ), 'index_personen_11' => array( (int) 0 => array( [maximum depth reached] ), (int) 1 => array( [maximum depth reached] ), (int) 2 => array( [maximum depth reached] ), (int) 3 => array( [maximum depth reached] ), (int) 4 => array( [maximum depth reached] ), (int) 5 => array( [maximum depth reached] ), (int) 6 => array( [maximum depth reached] ), (int) 7 => array( [maximum depth reached] ), (int) 8 => array( [maximum depth reached] ), (int) 9 => array( [maximum depth reached] ), (int) 10 => array( [maximum depth reached] ), (int) 11 => array( [maximum depth reached] ), (int) 12 => array( [maximum depth reached] ), (int) 13 => array( [maximum depth reached] ), (int) 14 => array( [maximum depth reached] ) ), 'index_werke_12' => array( (int) 0 => array( [maximum depth reached] ), (int) 1 => array( [maximum depth reached] ), (int) 2 => array( [maximum depth reached] ), (int) 3 => array( [maximum depth reached] ), (int) 4 => array( [maximum depth reached] ), (int) 5 => array( [maximum depth reached] ), (int) 6 => array( [maximum depth reached] ), (int) 7 => array( [maximum depth reached] ), (int) 8 => array( [maximum depth reached] ), (int) 9 => array( [maximum depth reached] ), (int) 10 => array( [maximum depth reached] ) ), 'index_orte_10' => array( (int) 0 => array( [maximum depth reached] ), (int) 1 => array( [maximum depth reached] ), (int) 2 => array( [maximum depth reached] ) ), 'index_periodika_13' => array( (int) 0 => array( [maximum depth reached] ), (int) 1 => array( [maximum depth reached] ) ), '36_html' => '<span class="index-887 tp-101698 ">Bonn</span> den 21sten Februar 1826.<br>Ew. Excellenz haben die gerechteste Ursache von der Welt, ungehalten zu seyn. Daß Sie den Briefwechsel eine Zeitlang hatten ruhen lassen, war ganz in der Ordnung, und Ew. Excellenz durften darüber keine Sylbe verlieren. Ich besitze eine reichhaltige Sammlung Ihrer Briefe, woraus ich oft neue Anregung und Belehrung schöpfe. Jede Bereicherung ist unendlich willkommen. Wenn aber Ew. Excellenz unter so tiefen und weitumfassenden Forschungen, die Sie mit unermüdlicher Thätigkeit verfolgen, keine Muße finden, mir zu schreiben, so bescheide ich mich gern, daß mein persönliches Interesse gegen das allgemeine zurückstehen muß, und bin zufrieden, wenn ich nur auf andern Wegen die Gewißheit von Ihrer ununterbrochenen Heiterkeit und Gesundheit erhalte; und dieß war in jenem Zeitraume der Fall. Daß ich hingegen eine solche Sendung, wie Ihre letzte ist, so lange unbeantwortet lassen konnte, ist unerhört und unverantwortlich. Ich will nicht versuchen, es zu entschuldigen; erklären könnte ich es wohl aus der Beschaffenheit der Störungen, die ununterbrochen auf einander folgten, und mit solchen Studien ganz unverträglich sind. Unter andern mußte ich, gleich nach Empfang <span class="doc-3144 ">Ihres Schreibens</span>, außer dem Rectorat über zwei Monate die Stelle des Regierungs-Bevollmächtigten vertreten. Doch ich müßte meinen ganzen zeitherigen Lebenslauf erzählen, und dieß wäre ein unnützer Zeitverlust. Ich komme lieber gleich zur Hauptsache.<br>Ew. Excellenz können nicht bezweifeln, daß ich mich sehr glücklich schätze, mit <span class="index-9946 tp-101719 ">Ihren Bemerkungen über die Bhagavad Gita</span> <span class="index-2322 tp-101718 ">meine Indische Bibliothek</span> auszuzieren. Das <span class="index-2543 tp-101720 ">meiner Übersetzung</span> ertheilte Lob ist freilich wohl etwas zu stark, um es selbst abdrucken zu lassen: aber wer mag sich entschließen, so etwas auszuschlagen? Nur des Sanskrit kundige Leser können das einzelne verstehen; aber alle denkenden Leser werden bei den vortrefflichen allgemeinen Bemerkungen ihre Rechnung finden. Leider kann ich noch nicht melden, daß an der Indischen Bibliothek wirklich gedruckt wird. Im Kopfe habe ich den Stoff zu mehreren Heften fertig, aber auf dem Papiere sehr weniges. Wie sehr ich gestört gewesen, können Ew. Excellenz eben daraus ermessen, daß ich, ungeachtet des neuen Antriebes, den Ihr Aufsatz mir gab, dennoch kein Heft zu Stande gebracht.<br>Ich war schon lange gesonnen, <span class="weight-bold ">Nachträge zur Kritik und Auslegung der Bhagavad Gita </span>zu geben: da werden sich nun die Ihrigen vortrefflich anschließen. Wäre es aber nicht gut, <span class="index-14597 tp-101722 ">die betreffenden Stellen von </span><span class="index-14597 tp-101722 index-3590 tp-101721 ">Langlois</span> französisch mit abzudrucken? Meine etwanigen Nebenbemerkungen, beistimmend, bestätigend oder bezweifelnd, möchten, wenn Ew. Excellenz es genehmigen, in kleinerer Schrift unter die einzelnen Abschnitte, oder als Noten unter den Text gesetzt werden.<br>Die Erlaubniß, etwas als unrichtig wegzustreichen, ist mir zu bedenklich, um Gebrauch davon zu machen. Wo ich für jetzt nicht beistimmen kann, wird es meistens disputable Punkte betreffen. Indessen lege ich auf einem besondern Blatte einiges vor, was vielleicht Ew. Excellenz zur Zurücknahme oder Modification weniger Zeilen veranlassen könnte, und erwarte darüber Ihre Entscheidung.<br>Kaum wage ich eine schüchterne Bitte um die Auslassung eines einzigen Wortes, welches nur zweimal vorkommt. Es ist das Wort <span class="weight-bold ">pantheistisch</span>. Da hier die Lehre der Bhagavad Gita nicht im Ganzen erörtert wird, so kann es ja entbehrt werden, es dürfte bloß heißen: „in diesem System“. Überdieß steht es bei einem Satze, worin die christlichen Mystiker wohl so ziemlich mit dem Verfasser der Bhagavad Gita übereinstimmen. Hier bildet es ein Präjudiz als ob die Sache schon ausgemacht wäre. Wenn die Behauptung im allgemeinen ausgeführt wird, dann ist es etwas andres. <span class="index-8 tp-101723 ">Mein Bruder</span> hat schon früher die Lehre der Bhagavad Gita für Pantheismus erklärt. Ich habe ihm widersprochen, und behauptet, was ihn hiezu vermocht, seyen starke Ausdrücke von der dynamischen Allgegenwart. Ist zum reinen Theismus durchaus die Lehre von der Extramundanität der Gottheit erfoderlich? Die Immanenz des Weltalls lehrt <span class="index-3764 tp-101724 ">die Bhagavad Gita</span> freilich, unbeschadet der Emanation. Ist es im strengen Pantheismus möglich, die Gottheit von der Natur zu unterscheiden? Hört nicht alle Religion, alles ich und du, zwischen dem Gemüthe und der Gottheit auf? Ist damit die Lehre von der Vermittlung, von einer Herablassung der Gottheit um die Creatur zu sich heraufzuziehen, verträglich, welche doch so klar in der Bhagavad Gita vorgetragen wird? Ich habe ehemals die Schriften der Mystiker viel gelesen: mich dünkt, sie theilen sich in zwei Hauptclassen, die Theosophen und die Mystiker des Gefühls. Meines Erachtens stimmt mein Indischer Weiser so ziemlich mit den theosophischen Mystikern überein; weniger mit den letzteren, weil bei diesen der Sinn für die Natur ganz erloschen ist, welcher bei ihm in ursprünglicher mythologischer Fülle lebt.<br>Bei den scharfsinnigen Bemerkungen über die Bildung des philosophischen Sprachgebrauchs wage ich es, folgendes Ihrer Beurtheilung vorzulegen. In der Regel sind freilich die metaphysischen Ausdrücke von sinnlichen Vorstellungen übertragen; sollte es nicht aber auch in einigen Sprachen, und namentlich im Sanskrit, ursprünglich metaphysische Wörter geben? Z. B. <span class="slant-italic ">dēha</span> von <span class="slant-italic ">dih</span>, wie <span class="slant-italic ">dēs͗a</span> von <span class="slant-italic ">dis͗</span>, ganz etymologisch richtig. Nun heißt aber <span class="slant-italic ">dih</span> beschmieren, beflecken, besudeln. <span class="index-2553 tp-101747 ">Wilson</span> giebt zwar eine zweite Bedeutung, von der er es ableiten will. Aber ich kann mich nicht erinnern, das Verbum und insbesondre das häufige Participium <span class="slant-italic ">digdha</span> jemals anders als in der obigen Bedeutung gefunden zu haben. Auch steht in <span class="index-7022 tp-101726 ">dem Wurzel-Wörterbuch</span> bei <span class="index-3715 tp-101725 ">Carey</span> bloß <span class="slant-italic ">lipi</span>, in <span class="index-5662 tp-101728 ">der Englischen Übersetzung</span> bei <span class="index-3481 tp-101727 ">Wilkins</span> ebenfalls. Wunderlich genug steht aber dabei bloß Eine mit seiner Auslegung gar nicht übereinstimmende Definition <span class="slant-italic ">upachayē</span>, welches die zweite Bedeutung von Wilson ist. Wieder einmal ein Beispiel, wie unsere Elementar-Bücher noch beschaffen sind, und wie man sich überall selbst helfen, und die Augen offen haben muß! Wenn die zweite Bedeutung sich nicht praktisch bewährt, so bin ich sehr geneigt zu glauben, sie sei bloß von Indischen Grammatikern zum Behuf der Ableitung von <span class="slant-italic ">dēha</span> ersonnen. Ist es aber von <span class="slant-italic ">dih</span> in der Bedeutung von <span class="slant-italic ">lipi</span>, so liegt ja in dem einfachen Worte, wie im Keim, die ganze <span class="index-146 tp-101729 ">Platonische</span> Lehre. Auch die andre Ableitung hat schon etwas wissenschaftliches. – Wie dem aber auch sei, das ist gewiß, daß bei den Indiern die Speculation so uralt und ihr Einfluß so überwiegend war, daß der metaphysische Sprachgebrauch in das Leben, wenigstens in die epische Poesie zurückgekehrt ist, und diese Erscheinung ist einzig in ihrer Art.<br>Meine Ansicht hängt freilich mit andern vielleicht paradoxen und deswegen besser esoterisch bleibenden Meynungen zusammen. Ich glaube nämlich, daß es ursprünglich tellurische, siderische und spirituale Sprachen giebt. Dieß würde auf die Eintheilung nach den drei <span class="slant-italic ">gûńa</span>’s hinauslaufen. Reine Exemplare von den drei Gattungen lassen sich freilich nicht nachweisen, man dürfte aber wohl versuchen, die Sprachen nach dem vorwaltenden Prinzip zu classifiziren.<br>Während ich dieses schrieb, empfing ich <span class="index-20049 tp-101730 ">Ihre Abhandlung über die Buchstabenschrift</span>, die ich sogleich verschlungen habe. In der Hauptsache bin ich ganz einverstanden. Mein einziger Zweifel ist nur der, ob nicht jene urweltliche Genialität, die bei der Erfindung der Buchstabenschrift gewaltet, jenes klare Bewußtseyn von den mit den Sprachorganen vorgenommenen und möglicher Weise vorzunehmenden Handlungen, von der symbolischen Bedeutung der Laute, ihrer Beziehung zu einander u. s. w.; ob, sage ich, jenes der Sprache bei ihrer Ausbildung nicht dieselben Dienste habe leisten können, als das materielle Vorhandenseyn der Buchstabenschrift?<br>Die Abweichung unsrer Ansichten – ich sage es mit Mistrauen gegen meine eigne Meynung – bezieht sich auf den Ursprung, und den frühesten Gang der menschlichen Cultur. Ich kann unmöglich die ersten großen Grundlagen als den späten und allmähligen Erfolg eines experimentirenden Herumtappens betrachten; sie scheinen mir ein genialischer Wurf zu seyn, wo alles mit Einemmale da ist, wie beim Anfange des organischen Lebens. Die Urväter des Menschengeschlechtes – einige, nicht alle; denn ich fürchte, ich bin in der dreifachen Ketzerei begriffen, ein Präadamit, ein Coadamit und ein Postadamit zu seyn – vergleiche ich mit Menschen, welche die Fähigkeit besessen hätten, in einem dunkeln Schacht durch die Kraft ihrer eignen Augen zu sehen, während unsre Bergleute sich der Lampen und Laternen bedienen müssen. <span class="index-942 tp-101731 ">Julius Caesar</span> sagte, die Schrift habe das Gedächtniß zu Grunde gerichtet. Ist es nicht mit allen Dingen so? Je vollkommner die Hülfsmittel, desto mehr erlischt der inwohnende Sinn, das angebohrne Talent. Divinatorische Durchschauung der Natur, und von außen her erworbene Erfahrung scheinen mir die beiden Pole der menschlichen Cultur zu seyn; jenes der positive, dieses der negative. Wenn einmal in einem Zeitalter, wo das letzte Princip herrschend ist, jenes durchblitzt, so nimmt selbst das Experiment einen neuen Schwung, und die mechanischen Physiker, welche die Ideen läugnen, werden mehr von ihnen geleitet, als sie selbst wissen.<br>Um auf die Buchstabenschrift zurückzukommen, sie wäre also – da ihr Wesen in der Analyse der articulirten Laute besteht – <span class="slant-italic ">virtualiter</span> schon in der ältesten Zeit vorhanden gewesen, wenn es auch an zubereiteten Stoffen fehlte, um sie in Ausübung zu bringen.<br>Auch darin bin ich ganz einverstanden, daß eine gewisse todte und einförmige Regelmäßigkeit gar keine Vollkommenheit der Sprachen ist. <span class="index-113 tp-101732 ">Adelung</span> hatte ganz richtig bemerkt, daß in der Deutschen Sprache die starke Conjugation (nach ihm die anomale) der schwachen mehr und mehr Platz einräume. Aber der geistlose Grammatiker hielt dieß für eine Vervollkommung, während es doch nur eine Abstumpfung ist. Die Mannigfaltigkeit der Formen, zB. der Declinationen und Conjugationen scheint mir, wenigstens imaginativ, bedeutsam gewesen zu seyn, was nachher verloren ging. <span class="index-1899 tp-101733 ">Grimm</span> betrachtet alle Anomalien als später und zufällig entstanden. Dieses gilt von den meisten, aber ich muß auch ursprüngliche, symbolische Anomalien annehmen, z. B. die der Personal-Pronomina in unsrer Sprachfamilie, und diesen Gesichtspunkt vermißte ich in <span class="index-2426 tp-101734 ">Bopps</span> <span class="index-9960 tp-101735 ">sonst vortrefflicher Abhandlung</span>. Eben so ist es mit der <span class="weight-bold ">grammatischen Homonymie</span>, wenn nämlich ganz verschiedene Biegungen gleich lauten. Dieses Gebrechen entsteht meistens aus der Abstumpfung, und nimmt daher bei nicht fixirten Sprachen, wie bisher bei der unsrigen, immer zu. Sollte es nicht aber auch ursprüngliche grammatische Homonymien geben, die symbolisch sind? ZB. logisch betrachtet ist es gleichgültig ob Subject und Object belebte Wesen oder unbelebte Dinge sind; imaginativ aber keinesweges, denn das Unbelebte handelt und leidet nicht eigentlich: es wirkt und erfährt Wirkungen. Diese neutrale Stellung wird nun durch die Gleichheit des Accusativus und Nominativus der Neutra [angedeutet], welche deswegen im Sanskrit, im Griechischen und Lateinischen eine wahre Schönheit ist. Im Deutschen ist es keine Schönheit mehr, weil so viele masculina und sämtliche feminina diese Eigenschaft mit den neutris gemein haben.<br>Ich kehre von meinen endlosen Abschweifungen zurück, um zu <span class="index-20049 tp-101736 ">Ihrer Abhandlung</span> eine kleine historische Bemerkung nachzutragen. Sie bemerken <span class="slant-italic ">p</span>. 1, daß die Chinesen die Europäische Buchstabenschrift verschmäht haben. Aber die Unmöglichkeit, sie ihrer Sprache anzueignen, erhellet doch noch weit stärker aus der unläugbaren Thatsache, daß die Indische Buchstabenschrift von den ersten Buddhistischen Missionaren überbracht worden war. <span class="index-3543 tp-101737 ">Rémusat</span> hat in <span class="index-20067 tp-101773 ">einem eignen Aufsatze</span>, ich weiß nicht mehr in <span class="index-5233 tp-101774 ">welcher Zeitschrift</span>, die Weise geschildert, wie ein chinesischer Autor von dieser fremden Theorie der Laute Rechenschaft giebt. <span class="index-19507 tp-101738 ">Der Baron Schilling von Canstadt</span> hat mir ein chinesisches Buch gezeigt, wo in einer Columne indische Sylben standen, in der nächsten die Lautbezeichnung, in chinesischer Schrift, in einer dritten die Bedeutung. Ohne Zweifel waren es <span class="slant-italic ">mantra</span>’s, ich hatte nicht Muße es näher zu untersuchen.<br>Nun noch einiges über meine französischen Kritiker und meine zu machenden Antikritiken. Wird es Ew. Excellenz unangenehm seyn, wenn ich in der Nachbarschaft Ihres so milden und ruhigen Aufsatzes mir einigen Spott über <span class="index-900 tp-101739 ">Chézy</span> und <span class="index-3590 tp-101740 ">Langlois</span> erlaube? Nach Ihrer gütigen Gesinnung für mich hatten die Artikel des letzteren Sie indignirt, und Sie hatten die magistrale Recension noch nicht gelesen. Auf <span class="index-2385 tp-101741 ">Colebrooke</span> haben sie denselben Eindruck gemacht. Er <span class="doc-4128 ">schrieb mir</span>: <span class="slant-italic ">The articles, to which you allude in </span><span class="slant-italic index-3520 tp-101742 ">the Journal Asiatique</span><span class="slant-italic ">, had not escaped me. I regretted to observe the tone of them. Such is not the spirit, which fellow-labourers in the great cause of Oriental litterature should evince towards each other</span>. Nun stellen Sie sich meine Ataraxie vor: bis jetzt eben, wo ich Ihre Bemerkungen genau von neuem durchging, hatte ich jene kaum flüchtig gelesen. Freilich wußte ich im voraus, daß Chézys Eifersucht zu einer wahren Wuth gesteigert war. Dieses dauert noch immer fort, und ist eine wahre Tragi-Komödie. Seine Absicht war im <span class="slant-italic ">Journal Asiatique</span> mich noch weit gröber anzugreifen, aber Rémusat protestirte nachdrücklich dagegen, und so wurden dem Langlois die Höflichkeiten in seinem ersten Artikel abgedrungen.<br>In <span class="index-292 tp-101743 ">London</span> bat ich Colebrooke, für meine Rechnung Commentare des Bhagavad Gita aus <span class="index-2552 tp-101744 ">Calcutta</span> zu verschreiben. Ich gedachte erst jede Beantwortung der Kritiken bis auf deren Ankunft zu verschieben, weil es sonst gewissermaßen ein Kampf mit ungleichen Waffen ist, da meine Gegner sich immer auf die Autorität des Scholiasten berufen. Indessen, da die Commentare leider nicht ankommen, so werden die Delinquenten doch nun wohl bei den nächsten Assisen vorgenommen werden müssen. Ich besitze nur das 2<span class="offset-4 underline-1 ">te</span> Capitel der Subôdhinê, in meiner eignen Abschrift; und dieses leistet mir schon gute Dienste. Zuverläßig hat Langlois – folglich auch Chézy – den Commentator häufig misverstanden. Er hat <span class="slant-italic ">Cahier</span> 34, <span class="slant-italic ">p</span>. 248 <span class="slant-italic ">ad</span> Bh.G. XI, 22, nicht gemerkt, daß das von ihm abgeschriebene Scholion eine Citation aus <span class="index-3870 tp-101745 ">den Véda’s</span> enthält.<br>Folgendes hätte mir gleich beim Empfange Ihres Schreibens einfallen sollen, und ich hole es mit Beschämung nach. <span class="index-2566 tp-101746 ">Mein Schüler</span> hat einen vollständigen und sauber geschriebenen <span class="slant-italic ">Index Verborum </span>zur Bhagavad Gita verfertigt: könnte dieser Ew. Excellenz bei der Beschäftigung mit dem Inhalte bequem seyn, so bin ich bereit ihn auf eine Zeitlang zu übersenden. Freilich müßte ich ihn bei der Antikritik zur Hand haben, aber diese kann ich wohl vorher abthun.<br>Ich bin fast entschlossen, sie französisch zu schreiben, damit sie doch an die rechte Adresse gelangt.<br>Wenn die Tugend in einer Mitte zwischen zwei Extremen besteht, so übe ich sie beim Briefwechsel gewiß nicht aus, indem ich entweder gar nicht oder endlos lange Briefe schreibe. Ich schließe mit dem Versprechen, mich wo möglich in beiden Punkten zu bessern. Mit unwandelbarer Verehrung und Ergebenheit<br>Ew. Excellenz<br>gehorsamster <br>AWvSchlegel.<br>Eine Sendung von einigen gedruckten Sachen, lateinischen und deutschen, wird hoffentlich richtig angekommen seyn.', '36_xml' => '<p><placeName key="887">Bonn</placeName> den 21sten Februar 1826.<lb/>Ew. Excellenz haben die gerechteste Ursache von der Welt, ungehalten zu seyn. Daß Sie den Briefwechsel eine Zeitlang hatten ruhen lassen, war ganz in der Ordnung, und Ew. Excellenz durften darüber keine Sylbe verlieren. Ich besitze eine reichhaltige Sammlung Ihrer Briefe, woraus ich oft neue Anregung und Belehrung schöpfe. Jede Bereicherung ist unendlich willkommen. Wenn aber Ew. Excellenz unter so tiefen und weitumfassenden Forschungen, die Sie mit unermüdlicher Thätigkeit verfolgen, keine Muße finden, mir zu schreiben, so bescheide ich mich gern, daß mein persönliches Interesse gegen das allgemeine zurückstehen muß, und bin zufrieden, wenn ich nur auf andern Wegen die Gewißheit von Ihrer ununterbrochenen Heiterkeit und Gesundheit erhalte; und dieß war in jenem Zeitraume der Fall. Daß ich hingegen eine solche Sendung, wie Ihre letzte ist, so lange unbeantwortet lassen konnte, ist unerhört und unverantwortlich. Ich will nicht versuchen, es zu entschuldigen; erklären könnte ich es wohl aus der Beschaffenheit der Störungen, die ununterbrochen auf einander folgten, und mit solchen Studien ganz unverträglich sind. Unter andern mußte ich, gleich nach Empfang <ref target="fud://3144">Ihres Schreibens</ref>, außer dem Rectorat über zwei Monate die Stelle des Regierungs-Bevollmächtigten vertreten. Doch ich müßte meinen ganzen zeitherigen Lebenslauf erzählen, und dieß wäre ein unnützer Zeitverlust. Ich komme lieber gleich zur Hauptsache.<lb/>Ew. Excellenz können nicht bezweifeln, daß ich mich sehr glücklich schätze, mit <name key="9946" type="work">Ihren Bemerkungen über die Bhagavad Gita</name> <name key="2322" type="periodical">meine Indische Bibliothek</name> auszuzieren. Das <name key="2543" type="work">meiner Übersetzung</name> ertheilte Lob ist freilich wohl etwas zu stark, um es selbst abdrucken zu lassen: aber wer mag sich entschließen, so etwas auszuschlagen? Nur des Sanskrit kundige Leser können das einzelne verstehen; aber alle denkenden Leser werden bei den vortrefflichen allgemeinen Bemerkungen ihre Rechnung finden. Leider kann ich noch nicht melden, daß an der Indischen Bibliothek wirklich gedruckt wird. Im Kopfe habe ich den Stoff zu mehreren Heften fertig, aber auf dem Papiere sehr weniges. Wie sehr ich gestört gewesen, können Ew. Excellenz eben daraus ermessen, daß ich, ungeachtet des neuen Antriebes, den Ihr Aufsatz mir gab, dennoch kein Heft zu Stande gebracht.<lb/>Ich war schon lange gesonnen, <hi rend="weight:bold">Nachträge zur Kritik und Auslegung der Bhagavad Gita </hi>zu geben: da werden sich nun die Ihrigen vortrefflich anschließen. Wäre es aber nicht gut, <name key="14597" type="work">die betreffenden Stellen von <persName key="3590">Langlois</persName></name> französisch mit abzudrucken? Meine etwanigen Nebenbemerkungen, beistimmend, bestätigend oder bezweifelnd, möchten, wenn Ew. Excellenz es genehmigen, in kleinerer Schrift unter die einzelnen Abschnitte, oder als Noten unter den Text gesetzt werden.<lb/>Die Erlaubniß, etwas als unrichtig wegzustreichen, ist mir zu bedenklich, um Gebrauch davon zu machen. Wo ich für jetzt nicht beistimmen kann, wird es meistens disputable Punkte betreffen. Indessen lege ich auf einem besondern Blatte einiges vor, was vielleicht Ew. Excellenz zur Zurücknahme oder Modification weniger Zeilen veranlassen könnte, und erwarte darüber Ihre Entscheidung.<lb/>Kaum wage ich eine schüchterne Bitte um die Auslassung eines einzigen Wortes, welches nur zweimal vorkommt. Es ist das Wort <hi rend="weight:bold">pantheistisch</hi>. Da hier die Lehre der Bhagavad Gita nicht im Ganzen erörtert wird, so kann es ja entbehrt werden, es dürfte bloß heißen: „in diesem System“. Überdieß steht es bei einem Satze, worin die christlichen Mystiker wohl so ziemlich mit dem Verfasser der Bhagavad Gita übereinstimmen. Hier bildet es ein Präjudiz als ob die Sache schon ausgemacht wäre. Wenn die Behauptung im allgemeinen ausgeführt wird, dann ist es etwas andres. <persName key="8">Mein Bruder</persName> hat schon früher die Lehre der Bhagavad Gita für Pantheismus erklärt. Ich habe ihm widersprochen, und behauptet, was ihn hiezu vermocht, seyen starke Ausdrücke von der dynamischen Allgegenwart. Ist zum reinen Theismus durchaus die Lehre von der Extramundanität der Gottheit erfoderlich? Die Immanenz des Weltalls lehrt <name key="3764" type="work">die Bhagavad Gita</name> freilich, unbeschadet der Emanation. Ist es im strengen Pantheismus möglich, die Gottheit von der Natur zu unterscheiden? Hört nicht alle Religion, alles ich und du, zwischen dem Gemüthe und der Gottheit auf? Ist damit die Lehre von der Vermittlung, von einer Herablassung der Gottheit um die Creatur zu sich heraufzuziehen, verträglich, welche doch so klar in der Bhagavad Gita vorgetragen wird? Ich habe ehemals die Schriften der Mystiker viel gelesen: mich dünkt, sie theilen sich in zwei Hauptclassen, die Theosophen und die Mystiker des Gefühls. Meines Erachtens stimmt mein Indischer Weiser so ziemlich mit den theosophischen Mystikern überein; weniger mit den letzteren, weil bei diesen der Sinn für die Natur ganz erloschen ist, welcher bei ihm in ursprünglicher mythologischer Fülle lebt.<lb/>Bei den scharfsinnigen Bemerkungen über die Bildung des philosophischen Sprachgebrauchs wage ich es, folgendes Ihrer Beurtheilung vorzulegen. In der Regel sind freilich die metaphysischen Ausdrücke von sinnlichen Vorstellungen übertragen; sollte es nicht aber auch in einigen Sprachen, und namentlich im Sanskrit, ursprünglich metaphysische Wörter geben? Z. B. <hi rend="slant:italic">dēha</hi> von <hi rend="slant:italic">dih</hi>, wie <hi rend="slant:italic">dēs͗a</hi> von <hi rend="slant:italic">dis͗</hi>, ganz etymologisch richtig. Nun heißt aber <hi rend="slant:italic">dih</hi> beschmieren, beflecken, besudeln. <persName key="2553">Wilson</persName> giebt zwar eine zweite Bedeutung, von der er es ableiten will. Aber ich kann mich nicht erinnern, das Verbum und insbesondre das häufige Participium <hi rend="slant:italic">digdha</hi> jemals anders als in der obigen Bedeutung gefunden zu haben. Auch steht in <name key="7022" type="work">dem Wurzel-Wörterbuch</name> bei <persName key="3715">Carey</persName> bloß <hi rend="slant:italic">lipi</hi>, in <name key="5662" type="work">der Englischen Übersetzung</name> bei <persName key="3481">Wilkins</persName> ebenfalls. Wunderlich genug steht aber dabei bloß Eine mit seiner Auslegung gar nicht übereinstimmende Definition <hi rend="slant:italic">upachayē</hi>, welches die zweite Bedeutung von Wilson ist. Wieder einmal ein Beispiel, wie unsere Elementar-Bücher noch beschaffen sind, und wie man sich überall selbst helfen, und die Augen offen haben muß! Wenn die zweite Bedeutung sich nicht praktisch bewährt, so bin ich sehr geneigt zu glauben, sie sei bloß von Indischen Grammatikern zum Behuf der Ableitung von <hi rend="slant:italic">dēha</hi> ersonnen. Ist es aber von <hi rend="slant:italic">dih</hi> in der Bedeutung von <hi rend="slant:italic">lipi</hi>, so liegt ja in dem einfachen Worte, wie im Keim, die ganze <persName key="146">Platonische</persName> Lehre. Auch die andre Ableitung hat schon etwas wissenschaftliches. – Wie dem aber auch sei, das ist gewiß, daß bei den Indiern die Speculation so uralt und ihr Einfluß so überwiegend war, daß der metaphysische Sprachgebrauch in das Leben, wenigstens in die epische Poesie zurückgekehrt ist, und diese Erscheinung ist einzig in ihrer Art.<lb/>Meine Ansicht hängt freilich mit andern vielleicht paradoxen und deswegen besser esoterisch bleibenden Meynungen zusammen. Ich glaube nämlich, daß es ursprünglich tellurische, siderische und spirituale Sprachen giebt. Dieß würde auf die Eintheilung nach den drei <hi rend="slant:italic">gûńa</hi>’s hinauslaufen. Reine Exemplare von den drei Gattungen lassen sich freilich nicht nachweisen, man dürfte aber wohl versuchen, die Sprachen nach dem vorwaltenden Prinzip zu classifiziren.<lb/>Während ich dieses schrieb, empfing ich <name key="20049" type="work">Ihre Abhandlung über die Buchstabenschrift</name>, die ich sogleich verschlungen habe. In der Hauptsache bin ich ganz einverstanden. Mein einziger Zweifel ist nur der, ob nicht jene urweltliche Genialität, die bei der Erfindung der Buchstabenschrift gewaltet, jenes klare Bewußtseyn von den mit den Sprachorganen vorgenommenen und möglicher Weise vorzunehmenden Handlungen, von der symbolischen Bedeutung der Laute, ihrer Beziehung zu einander u. s. w.; ob, sage ich, jenes der Sprache bei ihrer Ausbildung nicht dieselben Dienste habe leisten können, als das materielle Vorhandenseyn der Buchstabenschrift?<lb/>Die Abweichung unsrer Ansichten – ich sage es mit Mistrauen gegen meine eigne Meynung – bezieht sich auf den Ursprung, und den frühesten Gang der menschlichen Cultur. Ich kann unmöglich die ersten großen Grundlagen als den späten und allmähligen Erfolg eines experimentirenden Herumtappens betrachten; sie scheinen mir ein genialischer Wurf zu seyn, wo alles mit Einemmale da ist, wie beim Anfange des organischen Lebens. Die Urväter des Menschengeschlechtes – einige, nicht alle; denn ich fürchte, ich bin in der dreifachen Ketzerei begriffen, ein Präadamit, ein Coadamit und ein Postadamit zu seyn – vergleiche ich mit Menschen, welche die Fähigkeit besessen hätten, in einem dunkeln Schacht durch die Kraft ihrer eignen Augen zu sehen, während unsre Bergleute sich der Lampen und Laternen bedienen müssen. <persName key="942">Julius Caesar</persName> sagte, die Schrift habe das Gedächtniß zu Grunde gerichtet. Ist es nicht mit allen Dingen so? Je vollkommner die Hülfsmittel, desto mehr erlischt der inwohnende Sinn, das angebohrne Talent. Divinatorische Durchschauung der Natur, und von außen her erworbene Erfahrung scheinen mir die beiden Pole der menschlichen Cultur zu seyn; jenes der positive, dieses der negative. Wenn einmal in einem Zeitalter, wo das letzte Princip herrschend ist, jenes durchblitzt, so nimmt selbst das Experiment einen neuen Schwung, und die mechanischen Physiker, welche die Ideen läugnen, werden mehr von ihnen geleitet, als sie selbst wissen.<lb/>Um auf die Buchstabenschrift zurückzukommen, sie wäre also – da ihr Wesen in der Analyse der articulirten Laute besteht – <hi rend="slant:italic">virtualiter</hi> schon in der ältesten Zeit vorhanden gewesen, wenn es auch an zubereiteten Stoffen fehlte, um sie in Ausübung zu bringen.<lb/>Auch darin bin ich ganz einverstanden, daß eine gewisse todte und einförmige Regelmäßigkeit gar keine Vollkommenheit der Sprachen ist. <persName key="113">Adelung</persName> hatte ganz richtig bemerkt, daß in der Deutschen Sprache die starke Conjugation (nach ihm die anomale) der schwachen mehr und mehr Platz einräume. Aber der geistlose Grammatiker hielt dieß für eine Vervollkommung, während es doch nur eine Abstumpfung ist. Die Mannigfaltigkeit der Formen, zB. der Declinationen und Conjugationen scheint mir, wenigstens imaginativ, bedeutsam gewesen zu seyn, was nachher verloren ging. <persName key="1899">Grimm</persName> betrachtet alle Anomalien als später und zufällig entstanden. Dieses gilt von den meisten, aber ich muß auch ursprüngliche, symbolische Anomalien annehmen, z. B. die der Personal-Pronomina in unsrer Sprachfamilie, und diesen Gesichtspunkt vermißte ich in <persName key="2426">Bopps</persName> <name key="9960" type="work">sonst vortrefflicher Abhandlung</name>. Eben so ist es mit der <hi rend="weight:bold">grammatischen Homonymie</hi>, wenn nämlich ganz verschiedene Biegungen gleich lauten. Dieses Gebrechen entsteht meistens aus der Abstumpfung, und nimmt daher bei nicht fixirten Sprachen, wie bisher bei der unsrigen, immer zu. Sollte es nicht aber auch ursprüngliche grammatische Homonymien geben, die symbolisch sind? ZB. logisch betrachtet ist es gleichgültig ob Subject und Object belebte Wesen oder unbelebte Dinge sind; imaginativ aber keinesweges, denn das Unbelebte handelt und leidet nicht eigentlich: es wirkt und erfährt Wirkungen. Diese neutrale Stellung wird nun durch die Gleichheit des Accusativus und Nominativus der Neutra [angedeutet], welche deswegen im Sanskrit, im Griechischen und Lateinischen eine wahre Schönheit ist. Im Deutschen ist es keine Schönheit mehr, weil so viele masculina und sämtliche feminina diese Eigenschaft mit den neutris gemein haben.<lb/>Ich kehre von meinen endlosen Abschweifungen zurück, um zu <name key="20049" type="work">Ihrer Abhandlung</name> eine kleine historische Bemerkung nachzutragen. Sie bemerken <hi rend="slant:italic">p</hi>. 1, daß die Chinesen die Europäische Buchstabenschrift verschmäht haben. Aber die Unmöglichkeit, sie ihrer Sprache anzueignen, erhellet doch noch weit stärker aus der unläugbaren Thatsache, daß die Indische Buchstabenschrift von den ersten Buddhistischen Missionaren überbracht worden war. <persName key="3543">Rémusat</persName> hat in <name key="20067" type="work">einem eignen Aufsatze</name>, ich weiß nicht mehr in <name key="5233" type="work">welcher Zeitschrift</name>, die Weise geschildert, wie ein chinesischer Autor von dieser fremden Theorie der Laute Rechenschaft giebt. <persName key="19507">Der Baron Schilling von Canstadt</persName> hat mir ein chinesisches Buch gezeigt, wo in einer Columne indische Sylben standen, in der nächsten die Lautbezeichnung, in chinesischer Schrift, in einer dritten die Bedeutung. Ohne Zweifel waren es <hi rend="slant:italic">mantra</hi>’s, ich hatte nicht Muße es näher zu untersuchen.<lb/>Nun noch einiges über meine französischen Kritiker und meine zu machenden Antikritiken. Wird es Ew. Excellenz unangenehm seyn, wenn ich in der Nachbarschaft Ihres so milden und ruhigen Aufsatzes mir einigen Spott über <persName key="900">Chézy</persName> und <persName key="3590">Langlois</persName> erlaube? Nach Ihrer gütigen Gesinnung für mich hatten die Artikel des letzteren Sie indignirt, und Sie hatten die magistrale Recension noch nicht gelesen. Auf <persName key="2385">Colebrooke</persName> haben sie denselben Eindruck gemacht. Er <ref target="fud://4128">schrieb mir</ref>: <hi rend="slant:italic">The articles, to which you allude in <name key="3520" type="periodical">the Journal Asiatique</name>, had not escaped me. I regretted to observe the tone of them. Such is not the spirit, which fellow-labourers in the great cause of Oriental litterature should evince towards each other</hi>. Nun stellen Sie sich meine Ataraxie vor: bis jetzt eben, wo ich Ihre Bemerkungen genau von neuem durchging, hatte ich jene kaum flüchtig gelesen. Freilich wußte ich im voraus, daß Chézys Eifersucht zu einer wahren Wuth gesteigert war. Dieses dauert noch immer fort, und ist eine wahre Tragi-Komödie. Seine Absicht war im <hi rend="slant:italic">Journal Asiatique</hi> mich noch weit gröber anzugreifen, aber Rémusat protestirte nachdrücklich dagegen, und so wurden dem Langlois die Höflichkeiten in seinem ersten Artikel abgedrungen.<lb/>In <placeName key="292">London</placeName> bat ich Colebrooke, für meine Rechnung Commentare des Bhagavad Gita aus <placeName key="2552">Calcutta</placeName> zu verschreiben. Ich gedachte erst jede Beantwortung der Kritiken bis auf deren Ankunft zu verschieben, weil es sonst gewissermaßen ein Kampf mit ungleichen Waffen ist, da meine Gegner sich immer auf die Autorität des Scholiasten berufen. Indessen, da die Commentare leider nicht ankommen, so werden die Delinquenten doch nun wohl bei den nächsten Assisen vorgenommen werden müssen. Ich besitze nur das 2<hi rend="offset:4;underline:1">te</hi> Capitel der Subôdhinê, in meiner eignen Abschrift; und dieses leistet mir schon gute Dienste. Zuverläßig hat Langlois – folglich auch Chézy – den Commentator häufig misverstanden. Er hat <hi rend="slant:italic">Cahier</hi> 34, <hi rend="slant:italic">p</hi>. 248 <hi rend="slant:italic">ad</hi> Bh.G. XI, 22, nicht gemerkt, daß das von ihm abgeschriebene Scholion eine Citation aus <name key="3870" type="work">den Véda’s</name> enthält.<lb/>Folgendes hätte mir gleich beim Empfange Ihres Schreibens einfallen sollen, und ich hole es mit Beschämung nach. <persName key="2566">Mein Schüler</persName> hat einen vollständigen und sauber geschriebenen <hi rend="slant:italic">Index Verborum </hi>zur Bhagavad Gita verfertigt: könnte dieser Ew. Excellenz bei der Beschäftigung mit dem Inhalte bequem seyn, so bin ich bereit ihn auf eine Zeitlang zu übersenden. Freilich müßte ich ihn bei der Antikritik zur Hand haben, aber diese kann ich wohl vorher abthun.<lb/>Ich bin fast entschlossen, sie französisch zu schreiben, damit sie doch an die rechte Adresse gelangt.<lb/>Wenn die Tugend in einer Mitte zwischen zwei Extremen besteht, so übe ich sie beim Briefwechsel gewiß nicht aus, indem ich entweder gar nicht oder endlos lange Briefe schreibe. Ich schließe mit dem Versprechen, mich wo möglich in beiden Punkten zu bessern. Mit unwandelbarer Verehrung und Ergebenheit<lb/>Ew. Excellenz<lb/>gehorsamster <lb/>AWvSchlegel.<lb/>Eine Sendung von einigen gedruckten Sachen, lateinischen und deutschen, wird hoffentlich richtig angekommen seyn.</p>', '36_xml_standoff' => '<anchor type="b" n="887" ana="10" xml:id="NidB101698"/>Bonn<anchor type="e" n="887" ana="10" xml:id="NidE101698"/> den 21sten Februar 1826.<lb/>Ew. Excellenz haben die gerechteste Ursache von der Welt, ungehalten zu seyn. Daß Sie den Briefwechsel eine Zeitlang hatten ruhen lassen, war ganz in der Ordnung, und Ew. Excellenz durften darüber keine Sylbe verlieren. Ich besitze eine reichhaltige Sammlung Ihrer Briefe, woraus ich oft neue Anregung und Belehrung schöpfe. Jede Bereicherung ist unendlich willkommen. Wenn aber Ew. Excellenz unter so tiefen und weitumfassenden Forschungen, die Sie mit unermüdlicher Thätigkeit verfolgen, keine Muße finden, mir zu schreiben, so bescheide ich mich gern, daß mein persönliches Interesse gegen das allgemeine zurückstehen muß, und bin zufrieden, wenn ich nur auf andern Wegen die Gewißheit von Ihrer ununterbrochenen Heiterkeit und Gesundheit erhalte; und dieß war in jenem Zeitraume der Fall. Daß ich hingegen eine solche Sendung, wie Ihre letzte ist, so lange unbeantwortet lassen konnte, ist unerhört und unverantwortlich. Ich will nicht versuchen, es zu entschuldigen; erklären könnte ich es wohl aus der Beschaffenheit der Störungen, die ununterbrochen auf einander folgten, und mit solchen Studien ganz unverträglich sind. Unter andern mußte ich, gleich nach Empfang <ref target="fud://3144">Ihres Schreibens</ref>, außer dem Rectorat über zwei Monate die Stelle des Regierungs-Bevollmächtigten vertreten. Doch ich müßte meinen ganzen zeitherigen Lebenslauf erzählen, und dieß wäre ein unnützer Zeitverlust. Ich komme lieber gleich zur Hauptsache.<lb/>Ew. Excellenz können nicht bezweifeln, daß ich mich sehr glücklich schätze, mit <anchor type="b" n="9946" ana="12" xml:id="NidB101719"/>Ihren Bemerkungen über die Bhagavad Gita<anchor type="e" n="9946" ana="12" xml:id="NidE101719"/> <anchor type="b" n="2322" ana="13" xml:id="NidB101718"/>meine Indische Bibliothek<anchor type="e" n="2322" ana="13" xml:id="NidE101718"/> auszuzieren. Das <anchor type="b" n="2543" ana="12" xml:id="NidB101720"/>meiner Übersetzung<anchor type="e" n="2543" ana="12" xml:id="NidE101720"/> ertheilte Lob ist freilich wohl etwas zu stark, um es selbst abdrucken zu lassen: aber wer mag sich entschließen, so etwas auszuschlagen? Nur des Sanskrit kundige Leser können das einzelne verstehen; aber alle denkenden Leser werden bei den vortrefflichen allgemeinen Bemerkungen ihre Rechnung finden. Leider kann ich noch nicht melden, daß an der Indischen Bibliothek wirklich gedruckt wird. Im Kopfe habe ich den Stoff zu mehreren Heften fertig, aber auf dem Papiere sehr weniges. Wie sehr ich gestört gewesen, können Ew. Excellenz eben daraus ermessen, daß ich, ungeachtet des neuen Antriebes, den Ihr Aufsatz mir gab, dennoch kein Heft zu Stande gebracht.<lb/>Ich war schon lange gesonnen, <hi rend="weight:bold">Nachträge zur Kritik und Auslegung der Bhagavad Gita </hi>zu geben: da werden sich nun die Ihrigen vortrefflich anschließen. Wäre es aber nicht gut, <anchor type="b" n="14597" ana="12" xml:id="NidB101722"/>die betreffenden Stellen von <anchor type="b" n="3590" ana="11" xml:id="NidB101721"/>Langlois<anchor type="e" n="3590" ana="11" xml:id="NidE101721"/><anchor type="e" n="14597" ana="12" xml:id="NidE101722"/> französisch mit abzudrucken? Meine etwanigen Nebenbemerkungen, beistimmend, bestätigend oder bezweifelnd, möchten, wenn Ew. Excellenz es genehmigen, in kleinerer Schrift unter die einzelnen Abschnitte, oder als Noten unter den Text gesetzt werden.<lb/>Die Erlaubniß, etwas als unrichtig wegzustreichen, ist mir zu bedenklich, um Gebrauch davon zu machen. Wo ich für jetzt nicht beistimmen kann, wird es meistens disputable Punkte betreffen. Indessen lege ich auf einem besondern Blatte einiges vor, was vielleicht Ew. Excellenz zur Zurücknahme oder Modification weniger Zeilen veranlassen könnte, und erwarte darüber Ihre Entscheidung.<lb/>Kaum wage ich eine schüchterne Bitte um die Auslassung eines einzigen Wortes, welches nur zweimal vorkommt. Es ist das Wort <hi rend="weight:bold">pantheistisch</hi>. Da hier die Lehre der Bhagavad Gita nicht im Ganzen erörtert wird, so kann es ja entbehrt werden, es dürfte bloß heißen: „in diesem System“. Überdieß steht es bei einem Satze, worin die christlichen Mystiker wohl so ziemlich mit dem Verfasser der Bhagavad Gita übereinstimmen. Hier bildet es ein Präjudiz als ob die Sache schon ausgemacht wäre. Wenn die Behauptung im allgemeinen ausgeführt wird, dann ist es etwas andres. <anchor type="b" n="8" ana="11" xml:id="NidB101723"/>Mein Bruder<anchor type="e" n="8" ana="11" xml:id="NidE101723"/> hat schon früher die Lehre der Bhagavad Gita für Pantheismus erklärt. Ich habe ihm widersprochen, und behauptet, was ihn hiezu vermocht, seyen starke Ausdrücke von der dynamischen Allgegenwart. Ist zum reinen Theismus durchaus die Lehre von der Extramundanität der Gottheit erfoderlich? Die Immanenz des Weltalls lehrt <anchor type="b" n="3764" ana="12" xml:id="NidB101724"/>die Bhagavad Gita<anchor type="e" n="3764" ana="12" xml:id="NidE101724"/> freilich, unbeschadet der Emanation. Ist es im strengen Pantheismus möglich, die Gottheit von der Natur zu unterscheiden? Hört nicht alle Religion, alles ich und du, zwischen dem Gemüthe und der Gottheit auf? Ist damit die Lehre von der Vermittlung, von einer Herablassung der Gottheit um die Creatur zu sich heraufzuziehen, verträglich, welche doch so klar in der Bhagavad Gita vorgetragen wird? Ich habe ehemals die Schriften der Mystiker viel gelesen: mich dünkt, sie theilen sich in zwei Hauptclassen, die Theosophen und die Mystiker des Gefühls. Meines Erachtens stimmt mein Indischer Weiser so ziemlich mit den theosophischen Mystikern überein; weniger mit den letzteren, weil bei diesen der Sinn für die Natur ganz erloschen ist, welcher bei ihm in ursprünglicher mythologischer Fülle lebt.<lb/>Bei den scharfsinnigen Bemerkungen über die Bildung des philosophischen Sprachgebrauchs wage ich es, folgendes Ihrer Beurtheilung vorzulegen. In der Regel sind freilich die metaphysischen Ausdrücke von sinnlichen Vorstellungen übertragen; sollte es nicht aber auch in einigen Sprachen, und namentlich im Sanskrit, ursprünglich metaphysische Wörter geben? Z. B. <hi rend="slant:italic">dēha</hi> von <hi rend="slant:italic">dih</hi>, wie <hi rend="slant:italic">dēs͗a</hi> von <hi rend="slant:italic">dis͗</hi>, ganz etymologisch richtig. Nun heißt aber <hi rend="slant:italic">dih</hi> beschmieren, beflecken, besudeln. <anchor type="b" n="2553" ana="11" xml:id="NidB101747"/>Wilson<anchor type="e" n="2553" ana="11" xml:id="NidE101747"/> giebt zwar eine zweite Bedeutung, von der er es ableiten will. Aber ich kann mich nicht erinnern, das Verbum und insbesondre das häufige Participium <hi rend="slant:italic">digdha</hi> jemals anders als in der obigen Bedeutung gefunden zu haben. Auch steht in <anchor type="b" n="7022" ana="12" xml:id="NidB101726"/>dem Wurzel-Wörterbuch<anchor type="e" n="7022" ana="12" xml:id="NidE101726"/> bei <anchor type="b" n="3715" ana="11" xml:id="NidB101725"/>Carey<anchor type="e" n="3715" ana="11" xml:id="NidE101725"/> bloß <hi rend="slant:italic">lipi</hi>, in <anchor type="b" n="5662" ana="12" xml:id="NidB101728"/>der Englischen Übersetzung<anchor type="e" n="5662" ana="12" xml:id="NidE101728"/> bei <anchor type="b" n="3481" ana="11" xml:id="NidB101727"/>Wilkins<anchor type="e" n="3481" ana="11" xml:id="NidE101727"/> ebenfalls. Wunderlich genug steht aber dabei bloß Eine mit seiner Auslegung gar nicht übereinstimmende Definition <hi rend="slant:italic">upachayē</hi>, welches die zweite Bedeutung von Wilson ist. Wieder einmal ein Beispiel, wie unsere Elementar-Bücher noch beschaffen sind, und wie man sich überall selbst helfen, und die Augen offen haben muß! Wenn die zweite Bedeutung sich nicht praktisch bewährt, so bin ich sehr geneigt zu glauben, sie sei bloß von Indischen Grammatikern zum Behuf der Ableitung von <hi rend="slant:italic">dēha</hi> ersonnen. Ist es aber von <hi rend="slant:italic">dih</hi> in der Bedeutung von <hi rend="slant:italic">lipi</hi>, so liegt ja in dem einfachen Worte, wie im Keim, die ganze <anchor type="b" n="146" ana="11" xml:id="NidB101729"/>Platonische<anchor type="e" n="146" ana="11" xml:id="NidE101729"/> Lehre. Auch die andre Ableitung hat schon etwas wissenschaftliches. – Wie dem aber auch sei, das ist gewiß, daß bei den Indiern die Speculation so uralt und ihr Einfluß so überwiegend war, daß der metaphysische Sprachgebrauch in das Leben, wenigstens in die epische Poesie zurückgekehrt ist, und diese Erscheinung ist einzig in ihrer Art.<lb/>Meine Ansicht hängt freilich mit andern vielleicht paradoxen und deswegen besser esoterisch bleibenden Meynungen zusammen. Ich glaube nämlich, daß es ursprünglich tellurische, siderische und spirituale Sprachen giebt. Dieß würde auf die Eintheilung nach den drei <hi rend="slant:italic">gûńa</hi>’s hinauslaufen. Reine Exemplare von den drei Gattungen lassen sich freilich nicht nachweisen, man dürfte aber wohl versuchen, die Sprachen nach dem vorwaltenden Prinzip zu classifiziren.<lb/>Während ich dieses schrieb, empfing ich <anchor type="b" n="20049" ana="12" xml:id="NidB101730"/>Ihre Abhandlung über die Buchstabenschrift<anchor type="e" n="20049" ana="12" xml:id="NidE101730"/>, die ich sogleich verschlungen habe. In der Hauptsache bin ich ganz einverstanden. Mein einziger Zweifel ist nur der, ob nicht jene urweltliche Genialität, die bei der Erfindung der Buchstabenschrift gewaltet, jenes klare Bewußtseyn von den mit den Sprachorganen vorgenommenen und möglicher Weise vorzunehmenden Handlungen, von der symbolischen Bedeutung der Laute, ihrer Beziehung zu einander u. s. w.; ob, sage ich, jenes der Sprache bei ihrer Ausbildung nicht dieselben Dienste habe leisten können, als das materielle Vorhandenseyn der Buchstabenschrift?<lb/>Die Abweichung unsrer Ansichten – ich sage es mit Mistrauen gegen meine eigne Meynung – bezieht sich auf den Ursprung, und den frühesten Gang der menschlichen Cultur. Ich kann unmöglich die ersten großen Grundlagen als den späten und allmähligen Erfolg eines experimentirenden Herumtappens betrachten; sie scheinen mir ein genialischer Wurf zu seyn, wo alles mit Einemmale da ist, wie beim Anfange des organischen Lebens. Die Urväter des Menschengeschlechtes – einige, nicht alle; denn ich fürchte, ich bin in der dreifachen Ketzerei begriffen, ein Präadamit, ein Coadamit und ein Postadamit zu seyn – vergleiche ich mit Menschen, welche die Fähigkeit besessen hätten, in einem dunkeln Schacht durch die Kraft ihrer eignen Augen zu sehen, während unsre Bergleute sich der Lampen und Laternen bedienen müssen. <anchor type="b" n="942" ana="11" xml:id="NidB101731"/>Julius Caesar<anchor type="e" n="942" ana="11" xml:id="NidE101731"/> sagte, die Schrift habe das Gedächtniß zu Grunde gerichtet. Ist es nicht mit allen Dingen so? Je vollkommner die Hülfsmittel, desto mehr erlischt der inwohnende Sinn, das angebohrne Talent. Divinatorische Durchschauung der Natur, und von außen her erworbene Erfahrung scheinen mir die beiden Pole der menschlichen Cultur zu seyn; jenes der positive, dieses der negative. Wenn einmal in einem Zeitalter, wo das letzte Princip herrschend ist, jenes durchblitzt, so nimmt selbst das Experiment einen neuen Schwung, und die mechanischen Physiker, welche die Ideen läugnen, werden mehr von ihnen geleitet, als sie selbst wissen.<lb/>Um auf die Buchstabenschrift zurückzukommen, sie wäre also – da ihr Wesen in der Analyse der articulirten Laute besteht – <hi rend="slant:italic">virtualiter</hi> schon in der ältesten Zeit vorhanden gewesen, wenn es auch an zubereiteten Stoffen fehlte, um sie in Ausübung zu bringen.<lb/>Auch darin bin ich ganz einverstanden, daß eine gewisse todte und einförmige Regelmäßigkeit gar keine Vollkommenheit der Sprachen ist. <anchor type="b" n="113" ana="11" xml:id="NidB101732"/>Adelung<anchor type="e" n="113" ana="11" xml:id="NidE101732"/> hatte ganz richtig bemerkt, daß in der Deutschen Sprache die starke Conjugation (nach ihm die anomale) der schwachen mehr und mehr Platz einräume. Aber der geistlose Grammatiker hielt dieß für eine Vervollkommung, während es doch nur eine Abstumpfung ist. Die Mannigfaltigkeit der Formen, zB. der Declinationen und Conjugationen scheint mir, wenigstens imaginativ, bedeutsam gewesen zu seyn, was nachher verloren ging. <anchor type="b" n="1899" ana="11" xml:id="NidB101733"/>Grimm<anchor type="e" n="1899" ana="11" xml:id="NidE101733"/> betrachtet alle Anomalien als später und zufällig entstanden. Dieses gilt von den meisten, aber ich muß auch ursprüngliche, symbolische Anomalien annehmen, z. B. die der Personal-Pronomina in unsrer Sprachfamilie, und diesen Gesichtspunkt vermißte ich in <anchor type="b" n="2426" ana="11" xml:id="NidB101734"/>Bopps<anchor type="e" n="2426" ana="11" xml:id="NidE101734"/> <anchor type="b" n="9960" ana="12" xml:id="NidB101735"/>sonst vortrefflicher Abhandlung<anchor type="e" n="9960" ana="12" xml:id="NidE101735"/>. Eben so ist es mit der <hi rend="weight:bold">grammatischen Homonymie</hi>, wenn nämlich ganz verschiedene Biegungen gleich lauten. Dieses Gebrechen entsteht meistens aus der Abstumpfung, und nimmt daher bei nicht fixirten Sprachen, wie bisher bei der unsrigen, immer zu. Sollte es nicht aber auch ursprüngliche grammatische Homonymien geben, die symbolisch sind? ZB. logisch betrachtet ist es gleichgültig ob Subject und Object belebte Wesen oder unbelebte Dinge sind; imaginativ aber keinesweges, denn das Unbelebte handelt und leidet nicht eigentlich: es wirkt und erfährt Wirkungen. Diese neutrale Stellung wird nun durch die Gleichheit des Accusativus und Nominativus der Neutra [angedeutet], welche deswegen im Sanskrit, im Griechischen und Lateinischen eine wahre Schönheit ist. Im Deutschen ist es keine Schönheit mehr, weil so viele masculina und sämtliche feminina diese Eigenschaft mit den neutris gemein haben.<lb/>Ich kehre von meinen endlosen Abschweifungen zurück, um zu <anchor type="b" n="20049" ana="12" xml:id="NidB101736"/>Ihrer Abhandlung<anchor type="e" n="20049" ana="12" xml:id="NidE101736"/> eine kleine historische Bemerkung nachzutragen. Sie bemerken <hi rend="slant:italic">p</hi>. 1, daß die Chinesen die Europäische Buchstabenschrift verschmäht haben. Aber die Unmöglichkeit, sie ihrer Sprache anzueignen, erhellet doch noch weit stärker aus der unläugbaren Thatsache, daß die Indische Buchstabenschrift von den ersten Buddhistischen Missionaren überbracht worden war. <anchor type="b" n="3543" ana="11" xml:id="NidB101737"/>Rémusat<anchor type="e" n="3543" ana="11" xml:id="NidE101737"/> hat in <anchor type="b" n="20067" ana="12" xml:id="NidB101773"/>einem eignen Aufsatze<anchor type="e" n="20067" ana="12" xml:id="NidE101773"/>, ich weiß nicht mehr in <anchor type="b" n="5233" ana="12" xml:id="NidB101774"/>welcher Zeitschrift<anchor type="e" n="5233" ana="12" xml:id="NidE101774"/>, die Weise geschildert, wie ein chinesischer Autor von dieser fremden Theorie der Laute Rechenschaft giebt. <anchor type="b" n="19507" ana="11" xml:id="NidB101738"/>Der Baron Schilling von Canstadt<anchor type="e" n="19507" ana="11" xml:id="NidE101738"/> hat mir ein chinesisches Buch gezeigt, wo in einer Columne indische Sylben standen, in der nächsten die Lautbezeichnung, in chinesischer Schrift, in einer dritten die Bedeutung. Ohne Zweifel waren es <hi rend="slant:italic">mantra</hi>’s, ich hatte nicht Muße es näher zu untersuchen.<lb/>Nun noch einiges über meine französischen Kritiker und meine zu machenden Antikritiken. Wird es Ew. Excellenz unangenehm seyn, wenn ich in der Nachbarschaft Ihres so milden und ruhigen Aufsatzes mir einigen Spott über <anchor type="b" n="900" ana="11" xml:id="NidB101739"/>Chézy<anchor type="e" n="900" ana="11" xml:id="NidE101739"/> und <anchor type="b" n="3590" ana="11" xml:id="NidB101740"/>Langlois<anchor type="e" n="3590" ana="11" xml:id="NidE101740"/> erlaube? Nach Ihrer gütigen Gesinnung für mich hatten die Artikel des letzteren Sie indignirt, und Sie hatten die magistrale Recension noch nicht gelesen. Auf <anchor type="b" n="2385" ana="11" xml:id="NidB101741"/>Colebrooke<anchor type="e" n="2385" ana="11" xml:id="NidE101741"/> haben sie denselben Eindruck gemacht. Er <ref target="fud://4128">schrieb mir</ref>: <hi rend="slant:italic">The articles, to which you allude in <anchor type="b" n="3520" ana="13" xml:id="NidB101742"/>the Journal Asiatique<anchor type="e" n="3520" ana="13" xml:id="NidE101742"/>, had not escaped me. I regretted to observe the tone of them. Such is not the spirit, which fellow-labourers in the great cause of Oriental litterature should evince towards each other</hi>. Nun stellen Sie sich meine Ataraxie vor: bis jetzt eben, wo ich Ihre Bemerkungen genau von neuem durchging, hatte ich jene kaum flüchtig gelesen. Freilich wußte ich im voraus, daß Chézys Eifersucht zu einer wahren Wuth gesteigert war. Dieses dauert noch immer fort, und ist eine wahre Tragi-Komödie. Seine Absicht war im <hi rend="slant:italic">Journal Asiatique</hi> mich noch weit gröber anzugreifen, aber Rémusat protestirte nachdrücklich dagegen, und so wurden dem Langlois die Höflichkeiten in seinem ersten Artikel abgedrungen.<lb/>In <anchor type="b" n="292" ana="10" xml:id="NidB101743"/>London<anchor type="e" n="292" ana="10" xml:id="NidE101743"/> bat ich Colebrooke, für meine Rechnung Commentare des Bhagavad Gita aus <anchor type="b" n="2552" ana="10" xml:id="NidB101744"/>Calcutta<anchor type="e" n="2552" ana="10" xml:id="NidE101744"/> zu verschreiben. Ich gedachte erst jede Beantwortung der Kritiken bis auf deren Ankunft zu verschieben, weil es sonst gewissermaßen ein Kampf mit ungleichen Waffen ist, da meine Gegner sich immer auf die Autorität des Scholiasten berufen. Indessen, da die Commentare leider nicht ankommen, so werden die Delinquenten doch nun wohl bei den nächsten Assisen vorgenommen werden müssen. Ich besitze nur das 2<hi rend="offset:4;underline:1">te</hi> Capitel der Subôdhinê, in meiner eignen Abschrift; und dieses leistet mir schon gute Dienste. Zuverläßig hat Langlois – folglich auch Chézy – den Commentator häufig misverstanden. Er hat <hi rend="slant:italic">Cahier</hi> 34, <hi rend="slant:italic">p</hi>. 248 <hi rend="slant:italic">ad</hi> Bh.G. XI, 22, nicht gemerkt, daß das von ihm abgeschriebene Scholion eine Citation aus <anchor type="b" n="3870" ana="12" xml:id="NidB101745"/>den Véda’s<anchor type="e" n="3870" ana="12" xml:id="NidE101745"/> enthält.<lb/>Folgendes hätte mir gleich beim Empfange Ihres Schreibens einfallen sollen, und ich hole es mit Beschämung nach. <anchor type="b" n="2566" ana="11" xml:id="NidB101746"/>Mein Schüler<anchor type="e" n="2566" ana="11" xml:id="NidE101746"/> hat einen vollständigen und sauber geschriebenen <hi rend="slant:italic">Index Verborum </hi>zur Bhagavad Gita verfertigt: könnte dieser Ew. Excellenz bei der Beschäftigung mit dem Inhalte bequem seyn, so bin ich bereit ihn auf eine Zeitlang zu übersenden. Freilich müßte ich ihn bei der Antikritik zur Hand haben, aber diese kann ich wohl vorher abthun.<lb/>Ich bin fast entschlossen, sie französisch zu schreiben, damit sie doch an die rechte Adresse gelangt.<lb/>Wenn die Tugend in einer Mitte zwischen zwei Extremen besteht, so übe ich sie beim Briefwechsel gewiß nicht aus, indem ich entweder gar nicht oder endlos lange Briefe schreibe. Ich schließe mit dem Versprechen, mich wo möglich in beiden Punkten zu bessern. Mit unwandelbarer Verehrung und Ergebenheit<lb/>Ew. Excellenz<lb/>gehorsamster <lb/>AWvSchlegel.<lb/>Eine Sendung von einigen gedruckten Sachen, lateinischen und deutschen, wird hoffentlich richtig angekommen seyn.', '36_briefid' => 'Leitzmann1908_AWSanWvHumboldt_21021826', '36_absender' => array( (int) 0 => array( [maximum depth reached] ) ), '36_adressat' => array( (int) 0 => array( [maximum depth reached] ) ), '36_datumvon' => '1826-02-21', '36_sprache' => array( (int) 0 => 'Deutsch' ), '36_absenderort' => array( (int) 0 => array( [maximum depth reached] ) ), '36_leitd' => 'Briefwechsel zwischen Wilhelm von Humboldt und August Wilhelm Schlegel. Hg. v. Albert Leitzmann. Halle 1908, S. 183‒192.', '36_status' => 'Einmal kollationierter Druckvolltext mit Registerauszeichnung', '36_Datum' => '1826-02-21', '36_facet_absender' => array( (int) 0 => 'August Wilhelm von Schlegel' ), '36_facet_absender_reverse' => array( (int) 0 => 'Schlegel, August Wilhelm von' ), '36_facet_adressat' => array( (int) 0 => 'Wilhelm von Humboldt' ), '36_facet_adressat_reverse' => array( (int) 0 => 'Humboldt, Wilhelm von' ), '36_facet_absenderort' => array( (int) 0 => 'Bonn' ), '36_facet_adressatort' => '', '36_facet_status' => 'Einmal kollationierter Druckvolltext mit Registerauszeichnung', '36_facet_datengeberhand' => '', '36_facet_sprache' => array( (int) 0 => 'Deutsch' ), '36_facet_korrespondenten' => array( (int) 0 => 'Wilhelm von Humboldt' ), '36_Digitalisat_Druck_Server' => array( (int) 0 => 'AWS-aw-0231-0.jpg', (int) 1 => 'AWS-aw-0231-1.jpg', (int) 2 => 'AWS-aw-0231-2.jpg', (int) 3 => 'AWS-aw-0231-3.jpg', (int) 4 => 'AWS-aw-0231-4.jpg', (int) 5 => 'AWS-aw-0231-5.jpg', (int) 6 => 'AWS-aw-0231-6.jpg', (int) 7 => 'AWS-aw-0231-7.jpg', (int) 8 => 'AWS-aw-0231-8.jpg', (int) 9 => 'AWS-aw-0231-9.jpg' ), '_label' => '', '_descr' => '', '_model' => 'Letter', '_model_title' => 'Letter', '_model_titles' => 'Letters', '_url' => '' ), 'doctype_name' => 'Letters', 'captions' => array( '36_dummy' => '', '36_absender' => 'Absender/Verfasser', '36_absverif1' => 'Verfasser Verifikation', '36_absender2' => 'Verfasser 2', '36_absverif2' => 'Verfasser 2 Verifikation', '36_absbrieftyp2' => 'Verfasser 2 Brieftyp', '36_absender3' => 'Verfasser 3', '36_absverif3' => 'Verfasser 3 Verifikation', '36_absbrieftyp3' => 'Verfasser 3 Brieftyp', '36_adressat' => 'Adressat/Empfänger', '36_adrverif1' => 'Empfänger Verifikation', '36_adressat2' => 'Empfänger 2', '36_adrverif2' => 'Empfänger 2 Verifikation', '36_adressat3' => 'Empfänger 3', '36_adrverif3' => 'Empfänger 3 Verifikation', '36_adressatfalsch' => 'Empfänger_falsch', '36_absenderort' => 'Ort Absender/Verfasser', '36_absortverif1' => 'Ort Verfasser Verifikation', '36_absortungenau' => 'Ort Verfasser ungenau', '36_absenderort2' => 'Ort Verfasser 2', '36_absortverif2' => 'Ort Verfasser 2 Verifikation', '36_absenderort3' => 'Ort Verfasser 3', '36_absortverif3' => 'Ort Verfasser 3 Verifikation', '36_adressatort' => 'Ort Adressat/Empfänger', '36_adrortverif' => 'Ort Empfänger Verifikation', '36_datumvon' => 'Datum von', '36_datumbis' => 'Datum bis', '36_altDat' => 'Datum/Datum manuell', '36_datumverif' => 'Datum Verifikation', '36_sortdatum' => 'Datum zum Sortieren', '36_wochentag' => 'Wochentag nicht erzeugen', '36_sortdatum1' => 'Briefsortierung', '36_fremddatierung' => 'Fremddatierung', '36_typ' => 'Brieftyp', '36_briefid' => 'Brief Identifier', '36_purl_web' => 'PURL web', '36_status' => 'Bearbeitungsstatus', '36_anmerkung' => 'Anmerkung (intern)', '36_anmerkungextern' => 'Anmerkung (extern)', '36_datengeber' => 'Datengeber', '36_purl' => 'OAI-Id', '36_leitd' => 'Druck 1:Bibliographische Angabe', '36_druck2' => 'Druck 2:Bibliographische Angabe', '36_druck3' => 'Druck 3:Bibliographische Angabe', '36_internhand' => 'Zugehörige Handschrift', '36_datengeberhand' => 'Datengeber', '36_purlhand' => 'OAI-Id', '36_purlhand_alt' => 'OAI-Id (alternative)', '36_signaturhand' => 'Signatur', '36_signaturhand_alt' => 'Signatur (alternative)', '36_h1prov' => 'Provenienz', '36_h1zahl' => 'Blatt-/Seitenzahl', '36_h1format' => 'Format', '36_h1besonder' => 'Besonderheiten', '36_hueberlieferung' => 'Ãœberlieferung', '36_infoinhalt' => 'Verschollen/erschlossen: Information über den Inhalt', '36_heditor' => 'Editor/in', '36_hredaktion' => 'Redakteur/in', '36_interndruck' => 'Zugehörige Druck', '36_band' => 'KFSA Band', '36_briefnr' => 'KFSA Brief-Nr.', '36_briefseite' => 'KFSA Seite', '36_incipit' => 'Incipit', '36_textgrundlage' => 'Textgrundlage Sigle', '36_uberstatus' => 'Ãœberlieferungsstatus', '36_gattung' => 'Gattung', '36_korrepsondentds' => 'Korrespondent_DS', '36_korrepsondentfs' => 'Korrespondent_FS', '36_ermitteltvon' => 'Ermittelt von', '36_metadatenintern' => 'Metadaten (intern)', '36_beilagen' => 'Beilage(en)', '36_abszusatz' => 'Verfasser Zusatzinfos', '36_adrzusatz' => 'Empfänger Zusatzinfos', '36_absortzusatz' => 'Verfasser Ort Zusatzinfos', '36_adrortzusatz' => 'Empfänger Ort Zusatzinfos', '36_datumzusatz' => 'Datum Zusatzinfos', '36_' => '', '36_KFSA Hand.hueberleiferung' => 'Ãœberlieferungsträger', '36_KFSA Hand.harchiv' => 'Archiv', '36_KFSA Hand.hsignatur' => 'Signatur', '36_KFSA Hand.hprovenienz' => 'Provenienz', '36_KFSA Hand.harchivlalt' => 'Archiv_alt', '36_KFSA Hand.hsignaturalt' => 'Signatur_alt', '36_KFSA Hand.hblattzahl' => 'Blattzahl', '36_KFSA Hand.hseitenzahl' => 'Seitenzahl', '36_KFSA Hand.hformat' => 'Format', '36_KFSA Hand.hadresse' => 'Adresse', '36_KFSA Hand.hvollstaendig' => 'Vollständigkeit', '36_KFSA Hand.hzusatzinfo' => 'H Zusatzinfos', '36_KFSA Druck.drliteratur' => 'Druck in', '36_KFSA Druck.drsigle' => 'Sigle', '36_KFSA Druck.drbandnrseite' => 'Bd./Nr./S.', '36_KFSA Druck.drfaksimile' => 'Faksimile', '36_KFSA Druck.drvollstaendig' => 'Vollständigkeit', '36_KFSA Druck.dzusatzinfo' => 'D Zusatzinfos', '36_KFSA Doku.dokliteratur' => 'Dokumentiert in', '36_KFSA Doku.doksigle' => 'Sigle', '36_KFSA Doku.dokbandnrseite' => 'Bd./Nr./S.', '36_KFSA Doku.dokfaksimile' => 'Faksimile', '36_KFSA Doku.dokvollstaendig' => 'Vollständigkeit', '36_KFSA Doku.dokzusatzinfo' => 'A Zusatzinfos', '36_Link Druck.url_titel_druck' => 'Titel/Bezeichnung', '36_Link Druck.url_image_druck' => 'Link zu Online-Dokument', '36_Link Hand.url_titel_hand' => 'Titel/Bezeichnung', '36_Link Hand.url_image_hand' => 'Link zu Online-Dokument', '36_preasentation' => 'Nicht in die Präsentation', '36_verlag' => 'Verlag', '36_anhang_tite0' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename0' => 'Image', '36_anhang_tite1' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename1' => 'Image', '36_anhang_tite2' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename2' => 'Image', '36_anhang_tite3' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename3' => 'Image', '36_anhang_tite4' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename4' => 'Image', '36_anhang_tite5' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename5' => 'Image', '36_anhang_tite6' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename6' => 'Image', '36_anhang_tite7' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename7' => 'Image', '36_anhang_tite8' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename8' => 'Image', '36_anhang_tite9' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename9' => 'Image', '36_anhang_titea' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcenamea' => 'Image', '36_anhang_titeb' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcenameb' => 'Image', '36_anhang_titec' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcenamec' => 'Image', '36_anhang_tited' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcenamed' => 'Image', '36_anhang_titee' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcenamee' => 'Image', '36_anhang_titeu' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcenameu' => 'Image', '36_anhang_titev' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcenamev' => 'Image', '36_anhang_titew' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcenamew' => 'Image', '36_anhang_titex' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcenamex' => 'Image', '36_anhang_titey' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcenamey' => 'Image', '36_anhang_titez' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcenamez' => 'Image', '36_anhang_tite10' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename10' => 'Image', '36_anhang_tite11' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename11' => 'Image', '36_anhang_tite12' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename12' => 'Image', '36_anhang_tite13' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename13' => 'Image', '36_anhang_tite14' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename14' => 'Image', '36_anhang_tite15' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename15' => 'Image', '36_anhang_tite16' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename16' => 'Image', '36_anhang_tite17' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename17' => 'Image', '36_anhang_tite18' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename18' => 'Image', '36_h_preasentation' => 'Nicht in die Präsentation', '36_anhang_titef' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcenamef' => 'Image', '36_anhang_titeg' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcenameg' => 'Image', '36_anhang_titeh' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcenameh' => 'Image', '36_anhang_titei' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcenamei' => 'Image', '36_anhang_titej' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcenamej' => 'Image', '36_anhang_titek' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcenamek' => 'Image', '36_anhang_titel' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcenamel' => 'Image', '36_anhang_titem' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcenamem' => 'Image', '36_anhang_titen' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcenamen' => 'Image', '36_anhang_titeo' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcenameo' => 'Image', '36_anhang_titep' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcenamep' => 'Image', '36_anhang_titeq' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcenameq' => 'Image', '36_anhang_titer' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcenamer' => 'Image', '36_anhang_tites' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcenames' => 'Image', '36_anhang_titet' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcenamet' => 'Image', '36_anhang_tite19' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename19' => 'Image', '36_anhang_tite20' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename20' => 'Image', '36_anhang_tite21' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename21' => 'Image', '36_anhang_tite22' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename22' => 'Image', '36_anhang_tite23' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename23' => 'Image', '36_anhang_tite24' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename24' => 'Image', '36_anhang_tite25' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename25' => 'Image', '36_anhang_tite26' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename26' => 'Image', '36_anhang_tite27' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename27' => 'Image', '36_anhang_tite28' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename28' => 'Image', '36_anhang_tite29' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename29' => 'Image', '36_anhang_tite30' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename30' => 'Image', '36_anhang_tite31' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename32' => 'Image', '36_anhang_tite33' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename33' => 'Image', '36_anhang_tite34' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename34' => 'Image', '36_Relationen.relation_art' => 'Art', '36_Relationen.relation_link' => 'Interner Link', '36_volltext' => 'Brieftext (Digitalisat Leitdruck oder Transkript Handschrift)', '36_History.hisbearbeiter' => 'Bearbeiter', '36_History.hisschritt' => 'Bearbeitungsschritt', '36_History.hisdatum' => 'Datum', '36_History.hisnotiz' => 'Notiz', '36_personen' => 'Personen', '36_werke' => 'Werke', '36_orte' => 'Orte', '36_themen' => 'Themen', '36_briedfehlt' => 'Fehlt', '36_briefbestellt' => 'Bestellt', '36_intrans' => 'Transkription', '36_intranskorr1' => 'Transkription Korrektur 1', '36_intranskorr2' => 'Transkription Korrektur 2', '36_intranscheck' => 'Transkription Korr. geprüft', '36_intranseintr' => 'Transkription Korr. eingetr', '36_inannotcheck' => 'Auszeichnungen Reg. geprüft', '36_inkollation' => 'Auszeichnungen Kollationierung', '36_inkollcheck' => 'Auszeichnungen Koll. geprüft', '36_himageupload' => 'H/h Digis hochgeladen', '36_dimageupload' => 'D Digis hochgeladen', '36_stand' => 'Bearbeitungsstand (Webseite)', '36_stand_d' => 'Bearbeitungsstand (Druck)', '36_timecreate' => 'Erstellt am', '36_timelastchg' => 'Zuletzt gespeichert am', '36_comment' => 'Kommentar(intern)', '36_accessid' => 'Access ID', '36_accessidalt' => 'Access ID-alt', '36_digifotos' => 'Digitalisat Fotos', '36_imagelink' => 'Imagelink', '36_vermekrbehler' => 'Notizen Behler', '36_vermekrotto' => 'Anmerkungen Otto', '36_vermekraccess' => 'Bearb-Vermerke Access', '36_zeugenbeschreib' => 'Zeugenbeschreibung', '36_sprache' => 'Sprache', '36_accessinfo1' => 'Archiv H (+ Signatur)', '36_korrekturbd36' => 'Korrekturen Bd. 36', '36_druckbd36' => 'Druckrelevant Bd. 36', '36_digitalisath1' => 'Digitalisat_H', '36_digitalisath2' => 'Digitalisat_h', '36_titelhs' => 'Titel_Hs', '36_accessinfo2' => 'Archiv H (+ Signatur)', '36_accessinfo3' => 'Sigle (Dokumentiert in + Bd./Nr./S.)', '36_accessinfo4' => 'Sigle (Druck in + Bd./Nr./S.)', '36_KFSA Hand.hschreibstoff' => 'Schreibstoff', '36_Relationen.relation_anmerkung' => null, '36_anhang_tite35' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename35' => 'Image', '36_anhang_tite36' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename36' => 'Image', '36_anhang_tite37' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename37' => 'Image', '36_anhang_tite38' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename38' => 'Image', '36_anhang_tite39' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename39' => 'Image', '36_anhang_tite40' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename40' => 'Image', '36_anhang_tite41' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename41' => 'Image', '36_anhang_tite42' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename42' => 'Image', '36_anhang_tite43' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename43' => 'Image', '36_anhang_tite44' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename44' => 'Image', '36_anhang_tite45' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename45' => 'Image', '36_anhang_tite46' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename46' => 'Image', '36_anhang_tite47' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename47' => 'Image', '36_anhang_tite48' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename48' => 'Image', '36_anhang_tite49' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename49' => 'Image', '36_anhang_tite50' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename50' => 'Image', '36_anhang_tite51' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename51' => 'Image', '36_anhang_tite52' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename52' => 'Image', '36_anhang_tite53' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename53' => 'Image', '36_anhang_tite54' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename54' => 'Image', '36_KFSA Hand.hbeschreibung' => 'Beschreibung', '36_KFSA Kritanhang.krit_infotyp' => 'Infotyp', '36_KFSA Kritanhang.krit_infotext' => 'Infotext', '36_datumspezif' => 'Datum Spezifikation', 'index_orte_10' => 'Orte', 'index_orte_10.content' => 'Orte', 'index_orte_10.comment' => 'Orte (Kommentar)', 'index_personen_11' => 'Personen', 'index_personen_11.content' => 'Personen', 'index_personen_11.comment' => 'Personen (Kommentar)', 'index_werke_12' => 'Werke', 'index_werke_12.content' => 'Werke', 'index_werke_12.comment' => 'Werke (Kommentar)', 'index_periodika_13' => 'Periodika', 'index_periodika_13.content' => 'Periodika', 'index_periodika_13.comment' => 'Periodika (Kommentar)', 'index_sachen_14' => 'Sachen', 'index_sachen_14.content' => 'Sachen', 'index_sachen_14.comment' => 'Sachen (Kommentar)', 'index_koerperschaften_15' => 'Koerperschaften', 'index_koerperschaften_15.content' => 'Koerperschaften', 'index_koerperschaften_15.comment' => 'Koerperschaften (Kommentar)', 'index_zitate_16' => 'Zitate', 'index_zitate_16.content' => 'Zitate', 'index_zitate_16.comment' => 'Zitate (Kommentar)', 'index_korrespondenzpartner_17' => 'Korrespondenzpartner', 'index_korrespondenzpartner_17.content' => 'Korrespondenzpartner', 'index_korrespondenzpartner_17.comment' => 'Korrespondenzpartner (Kommentar)', 'index_archive_18' => 'Archive', 'index_archive_18.content' => 'Archive', 'index_archive_18.comment' => 'Archive (Kommentar)', 'index_literatur_19' => 'Literatur', 'index_literatur_19.content' => 'Literatur', 'index_literatur_19.comment' => 'Literatur (Kommentar)', 'index_kunstwerke_kfsa_20' => 'Kunstwerke KFSA', 'index_kunstwerke_kfsa_20.content' => 'Kunstwerke KFSA', 'index_kunstwerke_kfsa_20.comment' => 'Kunstwerke KFSA (Kommentar)', 'index_druckwerke_kfsa_21' => 'Druckwerke KFSA', 'index_druckwerke_kfsa_21.content' => 'Druckwerke KFSA', 'index_druckwerke_kfsa_21.comment' => 'Druckwerke KFSA (Kommentar)', '36_fulltext' => 'XML Volltext', '36_html' => 'HTML Volltext', '36_publicHTML' => 'HTML Volltext', '36_plaintext' => 'Volltext', 'transcript.text' => 'Transkripte', 'folders' => 'Mappen', 'notes' => 'Notizen', 'notes.title' => 'Notizen (Titel)', 'notes.content' => 'Notizen', 'notes.category' => 'Notizen (Kategorie)', 'key' => 'FuD Schlüssel' ) ) $html = '<span class="index-887 tp-101698 ">Bonn</span> den 21sten Februar 1826.<br>Ew. Excellenz haben die gerechteste Ursache von der Welt, ungehalten zu seyn. Daß Sie den Briefwechsel eine Zeitlang hatten ruhen lassen, war ganz in der Ordnung, und Ew. Excellenz durften darüber keine Sylbe verlieren. Ich besitze eine reichhaltige Sammlung Ihrer Briefe, woraus ich oft neue Anregung und Belehrung schöpfe. Jede Bereicherung ist unendlich willkommen. Wenn aber Ew. Excellenz unter so tiefen und weitumfassenden Forschungen, die Sie mit unermüdlicher Thätigkeit verfolgen, keine Muße finden, mir zu schreiben, so bescheide ich mich gern, daß mein persönliches Interesse gegen das allgemeine zurückstehen muß, und bin zufrieden, wenn ich nur auf andern Wegen die Gewißheit von Ihrer ununterbrochenen Heiterkeit und Gesundheit erhalte; und dieß war in jenem Zeitraume der Fall. Daß ich hingegen eine solche Sendung, wie Ihre letzte ist, so lange unbeantwortet lassen konnte, ist unerhört und unverantwortlich. Ich will nicht versuchen, es zu entschuldigen; erklären könnte ich es wohl aus der Beschaffenheit der Störungen, die ununterbrochen auf einander folgten, und mit solchen Studien ganz unverträglich sind. Unter andern mußte ich, gleich nach Empfang <span class="doc-3144 ">Ihres Schreibens</span>, außer dem Rectorat über zwei Monate die Stelle des Regierungs-Bevollmächtigten vertreten. Doch ich müßte meinen ganzen zeitherigen Lebenslauf erzählen, und dieß wäre ein unnützer Zeitverlust. Ich komme lieber gleich zur Hauptsache.<br>Ew. Excellenz können nicht bezweifeln, daß ich mich sehr glücklich schätze, mit <span class="index-9946 tp-101719 ">Ihren Bemerkungen über die Bhagavad Gita</span> <span class="index-2322 tp-101718 ">meine Indische Bibliothek</span> auszuzieren. Das <span class="index-2543 tp-101720 ">meiner Übersetzung</span> ertheilte Lob ist freilich wohl etwas zu stark, um es selbst abdrucken zu lassen: aber wer mag sich entschließen, so etwas auszuschlagen? Nur des Sanskrit kundige Leser können das einzelne verstehen; aber alle denkenden Leser werden bei den vortrefflichen allgemeinen Bemerkungen ihre Rechnung finden. Leider kann ich noch nicht melden, daß an der Indischen Bibliothek wirklich gedruckt wird. Im Kopfe habe ich den Stoff zu mehreren Heften fertig, aber auf dem Papiere sehr weniges. Wie sehr ich gestört gewesen, können Ew. Excellenz eben daraus ermessen, daß ich, ungeachtet des neuen Antriebes, den Ihr Aufsatz mir gab, dennoch kein Heft zu Stande gebracht.<br>Ich war schon lange gesonnen, <span class="weight-bold ">Nachträge zur Kritik und Auslegung der Bhagavad Gita </span>zu geben: da werden sich nun die Ihrigen vortrefflich anschließen. Wäre es aber nicht gut, <span class="index-14597 tp-101722 ">die betreffenden Stellen von </span><span class="index-14597 tp-101722 index-3590 tp-101721 ">Langlois</span> französisch mit abzudrucken? Meine etwanigen Nebenbemerkungen, beistimmend, bestätigend oder bezweifelnd, möchten, wenn Ew. Excellenz es genehmigen, in kleinerer Schrift unter die einzelnen Abschnitte, oder als Noten unter den Text gesetzt werden.<br>Die Erlaubniß, etwas als unrichtig wegzustreichen, ist mir zu bedenklich, um Gebrauch davon zu machen. Wo ich für jetzt nicht beistimmen kann, wird es meistens disputable Punkte betreffen. Indessen lege ich auf einem besondern Blatte einiges vor, was vielleicht Ew. Excellenz zur Zurücknahme oder Modification weniger Zeilen veranlassen könnte, und erwarte darüber Ihre Entscheidung.<br>Kaum wage ich eine schüchterne Bitte um die Auslassung eines einzigen Wortes, welches nur zweimal vorkommt. Es ist das Wort <span class="weight-bold ">pantheistisch</span>. Da hier die Lehre der Bhagavad Gita nicht im Ganzen erörtert wird, so kann es ja entbehrt werden, es dürfte bloß heißen: „in diesem System“. Überdieß steht es bei einem Satze, worin die christlichen Mystiker wohl so ziemlich mit dem Verfasser der Bhagavad Gita übereinstimmen. Hier bildet es ein Präjudiz als ob die Sache schon ausgemacht wäre. Wenn die Behauptung im allgemeinen ausgeführt wird, dann ist es etwas andres. <span class="index-8 tp-101723 ">Mein Bruder</span> hat schon früher die Lehre der Bhagavad Gita für Pantheismus erklärt. Ich habe ihm widersprochen, und behauptet, was ihn hiezu vermocht, seyen starke Ausdrücke von der dynamischen Allgegenwart. Ist zum reinen Theismus durchaus die Lehre von der Extramundanität der Gottheit erfoderlich? Die Immanenz des Weltalls lehrt <span class="index-3764 tp-101724 ">die Bhagavad Gita</span> freilich, unbeschadet der Emanation. Ist es im strengen Pantheismus möglich, die Gottheit von der Natur zu unterscheiden? Hört nicht alle Religion, alles ich und du, zwischen dem Gemüthe und der Gottheit auf? Ist damit die Lehre von der Vermittlung, von einer Herablassung der Gottheit um die Creatur zu sich heraufzuziehen, verträglich, welche doch so klar in der Bhagavad Gita vorgetragen wird? Ich habe ehemals die Schriften der Mystiker viel gelesen: mich dünkt, sie theilen sich in zwei Hauptclassen, die Theosophen und die Mystiker des Gefühls. Meines Erachtens stimmt mein Indischer Weiser so ziemlich mit den theosophischen Mystikern überein; weniger mit den letzteren, weil bei diesen der Sinn für die Natur ganz erloschen ist, welcher bei ihm in ursprünglicher mythologischer Fülle lebt.<br>Bei den scharfsinnigen Bemerkungen über die Bildung des philosophischen Sprachgebrauchs wage ich es, folgendes Ihrer Beurtheilung vorzulegen. In der Regel sind freilich die metaphysischen Ausdrücke von sinnlichen Vorstellungen übertragen; sollte es nicht aber auch in einigen Sprachen, und namentlich im Sanskrit, ursprünglich metaphysische Wörter geben? Z. B. <span class="slant-italic ">dēha</span> von <span class="slant-italic ">dih</span>, wie <span class="slant-italic ">dēs͗a</span> von <span class="slant-italic ">dis͗</span>, ganz etymologisch richtig. Nun heißt aber <span class="slant-italic ">dih</span> beschmieren, beflecken, besudeln. <span class="index-2553 tp-101747 ">Wilson</span> giebt zwar eine zweite Bedeutung, von der er es ableiten will. Aber ich kann mich nicht erinnern, das Verbum und insbesondre das häufige Participium <span class="slant-italic ">digdha</span> jemals anders als in der obigen Bedeutung gefunden zu haben. Auch steht in <span class="index-7022 tp-101726 ">dem Wurzel-Wörterbuch</span> bei <span class="index-3715 tp-101725 ">Carey</span> bloß <span class="slant-italic ">lipi</span>, in <span class="index-5662 tp-101728 ">der Englischen Übersetzung</span> bei <span class="index-3481 tp-101727 ">Wilkins</span> ebenfalls. Wunderlich genug steht aber dabei bloß Eine mit seiner Auslegung gar nicht übereinstimmende Definition <span class="slant-italic ">upachayē</span>, welches die zweite Bedeutung von Wilson ist. Wieder einmal ein Beispiel, wie unsere Elementar-Bücher noch beschaffen sind, und wie man sich überall selbst helfen, und die Augen offen haben muß! Wenn die zweite Bedeutung sich nicht praktisch bewährt, so bin ich sehr geneigt zu glauben, sie sei bloß von Indischen Grammatikern zum Behuf der Ableitung von <span class="slant-italic ">dēha</span> ersonnen. Ist es aber von <span class="slant-italic ">dih</span> in der Bedeutung von <span class="slant-italic ">lipi</span>, so liegt ja in dem einfachen Worte, wie im Keim, die ganze <span class="index-146 tp-101729 ">Platonische</span> Lehre. Auch die andre Ableitung hat schon etwas wissenschaftliches. – Wie dem aber auch sei, das ist gewiß, daß bei den Indiern die Speculation so uralt und ihr Einfluß so überwiegend war, daß der metaphysische Sprachgebrauch in das Leben, wenigstens in die epische Poesie zurückgekehrt ist, und diese Erscheinung ist einzig in ihrer Art.<br>Meine Ansicht hängt freilich mit andern vielleicht paradoxen und deswegen besser esoterisch bleibenden Meynungen zusammen. Ich glaube nämlich, daß es ursprünglich tellurische, siderische und spirituale Sprachen giebt. Dieß würde auf die Eintheilung nach den drei <span class="slant-italic ">gûńa</span>’s hinauslaufen. Reine Exemplare von den drei Gattungen lassen sich freilich nicht nachweisen, man dürfte aber wohl versuchen, die Sprachen nach dem vorwaltenden Prinzip zu classifiziren.<br>Während ich dieses schrieb, empfing ich <span class="index-20049 tp-101730 ">Ihre Abhandlung über die Buchstabenschrift</span>, die ich sogleich verschlungen habe. In der Hauptsache bin ich ganz einverstanden. Mein einziger Zweifel ist nur der, ob nicht jene urweltliche Genialität, die bei der Erfindung der Buchstabenschrift gewaltet, jenes klare Bewußtseyn von den mit den Sprachorganen vorgenommenen und möglicher Weise vorzunehmenden Handlungen, von der symbolischen Bedeutung der Laute, ihrer Beziehung zu einander u. s. w.; ob, sage ich, jenes der Sprache bei ihrer Ausbildung nicht dieselben Dienste habe leisten können, als das materielle Vorhandenseyn der Buchstabenschrift?<br>Die Abweichung unsrer Ansichten – ich sage es mit Mistrauen gegen meine eigne Meynung – bezieht sich auf den Ursprung, und den frühesten Gang der menschlichen Cultur. Ich kann unmöglich die ersten großen Grundlagen als den späten und allmähligen Erfolg eines experimentirenden Herumtappens betrachten; sie scheinen mir ein genialischer Wurf zu seyn, wo alles mit Einemmale da ist, wie beim Anfange des organischen Lebens. Die Urväter des Menschengeschlechtes – einige, nicht alle; denn ich fürchte, ich bin in der dreifachen Ketzerei begriffen, ein Präadamit, ein Coadamit und ein Postadamit zu seyn – vergleiche ich mit Menschen, welche die Fähigkeit besessen hätten, in einem dunkeln Schacht durch die Kraft ihrer eignen Augen zu sehen, während unsre Bergleute sich der Lampen und Laternen bedienen müssen. <span class="index-942 tp-101731 ">Julius Caesar</span> sagte, die Schrift habe das Gedächtniß zu Grunde gerichtet. Ist es nicht mit allen Dingen so? Je vollkommner die Hülfsmittel, desto mehr erlischt der inwohnende Sinn, das angebohrne Talent. Divinatorische Durchschauung der Natur, und von außen her erworbene Erfahrung scheinen mir die beiden Pole der menschlichen Cultur zu seyn; jenes der positive, dieses der negative. Wenn einmal in einem Zeitalter, wo das letzte Princip herrschend ist, jenes durchblitzt, so nimmt selbst das Experiment einen neuen Schwung, und die mechanischen Physiker, welche die Ideen läugnen, werden mehr von ihnen geleitet, als sie selbst wissen.<br>Um auf die Buchstabenschrift zurückzukommen, sie wäre also – da ihr Wesen in der Analyse der articulirten Laute besteht – <span class="slant-italic ">virtualiter</span> schon in der ältesten Zeit vorhanden gewesen, wenn es auch an zubereiteten Stoffen fehlte, um sie in Ausübung zu bringen.<br>Auch darin bin ich ganz einverstanden, daß eine gewisse todte und einförmige Regelmäßigkeit gar keine Vollkommenheit der Sprachen ist. <span class="index-113 tp-101732 ">Adelung</span> hatte ganz richtig bemerkt, daß in der Deutschen Sprache die starke Conjugation (nach ihm die anomale) der schwachen mehr und mehr Platz einräume. Aber der geistlose Grammatiker hielt dieß für eine Vervollkommung, während es doch nur eine Abstumpfung ist. Die Mannigfaltigkeit der Formen, zB. der Declinationen und Conjugationen scheint mir, wenigstens imaginativ, bedeutsam gewesen zu seyn, was nachher verloren ging. <span class="index-1899 tp-101733 ">Grimm</span> betrachtet alle Anomalien als später und zufällig entstanden. Dieses gilt von den meisten, aber ich muß auch ursprüngliche, symbolische Anomalien annehmen, z. B. die der Personal-Pronomina in unsrer Sprachfamilie, und diesen Gesichtspunkt vermißte ich in <span class="index-2426 tp-101734 ">Bopps</span> <span class="index-9960 tp-101735 ">sonst vortrefflicher Abhandlung</span>. Eben so ist es mit der <span class="weight-bold ">grammatischen Homonymie</span>, wenn nämlich ganz verschiedene Biegungen gleich lauten. Dieses Gebrechen entsteht meistens aus der Abstumpfung, und nimmt daher bei nicht fixirten Sprachen, wie bisher bei der unsrigen, immer zu. Sollte es nicht aber auch ursprüngliche grammatische Homonymien geben, die symbolisch sind? ZB. logisch betrachtet ist es gleichgültig ob Subject und Object belebte Wesen oder unbelebte Dinge sind; imaginativ aber keinesweges, denn das Unbelebte handelt und leidet nicht eigentlich: es wirkt und erfährt Wirkungen. Diese neutrale Stellung wird nun durch die Gleichheit des Accusativus und Nominativus der Neutra [angedeutet], welche deswegen im Sanskrit, im Griechischen und Lateinischen eine wahre Schönheit ist. Im Deutschen ist es keine Schönheit mehr, weil so viele masculina und sämtliche feminina diese Eigenschaft mit den neutris gemein haben.<br>Ich kehre von meinen endlosen Abschweifungen zurück, um zu <span class="index-20049 tp-101736 ">Ihrer Abhandlung</span> eine kleine historische Bemerkung nachzutragen. Sie bemerken <span class="slant-italic ">p</span>. 1, daß die Chinesen die Europäische Buchstabenschrift verschmäht haben. Aber die Unmöglichkeit, sie ihrer Sprache anzueignen, erhellet doch noch weit stärker aus der unläugbaren Thatsache, daß die Indische Buchstabenschrift von den ersten Buddhistischen Missionaren überbracht worden war. <span class="index-3543 tp-101737 ">Rémusat</span> hat in <span class="index-20067 tp-101773 ">einem eignen Aufsatze</span>, ich weiß nicht mehr in <span class="index-5233 tp-101774 ">welcher Zeitschrift</span>, die Weise geschildert, wie ein chinesischer Autor von dieser fremden Theorie der Laute Rechenschaft giebt. <span class="index-19507 tp-101738 ">Der Baron Schilling von Canstadt</span> hat mir ein chinesisches Buch gezeigt, wo in einer Columne indische Sylben standen, in der nächsten die Lautbezeichnung, in chinesischer Schrift, in einer dritten die Bedeutung. Ohne Zweifel waren es <span class="slant-italic ">mantra</span>’s, ich hatte nicht Muße es näher zu untersuchen.<br>Nun noch einiges über meine französischen Kritiker und meine zu machenden Antikritiken. Wird es Ew. Excellenz unangenehm seyn, wenn ich in der Nachbarschaft Ihres so milden und ruhigen Aufsatzes mir einigen Spott über <span class="index-900 tp-101739 ">Chézy</span> und <span class="index-3590 tp-101740 ">Langlois</span> erlaube? Nach Ihrer gütigen Gesinnung für mich hatten die Artikel des letzteren Sie indignirt, und Sie hatten die magistrale Recension noch nicht gelesen. Auf <span class="index-2385 tp-101741 ">Colebrooke</span> haben sie denselben Eindruck gemacht. Er <span class="doc-4128 ">schrieb mir</span>: <span class="slant-italic ">The articles, to which you allude in </span><span class="slant-italic index-3520 tp-101742 ">the Journal Asiatique</span><span class="slant-italic ">, had not escaped me. I regretted to observe the tone of them. Such is not the spirit, which fellow-labourers in the great cause of Oriental litterature should evince towards each other</span>. Nun stellen Sie sich meine Ataraxie vor: bis jetzt eben, wo ich Ihre Bemerkungen genau von neuem durchging, hatte ich jene kaum flüchtig gelesen. Freilich wußte ich im voraus, daß Chézys Eifersucht zu einer wahren Wuth gesteigert war. Dieses dauert noch immer fort, und ist eine wahre Tragi-Komödie. Seine Absicht war im <span class="slant-italic ">Journal Asiatique</span> mich noch weit gröber anzugreifen, aber Rémusat protestirte nachdrücklich dagegen, und so wurden dem Langlois die Höflichkeiten in seinem ersten Artikel abgedrungen.<br>In <span class="index-292 tp-101743 ">London</span> bat ich Colebrooke, für meine Rechnung Commentare des Bhagavad Gita aus <span class="index-2552 tp-101744 ">Calcutta</span> zu verschreiben. Ich gedachte erst jede Beantwortung der Kritiken bis auf deren Ankunft zu verschieben, weil es sonst gewissermaßen ein Kampf mit ungleichen Waffen ist, da meine Gegner sich immer auf die Autorität des Scholiasten berufen. Indessen, da die Commentare leider nicht ankommen, so werden die Delinquenten doch nun wohl bei den nächsten Assisen vorgenommen werden müssen. Ich besitze nur das 2<span class="offset-4 underline-1 ">te</span> Capitel der Subôdhinê, in meiner eignen Abschrift; und dieses leistet mir schon gute Dienste. Zuverläßig hat Langlois – folglich auch Chézy – den Commentator häufig misverstanden. Er hat <span class="slant-italic ">Cahier</span> 34, <span class="slant-italic ">p</span>. 248 <span class="slant-italic ">ad</span> Bh.G. XI, 22, nicht gemerkt, daß das von ihm abgeschriebene Scholion eine Citation aus <span class="index-3870 tp-101745 ">den Véda’s</span> enthält.<br>Folgendes hätte mir gleich beim Empfange Ihres Schreibens einfallen sollen, und ich hole es mit Beschämung nach. <span class="index-2566 tp-101746 ">Mein Schüler</span> hat einen vollständigen und sauber geschriebenen <span class="slant-italic ">Index Verborum </span>zur Bhagavad Gita verfertigt: könnte dieser Ew. Excellenz bei der Beschäftigung mit dem Inhalte bequem seyn, so bin ich bereit ihn auf eine Zeitlang zu übersenden. Freilich müßte ich ihn bei der Antikritik zur Hand haben, aber diese kann ich wohl vorher abthun.<br>Ich bin fast entschlossen, sie französisch zu schreiben, damit sie doch an die rechte Adresse gelangt.<br>Wenn die Tugend in einer Mitte zwischen zwei Extremen besteht, so übe ich sie beim Briefwechsel gewiß nicht aus, indem ich entweder gar nicht oder endlos lange Briefe schreibe. Ich schließe mit dem Versprechen, mich wo möglich in beiden Punkten zu bessern. Mit unwandelbarer Verehrung und Ergebenheit<br>Ew. Excellenz<br>gehorsamster <br>AWvSchlegel.<br>Eine Sendung von einigen gedruckten Sachen, lateinischen und deutschen, wird hoffentlich richtig angekommen seyn.' $isaprint = true $isnewtranslation = false $statemsg = 'betamsg13' $cittitle = '' $description = 'August Wilhelm von Schlegel an Wilhelm von Humboldt am 21.02.1826, Bonn' $adressatort = 'Unknown' $absendeort = 'Bonn <a class="gndmetadata" target="_blank" href="http://d-nb.info/gnd/1001909-1">GND</a>' $date = '21.02.1826' $adressat = array( (int) 2949 => array( 'ID' => '2949', 'project' => '1', 'timecreate' => '2013-10-17 13:02:22', 'timelastchg' => '2018-01-11 15:52:48', 'key' => 'AWS-ap-00av', 'docTyp' => array( 'name' => 'Person', 'id' => '39' ), '39_name' => 'Humboldt, Wilhelm von', '39_geschlecht' => 'm', '39_gebdatum' => '1767-06-22', '39_toddatum' => '1835-04-08', '39_pdb' => 'GND', '39_dbid' => '118554727', '39_quellen' => 'NDB@https://www.deutsche-biographie.de/gnd118554727.html#ndbcontent@ ADB@https://www.deutsche-biographie.de/gnd118554727.html#adbcontent@ WBIS@http://db.saur.de/WBIS/basicSearch.jsf@J023-835-2@ Wikipedia@https://de.wikipedia.org/wiki/Wilhelm_von_Humboldt@', '39_geburtsort' => array( 'ID' => '2275', 'content' => 'Potsdam', 'bemerkung' => 'GND:4046948-7', 'LmAdd' => array([maximum depth reached]) ), '39_sterbeort' => array( 'ID' => '10056', 'content' => 'Tegel', 'bemerkung' => 'GND:5007835-5', 'LmAdd' => array([maximum depth reached]) ), '39_lebenwirken' => 'Politiker, Sprachforscher, Publizist, Philosoph Wilhelm von Humboldt wuchs auf Schloss Tegel auf, dem Familienbesitz der Humboldts. Ab 1787 studierte Wilhelm zusammen mit seinem Bruder Alexander an der Universität in Frankfurt (Oder) Rechtswissenschaften. Ein Jahr später wechselte er an die Universität Göttingen, wo er den gleichfalls dort studierenden AWS kennenlernte. 1789 führte ihn eine Reise in das revolutionäre Paris. Anfang 1790 trat er nach Beendigung des Studiums in den Staatsdienst und erhielt eine Anstellung im Justizdepartement. 1791 heiratete er Caroline von Dacheröden, die Tochter eines preußischen Kammergerichtsrates. Im selben Jahr schied er aus dem Staatsdienst aus, um auf den Gütern der Familie von Dacheröden seine Studien der altgriechischen Sprache, Kultur, Kunst und Philosophie fortzusetzen. 1794 zog er nach Jena. Humboldt fungierte als konstruktiver Kritiker und gelehrter Ratgeber für die Protagonisten der Weimarer Klassik. Ab November 1797 lebte er in Paris, um seine Studien fortzuführen. Ausgiebige Reisen nach Spanien dienten auch der Erforschung der baskischen Kultur und Sprache. Von 1802 bis 1808 agierte Humboldt als preußischer Gesandter beim Heiligen Stuhl in Rom. Mit der Aufgabe der konsularischen Vertretung war Humboldt zeitlich nicht überfordert, so dass er genug Gelegenheit hatte, seine Studien weiter zu betreiben und sein Domizil zu einem gesellschaftlichen Mittelpunkt zu machen. 1809 wurde er Sektionschef für Kultus und Unterricht im Ministerium des Innern in Berlin. Humboldt galt als liberaler Bildungsreformer. Zu seinen Leistungen gehören ein neu gegliedertes Bildungssystem, das allen Schichten die Möglichkeit des Zugangs zu Bildung zusichern sollte, und die Vereinheitlichung der Abschlussprüfungen. Als weiterer Meilenstein kann Humboldts Beteiligung bei der Gründung der Universität Berlin gelten; zahlreiche renommierte Wissenschaftler konnten für die Lehrstühle gewonnen werden. Die Eröffnung der Universität im Oktober 1810 fand allerdings ohne Humboldt statt. Nach Auseinandersetzungen verließ er den Bildungssektor und ging als preußischer Gesandter nach Wien, später nach London. In dieser Funktion war er am Wiener Kongress beteiligt. 1819 schied er aus dem Staatsdienst aus und beschäftigte sich weiter mit sprachwissenschaftlichen Forschungen, darunter auch dem Sanskrit und dem Kâwi, der Sprache der indonesischen Insel Java. Wilhelms Bruder Alexander von Humboldt war ein bedeutender Naturforscher, die Brüder Humboldt gelten als die „preußischen Dioskuren“.', '39_namevar' => 'Humboldt, Friedrich Wilhelm Christian Karl Ferdinand von Humboldt, Carl W. von Humboldt, Wilhelm F. von Humboldt, Guillaume de Humboldt, Karl W. von Humboldt, Carl Wilhelm von Humboldt, G. de', '39_beziehung' => 'AWS kannte Wilhelm von Humboldt schon aus Göttinger Studentenzeiten, in Jena begegneten sie sich wieder. Schlegel war 1805 Gast Humboldts in Rom, zur Zeit von dessen preußischer Gesandtschaft. Humboldt und AWS korrespondierten auch über ihre sprachwissenschaftlichen Studien, von großer Kenntnis Humboldts zeugen die ausführlichen brieflichen Diskussionen über das Sanskrit. Humboldt steuerte Aufsätze zu Schlegels „Indischer Bibliothek“ bei. Beide Gelehrte begegneten sich mit großem Respekt, auch wenn sie nicht in allen fachlichen Überzeugungen übereinstimmten.', '39_status_person' => 'Vollständig', '39_sourcename0' => 'AWS-ap-00av-0.jpg', 'folders' => array( (int) 0 => 'Personen', (int) 1 => 'Personen' ), '_label' => '', '_descr' => '', '_model' => 'Person', '_model_title' => 'Person', '_model_titles' => 'People', '_url' => '' ) ) $adrCitation = 'Wilhelm von Humboldt' $absender = array() $absCitation = 'August Wilhelm von Schlegel' $percount = (int) 2 $notabs = false $tabs = array( 'text' => array( 'content' => 'Volltext Druck', 'exists' => '1' ), 'druck' => array( 'exists' => '1', 'content' => 'Digitalisat Druck' ) ) $parallelview = array( (int) 0 => '1', (int) 1 => '1' ) $dzi_imagesHand = array() $dzi_imagesDruck = array( (int) 0 => '/cake_fud/files/temp/images/dzi/AWS-aw-0231-0.jpg.xml', (int) 1 => '/cake_fud/files/temp/images/dzi/AWS-aw-0231-1.jpg.xml', (int) 2 => '/cake_fud/files/temp/images/dzi/AWS-aw-0231-2.jpg.xml', (int) 3 => '/cake_fud/files/temp/images/dzi/AWS-aw-0231-3.jpg.xml', (int) 4 => '/cake_fud/files/temp/images/dzi/AWS-aw-0231-4.jpg.xml', (int) 5 => '/cake_fud/files/temp/images/dzi/AWS-aw-0231-5.jpg.xml', (int) 6 => '/cake_fud/files/temp/images/dzi/AWS-aw-0231-6.jpg.xml', (int) 7 => '/cake_fud/files/temp/images/dzi/AWS-aw-0231-7.jpg.xml', (int) 8 => '/cake_fud/files/temp/images/dzi/AWS-aw-0231-8.jpg.xml', (int) 9 => '/cake_fud/files/temp/images/dzi/AWS-aw-0231-9.jpg.xml' ) $indexesintext = array( 'Namen' => array( (int) 0 => array( 'ID' => '113', 'indexID' => '11', 'indexContent' => 'Personen', 'content' => 'Adelung, Johann Christoph', 'comment' => array( [maximum depth reached] ), 'parentID' => '0', 'altBegriff' => '', 'LmAdd' => array([maximum depth reached]), 'textpassagen' => array([maximum depth reached]) ), (int) 1 => array( 'ID' => '2426', 'indexID' => '11', 'indexContent' => 'Personen', 'content' => 'Bopp, Franz', 'comment' => array( [maximum depth reached] ), 'parentID' => '0', 'altBegriff' => '', 'LmAdd' => array( [maximum depth reached] ), 'textpassagen' => array([maximum depth reached]) ), (int) 2 => array( 'ID' => '942', 'indexID' => '11', 'indexContent' => 'Personen', 'content' => 'Caesar, Gaius Iulius ', 'comment' => array( [maximum depth reached] ), 'parentID' => '0', 'altBegriff' => '', 'LmAdd' => array([maximum depth reached]), 'textpassagen' => array([maximum depth reached]) ), (int) 3 => array( 'ID' => '3715', 'indexID' => '11', 'indexContent' => 'Personen', 'content' => 'Carey, William ', 'comment' => array( [maximum depth reached] ), 'parentID' => '0', 'altBegriff' => '', 'LmAdd' => array([maximum depth reached]), 'textpassagen' => array([maximum depth reached]) ), (int) 4 => array( 'ID' => '900', 'indexID' => '11', 'indexContent' => 'Personen', 'content' => 'Chézy, Antoine Léonard de', 'comment' => array( [maximum depth reached] ), 'parentID' => '0', 'altBegriff' => '', 'LmAdd' => array( [maximum depth reached] ), 'textpassagen' => array([maximum depth reached]) ), (int) 5 => array( 'ID' => '2385', 'indexID' => '11', 'indexContent' => 'Personen', 'content' => 'Colebrooke, Henry T.', 'comment' => array( [maximum depth reached] ), 'parentID' => '0', 'altBegriff' => '', 'LmAdd' => array( [maximum depth reached] ), 'textpassagen' => array([maximum depth reached]) ), (int) 6 => array( 'ID' => '1899', 'indexID' => '11', 'indexContent' => 'Personen', 'content' => 'Grimm, Jacob', 'comment' => array( [maximum depth reached] ), 'parentID' => '0', 'altBegriff' => '', 'LmAdd' => array( [maximum depth reached] ), 'textpassagen' => array([maximum depth reached]) ), (int) 7 => array( 'ID' => '3590', 'indexID' => '11', 'indexContent' => 'Personen', 'content' => 'Langlois, Alexandre ', 'comment' => array( [maximum depth reached] ), 'parentID' => '0', 'altBegriff' => '', 'LmAdd' => array([maximum depth reached]), 'textpassagen' => array([maximum depth reached]) ), (int) 8 => array( 'ID' => '2566', 'indexID' => '11', 'indexContent' => 'Personen', 'content' => 'Lassen, Christian', 'comment' => array( [maximum depth reached] ), 'parentID' => '0', 'altBegriff' => '', 'LmAdd' => array( [maximum depth reached] ), 'textpassagen' => array([maximum depth reached]) ), (int) 9 => array( 'ID' => '146', 'indexID' => '11', 'indexContent' => 'Personen', 'content' => 'Plato', 'comment' => array( [maximum depth reached] ), 'parentID' => '0', 'altBegriff' => '', 'LmAdd' => array([maximum depth reached]), 'textpassagen' => array([maximum depth reached]) ), (int) 10 => array( 'ID' => '3543', 'indexID' => '11', 'indexContent' => 'Personen', 'content' => 'Rémusat, Abel ', 'comment' => array( [maximum depth reached] ), 'parentID' => '0', 'altBegriff' => '', 'LmAdd' => array( [maximum depth reached] ), 'textpassagen' => array([maximum depth reached]) ), (int) 11 => array( 'ID' => '19507', 'indexID' => '11', 'indexContent' => 'Personen', 'content' => 'Schilling von Cannstatt, Paul Ludwig', 'comment' => array( [maximum depth reached] ), 'parentID' => '0', 'altBegriff' => 'Paul Ludwig Schilling von Cannstatt', 'LmAdd' => array( [maximum depth reached] ), 'textpassagen' => array([maximum depth reached]) ), (int) 12 => array( 'ID' => '8', 'indexID' => '11', 'indexContent' => 'Personen', 'content' => 'Schlegel, Friedrich von', 'comment' => array( [maximum depth reached] ), 'parentID' => '0', 'altBegriff' => '', 'LmAdd' => array( [maximum depth reached] ), 'textpassagen' => array([maximum depth reached]) ), (int) 13 => array( 'ID' => '3481', 'indexID' => '11', 'indexContent' => 'Personen', 'content' => 'Wilkins, Charles', 'comment' => array( [maximum depth reached] ), 'parentID' => '0', 'altBegriff' => '', 'LmAdd' => array( [maximum depth reached] ), 'textpassagen' => array([maximum depth reached]) ), (int) 14 => array( 'ID' => '2553', 'indexID' => '11', 'indexContent' => 'Personen', 'content' => 'Wilson, Horace H.', 'comment' => array( [maximum depth reached] ), 'parentID' => '0', 'altBegriff' => '', 'LmAdd' => array( [maximum depth reached] ), 'textpassagen' => array([maximum depth reached]) ) ), 'Orte' => array( (int) 0 => array( 'ID' => '887', 'indexID' => '10', 'indexContent' => 'Orte', 'content' => 'Bonn', 'comment' => array( [maximum depth reached] ), 'parentID' => '0', 'altBegriff' => '', 'LmAdd' => array([maximum depth reached]), 'textpassagen' => array([maximum depth reached]) ), (int) 1 => array( 'ID' => '2552', 'indexID' => '10', 'indexContent' => 'Orte', 'content' => 'Kalkutta', 'comment' => array( [maximum depth reached] ), 'parentID' => '0', 'altBegriff' => '', 'LmAdd' => array([maximum depth reached]), 'textpassagen' => array([maximum depth reached]) ), (int) 2 => array( 'ID' => '292', 'indexID' => '10', 'indexContent' => 'Orte', 'content' => 'London', 'comment' => array( [maximum depth reached] ), 'parentID' => '0', 'altBegriff' => '', 'LmAdd' => array([maximum depth reached]), 'textpassagen' => array([maximum depth reached]) ) ), 'Werke' => array( (int) 0 => array( 'ID' => '3764', 'indexID' => '12', 'indexContent' => 'Werke', 'content' => 'Bhagavadgītā', 'comment' => array( [maximum depth reached] ), 'parentID' => '0', 'altBegriff' => '', 'LmAdd' => array([maximum depth reached]), 'textpassagen' => array([maximum depth reached]) ), (int) 1 => array( 'ID' => '9960', 'indexID' => '12', 'indexContent' => 'Werke', 'content' => 'Bopp, Franz: Vergleichende Zergliederung des Sanskrits und der mit ihm verwandten Sprachen', 'comment' => array( [maximum depth reached] ), 'parentID' => '0', 'altBegriff' => '', 'LmAdd' => array([maximum depth reached]), 'textpassagen' => array([maximum depth reached]) ), (int) 2 => array( 'ID' => '7022', 'indexID' => '12', 'indexContent' => 'Werke', 'content' => 'Carey, William: A Grammar of the Sungskrit Language ', 'comment' => array( [maximum depth reached] ), 'parentID' => '0', 'altBegriff' => '', 'LmAdd' => array([maximum depth reached]), 'textpassagen' => array([maximum depth reached]) ), (int) 3 => array( 'ID' => '9946', 'indexID' => '12', 'indexContent' => 'Werke', 'content' => 'Humboldt, Wilhelm von: Ueber die Bhagavad Gitâ. Bemerkungen über die Langloissche Recension der Schlegelschen Bhagavad-Gitâ. In: Indische Bibliothek, 1826', 'comment' => array( [maximum depth reached] ), 'parentID' => '0', 'altBegriff' => '', 'LmAdd' => array([maximum depth reached]), 'textpassagen' => array([maximum depth reached]) ), (int) 4 => array( 'ID' => '20049', 'indexID' => '12', 'indexContent' => 'Werke', 'content' => 'Humboldt, Wilhelm von: Ueber die Buchstabenschrift und ihren Zusammenhang mit dem Sprachbau. Gelesen in der Akademie der Wissenschaften am 20. Mai 1824', 'comment' => array( [maximum depth reached] ), 'parentID' => '0', 'altBegriff' => '', 'LmAdd' => array([maximum depth reached]), 'textpassagen' => array([maximum depth reached]) ), (int) 5 => array( 'ID' => '14597', 'indexID' => '12', 'indexContent' => 'Werke', 'content' => 'Langlois, Alexandre: Schlegel, August Wilhelm von (Hg.): Bhagavad-Gita (Rezension. In: Journal Asiatique, 1824–1825)', 'comment' => array( [maximum depth reached] ), 'parentID' => '0', 'altBegriff' => '', 'LmAdd' => array([maximum depth reached]), 'textpassagen' => array([maximum depth reached]) ), (int) 6 => array( 'ID' => '5233', 'indexID' => '12', 'indexContent' => 'Werke', 'content' => 'Rémusat, Abel: Mélanges Asiatiques, ou Choix de morceaux de critique, et de mémoires relatifs aux religions, aux. sciences, à lʼhistoire, et à la géographie des nations orientales', 'comment' => array( [maximum depth reached] ), 'parentID' => '0', 'altBegriff' => '', 'LmAdd' => array([maximum depth reached]), 'textpassagen' => array([maximum depth reached]) ), (int) 7 => array( 'ID' => '20067', 'indexID' => '12', 'indexContent' => 'Werke', 'content' => 'Rémusat, Abel: Sur un vocabulaire philosophique en cinq langues, imprimé à Peking', 'comment' => array( [maximum depth reached] ), 'parentID' => '0', 'altBegriff' => '', 'LmAdd' => array([maximum depth reached]), 'textpassagen' => array([maximum depth reached]) ), (int) 8 => array( 'ID' => '2543', 'indexID' => '12', 'indexContent' => 'Werke', 'content' => 'Schlegel, August Wilhelm von (Hg.): Bhagavad-Gita', 'comment' => array( [maximum depth reached] ), 'parentID' => '0', 'altBegriff' => '', 'LmAdd' => array([maximum depth reached]), 'textpassagen' => array([maximum depth reached]) ), (int) 9 => array( 'ID' => '3870', 'indexID' => '12', 'indexContent' => 'Werke', 'content' => 'Veda', 'comment' => array( [maximum depth reached] ), 'parentID' => '0', 'altBegriff' => '', 'LmAdd' => array([maximum depth reached]), 'textpassagen' => array([maximum depth reached]) ), (int) 10 => array( 'ID' => '5662', 'indexID' => '12', 'indexContent' => 'Werke', 'content' => 'Wilkins, Charles: Bhagavat-geeta, or Dialogues of Kreeshna and Arjoon', 'comment' => array( [maximum depth reached] ), 'parentID' => '0', 'altBegriff' => '', 'LmAdd' => array([maximum depth reached]), 'textpassagen' => array([maximum depth reached]) ) ), 'Periodika' => array( (int) 0 => array( 'ID' => '2322', 'indexID' => '13', 'indexContent' => 'Periodika', 'content' => 'Indische Bibliothek. Eine Zeitschrift von August Wilhelm von Schlegel', 'comment' => array( [maximum depth reached] ), 'parentID' => '0', 'altBegriff' => '', 'LmAdd' => array([maximum depth reached]), 'textpassagen' => array([maximum depth reached]) ), (int) 1 => array( 'ID' => '3520', 'indexID' => '13', 'indexContent' => 'Periodika', 'content' => 'Journal Asiatique', 'comment' => array( [maximum depth reached] ), 'parentID' => '0', 'altBegriff' => '', 'LmAdd' => array([maximum depth reached]), 'textpassagen' => array([maximum depth reached]) ) ) ) $right = '' $left = 'druck' $handschrift = array() $druck = array( 'Bibliographische Angabe' => 'Briefwechsel zwischen Wilhelm von Humboldt und August Wilhelm Schlegel. Hg. v. Albert Leitzmann. Halle 1908, S. 183‒192.', 'Incipit' => '„Bonn den 21sten Februar 1826.<br>Ew. Excellenz haben die gerechteste Ursache von der Welt, ungehalten zu seyn. Daß Sie den Briefwechsel eine [...]“' ) $docmain = array( 'ID' => '3165', 'project' => '1', 'timecreate' => '2013-11-12 08:46:40', 'timelastchg' => '2020-03-04 15:25:51', 'key' => 'AWS-aw-0231', 'docTyp' => array( 'name' => 'Brief', 'id' => '36' ), 'index_personen_11' => array( (int) 0 => array( 'ID' => '113', 'indexID' => '11', 'indexContent' => 'Personen', 'content' => 'Adelung, Johann Christoph', 'comment' => 'GND:118500651', 'parentID' => '0', 'altBegriff' => '', 'LmAdd' => array([maximum depth reached]), 'textpassagen' => array([maximum depth reached]) ), (int) 1 => array( 'ID' => '2426', 'indexID' => '11', 'indexContent' => 'Personen', 'content' => 'Bopp, Franz', 'comment' => 'GND:118659332', 'parentID' => '0', 'altBegriff' => '', 'LmAdd' => array( [maximum depth reached] ), 'textpassagen' => array([maximum depth reached]) ), (int) 2 => array( 'ID' => '942', 'indexID' => '11', 'indexContent' => 'Personen', 'content' => 'Caesar, Gaius Iulius ', 'comment' => 'GND:118518275', 'parentID' => '0', 'altBegriff' => '', 'LmAdd' => array([maximum depth reached]), 'textpassagen' => array([maximum depth reached]) ), (int) 3 => array( 'ID' => '3715', 'indexID' => '11', 'indexContent' => 'Personen', 'content' => 'Carey, William ', 'comment' => 'GND:118667106', 'parentID' => '0', 'altBegriff' => '', 'LmAdd' => array([maximum depth reached]), 'textpassagen' => array([maximum depth reached]) ), (int) 4 => array( 'ID' => '900', 'indexID' => '11', 'indexContent' => 'Personen', 'content' => 'Chézy, Antoine Léonard de', 'comment' => 'GND:11650448X', 'parentID' => '0', 'altBegriff' => '', 'LmAdd' => array( [maximum depth reached] ), 'textpassagen' => array([maximum depth reached]) ), (int) 5 => array( 'ID' => '2385', 'indexID' => '11', 'indexContent' => 'Personen', 'content' => 'Colebrooke, Henry T.', 'comment' => 'GND:116636688', 'parentID' => '0', 'altBegriff' => '', 'LmAdd' => array( [maximum depth reached] ), 'textpassagen' => array([maximum depth reached]) ), (int) 6 => array( 'ID' => '1899', 'indexID' => '11', 'indexContent' => 'Personen', 'content' => 'Grimm, Jacob', 'comment' => 'GND:118542257', 'parentID' => '0', 'altBegriff' => '', 'LmAdd' => array( [maximum depth reached] ), 'textpassagen' => array([maximum depth reached]) ), (int) 7 => array( 'ID' => '3590', 'indexID' => '11', 'indexContent' => 'Personen', 'content' => 'Langlois, Alexandre ', 'comment' => 'GND:124071287', 'parentID' => '0', 'altBegriff' => '', 'LmAdd' => array([maximum depth reached]), 'textpassagen' => array([maximum depth reached]) ), (int) 8 => array( 'ID' => '2566', 'indexID' => '11', 'indexContent' => 'Personen', 'content' => 'Lassen, Christian', 'comment' => 'GND:119512831', 'parentID' => '0', 'altBegriff' => '', 'LmAdd' => array( [maximum depth reached] ), 'textpassagen' => array([maximum depth reached]) ), (int) 9 => array( 'ID' => '146', 'indexID' => '11', 'indexContent' => 'Personen', 'content' => 'Plato', 'comment' => 'GND:118594893', 'parentID' => '0', 'altBegriff' => '', 'LmAdd' => array([maximum depth reached]), 'textpassagen' => array([maximum depth reached]) ), (int) 10 => array( 'ID' => '3543', 'indexID' => '11', 'indexContent' => 'Personen', 'content' => 'Rémusat, Abel ', 'comment' => 'GND:100318371', 'parentID' => '0', 'altBegriff' => '', 'LmAdd' => array( [maximum depth reached] ), 'textpassagen' => array([maximum depth reached]) ), (int) 11 => array( 'ID' => '19507', 'indexID' => '11', 'indexContent' => 'Personen', 'content' => 'Schilling von Cannstatt, Paul Ludwig', 'comment' => 'GND: 118607685', 'parentID' => '0', 'altBegriff' => 'Paul Ludwig Schilling von Cannstatt', 'LmAdd' => array( [maximum depth reached] ), 'textpassagen' => array([maximum depth reached]) ), (int) 12 => array( 'ID' => '8', 'indexID' => '11', 'indexContent' => 'Personen', 'content' => 'Schlegel, Friedrich von', 'comment' => 'GND:118607987', 'parentID' => '0', 'altBegriff' => '', 'LmAdd' => array( [maximum depth reached] ), 'textpassagen' => array([maximum depth reached]) ), (int) 13 => array( 'ID' => '3481', 'indexID' => '11', 'indexContent' => 'Personen', 'content' => 'Wilkins, Charles', 'comment' => 'GND:129794007', 'parentID' => '0', 'altBegriff' => '', 'LmAdd' => array( [maximum depth reached] ), 'textpassagen' => array([maximum depth reached]) ), (int) 14 => array( 'ID' => '2553', 'indexID' => '11', 'indexContent' => 'Personen', 'content' => 'Wilson, Horace H.', 'comment' => 'GND:11739775X', 'parentID' => '0', 'altBegriff' => '', 'LmAdd' => array( [maximum depth reached] ), 'textpassagen' => array([maximum depth reached]) ) ), 'index_werke_12' => array( (int) 0 => array( 'ID' => '3764', 'indexID' => '12', 'indexContent' => 'Werke', 'content' => 'Bhagavadgītā', 'comment' => 'GND:4129499-3', 'parentID' => '0', 'altBegriff' => '', 'LmAdd' => array([maximum depth reached]), 'textpassagen' => array([maximum depth reached]) ), (int) 1 => array( 'ID' => '9960', 'indexID' => '12', 'indexContent' => 'Werke', 'content' => 'Bopp, Franz: Vergleichende Zergliederung des Sanskrits und der mit ihm verwandten Sprachen', 'comment' => 'Link:https://books.google.de/books?id=jUtFAAAAcAAJ&dq=k%C3%B6nigliche%20akademie%20der%20wissenschaften%20berlin%201824%20bopp&hl=de&pg=PP7#v=onepage&q&f=false', 'parentID' => '0', 'altBegriff' => '', 'LmAdd' => array([maximum depth reached]), 'textpassagen' => array([maximum depth reached]) ), (int) 2 => array( 'ID' => '7022', 'indexID' => '12', 'indexContent' => 'Werke', 'content' => 'Carey, William: A Grammar of the Sungskrit Language ', 'comment' => '', 'parentID' => '0', 'altBegriff' => '', 'LmAdd' => array([maximum depth reached]), 'textpassagen' => array([maximum depth reached]) ), (int) 3 => array( 'ID' => '9946', 'indexID' => '12', 'indexContent' => 'Werke', 'content' => 'Humboldt, Wilhelm von: Ueber die Bhagavad Gitâ. Bemerkungen über die Langloissche Recension der Schlegelschen Bhagavad-Gitâ. In: Indische Bibliothek, 1826', 'comment' => 'Humboldt, Wilhelm von (1826): Ueber die Bhagavad Gitâ. Bemerkungen über die Langloissche Recension der Schlegelschen Bhagavad-Gitâ. An Schlegel nach Bonn am 17. Junius 1825. geschickt. In: Indische Bibliothek 2, Heft 2, S. 218–258; Heft 3, S. 328–372', 'parentID' => '0', 'altBegriff' => '', 'LmAdd' => array([maximum depth reached]), 'textpassagen' => array([maximum depth reached]) ), (int) 4 => array( 'ID' => '20049', 'indexID' => '12', 'indexContent' => 'Werke', 'content' => 'Humboldt, Wilhelm von: Ueber die Buchstabenschrift und ihren Zusammenhang mit dem Sprachbau. Gelesen in der Akademie der Wissenschaften am 20. Mai 1824', 'comment' => '', 'parentID' => '0', 'altBegriff' => '', 'LmAdd' => array([maximum depth reached]), 'textpassagen' => array([maximum depth reached]) ), (int) 5 => array( 'ID' => '14597', 'indexID' => '12', 'indexContent' => 'Werke', 'content' => 'Langlois, Alexandre: Schlegel, August Wilhelm von (Hg.): Bhagavad-Gita (Rezension. In: Journal Asiatique, 1824–1825)', 'comment' => 'Langlois, Alexandre (1824–1825): Critique littéraire. Bhagavad-Gitâ, id est, Θεσπέσιον μελος, etc., traduit par M. A.-G. de Schlégel. In: Journal Asiatique 4, 1824, S. 105–116; 236–256; 5, 1824, S. 240–252; 6, 1825, S. 232–250', 'parentID' => '0', 'altBegriff' => '', 'LmAdd' => array([maximum depth reached]), 'textpassagen' => array([maximum depth reached]) ), (int) 6 => array( 'ID' => '5233', 'indexID' => '12', 'indexContent' => 'Werke', 'content' => 'Rémusat, Abel: Mélanges Asiatiques, ou Choix de morceaux de critique, et de mémoires relatifs aux religions, aux. sciences, à lʼhistoire, et à la géographie des nations orientales', 'comment' => '', 'parentID' => '0', 'altBegriff' => '', 'LmAdd' => array([maximum depth reached]), 'textpassagen' => array([maximum depth reached]) ), (int) 7 => array( 'ID' => '20067', 'indexID' => '12', 'indexContent' => 'Werke', 'content' => 'Rémusat, Abel: Sur un vocabulaire philosophique en cinq langues, imprimé à Peking', 'comment' => '', 'parentID' => '0', 'altBegriff' => '', 'LmAdd' => array([maximum depth reached]), 'textpassagen' => array([maximum depth reached]) ), (int) 8 => array( 'ID' => '2543', 'indexID' => '12', 'indexContent' => 'Werke', 'content' => 'Schlegel, August Wilhelm von (Hg.): Bhagavad-Gita', 'comment' => '', 'parentID' => '0', 'altBegriff' => '', 'LmAdd' => array([maximum depth reached]), 'textpassagen' => array([maximum depth reached]) ), (int) 9 => array( 'ID' => '3870', 'indexID' => '12', 'indexContent' => 'Werke', 'content' => 'Veda', 'comment' => 'GND:4062426-2', 'parentID' => '0', 'altBegriff' => '', 'LmAdd' => array([maximum depth reached]), 'textpassagen' => array([maximum depth reached]) ), (int) 10 => array( 'ID' => '5662', 'indexID' => '12', 'indexContent' => 'Werke', 'content' => 'Wilkins, Charles: Bhagavat-geeta, or Dialogues of Kreeshna and Arjoon', 'comment' => '', 'parentID' => '0', 'altBegriff' => '', 'LmAdd' => array([maximum depth reached]), 'textpassagen' => array([maximum depth reached]) ) ), 'index_orte_10' => array( (int) 0 => array( 'ID' => '887', 'indexID' => '10', 'indexContent' => 'Orte', 'content' => 'Bonn', 'comment' => 'GND:1001909-1', 'parentID' => '0', 'altBegriff' => '', 'LmAdd' => array([maximum depth reached]), 'textpassagen' => array([maximum depth reached]) ), (int) 1 => array( 'ID' => '2552', 'indexID' => '10', 'indexContent' => 'Orte', 'content' => 'Kalkutta', 'comment' => 'GND:4029344-0', 'parentID' => '0', 'altBegriff' => '', 'LmAdd' => array([maximum depth reached]), 'textpassagen' => array([maximum depth reached]) ), (int) 2 => array( 'ID' => '292', 'indexID' => '10', 'indexContent' => 'Orte', 'content' => 'London', 'comment' => 'GND:4074335-4', 'parentID' => '0', 'altBegriff' => '', 'LmAdd' => array([maximum depth reached]), 'textpassagen' => array([maximum depth reached]) ) ), 'index_periodika_13' => array( (int) 0 => array( 'ID' => '2322', 'indexID' => '13', 'indexContent' => 'Periodika', 'content' => 'Indische Bibliothek. Eine Zeitschrift von August Wilhelm von Schlegel', 'comment' => '', 'parentID' => '0', 'altBegriff' => '', 'LmAdd' => array([maximum depth reached]), 'textpassagen' => array([maximum depth reached]) ), (int) 1 => array( 'ID' => '3520', 'indexID' => '13', 'indexContent' => 'Periodika', 'content' => 'Journal Asiatique', 'comment' => '', 'parentID' => '0', 'altBegriff' => '', 'LmAdd' => array([maximum depth reached]), 'textpassagen' => array([maximum depth reached]) ) ), '36_html' => '<span class="index-887 tp-101698 ">Bonn</span> den 21sten Februar 1826.<br>Ew. Excellenz haben die gerechteste Ursache von der Welt, ungehalten zu seyn. Daß Sie den Briefwechsel eine Zeitlang hatten ruhen lassen, war ganz in der Ordnung, und Ew. Excellenz durften darüber keine Sylbe verlieren. Ich besitze eine reichhaltige Sammlung Ihrer Briefe, woraus ich oft neue Anregung und Belehrung schöpfe. Jede Bereicherung ist unendlich willkommen. Wenn aber Ew. Excellenz unter so tiefen und weitumfassenden Forschungen, die Sie mit unermüdlicher Thätigkeit verfolgen, keine Muße finden, mir zu schreiben, so bescheide ich mich gern, daß mein persönliches Interesse gegen das allgemeine zurückstehen muß, und bin zufrieden, wenn ich nur auf andern Wegen die Gewißheit von Ihrer ununterbrochenen Heiterkeit und Gesundheit erhalte; und dieß war in jenem Zeitraume der Fall. Daß ich hingegen eine solche Sendung, wie Ihre letzte ist, so lange unbeantwortet lassen konnte, ist unerhört und unverantwortlich. Ich will nicht versuchen, es zu entschuldigen; erklären könnte ich es wohl aus der Beschaffenheit der Störungen, die ununterbrochen auf einander folgten, und mit solchen Studien ganz unverträglich sind. Unter andern mußte ich, gleich nach Empfang <span class="doc-3144 ">Ihres Schreibens</span>, außer dem Rectorat über zwei Monate die Stelle des Regierungs-Bevollmächtigten vertreten. Doch ich müßte meinen ganzen zeitherigen Lebenslauf erzählen, und dieß wäre ein unnützer Zeitverlust. Ich komme lieber gleich zur Hauptsache.<br>Ew. Excellenz können nicht bezweifeln, daß ich mich sehr glücklich schätze, mit <span class="index-9946 tp-101719 ">Ihren Bemerkungen über die Bhagavad Gita</span> <span class="index-2322 tp-101718 ">meine Indische Bibliothek</span> auszuzieren. Das <span class="index-2543 tp-101720 ">meiner Übersetzung</span> ertheilte Lob ist freilich wohl etwas zu stark, um es selbst abdrucken zu lassen: aber wer mag sich entschließen, so etwas auszuschlagen? Nur des Sanskrit kundige Leser können das einzelne verstehen; aber alle denkenden Leser werden bei den vortrefflichen allgemeinen Bemerkungen ihre Rechnung finden. Leider kann ich noch nicht melden, daß an der Indischen Bibliothek wirklich gedruckt wird. Im Kopfe habe ich den Stoff zu mehreren Heften fertig, aber auf dem Papiere sehr weniges. Wie sehr ich gestört gewesen, können Ew. Excellenz eben daraus ermessen, daß ich, ungeachtet des neuen Antriebes, den Ihr Aufsatz mir gab, dennoch kein Heft zu Stande gebracht.<br>Ich war schon lange gesonnen, <span class="weight-bold ">Nachträge zur Kritik und Auslegung der Bhagavad Gita </span>zu geben: da werden sich nun die Ihrigen vortrefflich anschließen. Wäre es aber nicht gut, <span class="index-14597 tp-101722 ">die betreffenden Stellen von </span><span class="index-14597 tp-101722 index-3590 tp-101721 ">Langlois</span> französisch mit abzudrucken? Meine etwanigen Nebenbemerkungen, beistimmend, bestätigend oder bezweifelnd, möchten, wenn Ew. Excellenz es genehmigen, in kleinerer Schrift unter die einzelnen Abschnitte, oder als Noten unter den Text gesetzt werden.<br>Die Erlaubniß, etwas als unrichtig wegzustreichen, ist mir zu bedenklich, um Gebrauch davon zu machen. Wo ich für jetzt nicht beistimmen kann, wird es meistens disputable Punkte betreffen. Indessen lege ich auf einem besondern Blatte einiges vor, was vielleicht Ew. Excellenz zur Zurücknahme oder Modification weniger Zeilen veranlassen könnte, und erwarte darüber Ihre Entscheidung.<br>Kaum wage ich eine schüchterne Bitte um die Auslassung eines einzigen Wortes, welches nur zweimal vorkommt. Es ist das Wort <span class="weight-bold ">pantheistisch</span>. Da hier die Lehre der Bhagavad Gita nicht im Ganzen erörtert wird, so kann es ja entbehrt werden, es dürfte bloß heißen: „in diesem System“. Überdieß steht es bei einem Satze, worin die christlichen Mystiker wohl so ziemlich mit dem Verfasser der Bhagavad Gita übereinstimmen. Hier bildet es ein Präjudiz als ob die Sache schon ausgemacht wäre. Wenn die Behauptung im allgemeinen ausgeführt wird, dann ist es etwas andres. <span class="index-8 tp-101723 ">Mein Bruder</span> hat schon früher die Lehre der Bhagavad Gita für Pantheismus erklärt. Ich habe ihm widersprochen, und behauptet, was ihn hiezu vermocht, seyen starke Ausdrücke von der dynamischen Allgegenwart. Ist zum reinen Theismus durchaus die Lehre von der Extramundanität der Gottheit erfoderlich? Die Immanenz des Weltalls lehrt <span class="index-3764 tp-101724 ">die Bhagavad Gita</span> freilich, unbeschadet der Emanation. Ist es im strengen Pantheismus möglich, die Gottheit von der Natur zu unterscheiden? Hört nicht alle Religion, alles ich und du, zwischen dem Gemüthe und der Gottheit auf? Ist damit die Lehre von der Vermittlung, von einer Herablassung der Gottheit um die Creatur zu sich heraufzuziehen, verträglich, welche doch so klar in der Bhagavad Gita vorgetragen wird? Ich habe ehemals die Schriften der Mystiker viel gelesen: mich dünkt, sie theilen sich in zwei Hauptclassen, die Theosophen und die Mystiker des Gefühls. Meines Erachtens stimmt mein Indischer Weiser so ziemlich mit den theosophischen Mystikern überein; weniger mit den letzteren, weil bei diesen der Sinn für die Natur ganz erloschen ist, welcher bei ihm in ursprünglicher mythologischer Fülle lebt.<br>Bei den scharfsinnigen Bemerkungen über die Bildung des philosophischen Sprachgebrauchs wage ich es, folgendes Ihrer Beurtheilung vorzulegen. In der Regel sind freilich die metaphysischen Ausdrücke von sinnlichen Vorstellungen übertragen; sollte es nicht aber auch in einigen Sprachen, und namentlich im Sanskrit, ursprünglich metaphysische Wörter geben? Z. B. <span class="slant-italic ">dēha</span> von <span class="slant-italic ">dih</span>, wie <span class="slant-italic ">dēs͗a</span> von <span class="slant-italic ">dis͗</span>, ganz etymologisch richtig. Nun heißt aber <span class="slant-italic ">dih</span> beschmieren, beflecken, besudeln. <span class="index-2553 tp-101747 ">Wilson</span> giebt zwar eine zweite Bedeutung, von der er es ableiten will. Aber ich kann mich nicht erinnern, das Verbum und insbesondre das häufige Participium <span class="slant-italic ">digdha</span> jemals anders als in der obigen Bedeutung gefunden zu haben. Auch steht in <span class="index-7022 tp-101726 ">dem Wurzel-Wörterbuch</span> bei <span class="index-3715 tp-101725 ">Carey</span> bloß <span class="slant-italic ">lipi</span>, in <span class="index-5662 tp-101728 ">der Englischen Übersetzung</span> bei <span class="index-3481 tp-101727 ">Wilkins</span> ebenfalls. Wunderlich genug steht aber dabei bloß Eine mit seiner Auslegung gar nicht übereinstimmende Definition <span class="slant-italic ">upachayē</span>, welches die zweite Bedeutung von Wilson ist. Wieder einmal ein Beispiel, wie unsere Elementar-Bücher noch beschaffen sind, und wie man sich überall selbst helfen, und die Augen offen haben muß! Wenn die zweite Bedeutung sich nicht praktisch bewährt, so bin ich sehr geneigt zu glauben, sie sei bloß von Indischen Grammatikern zum Behuf der Ableitung von <span class="slant-italic ">dēha</span> ersonnen. Ist es aber von <span class="slant-italic ">dih</span> in der Bedeutung von <span class="slant-italic ">lipi</span>, so liegt ja in dem einfachen Worte, wie im Keim, die ganze <span class="index-146 tp-101729 ">Platonische</span> Lehre. Auch die andre Ableitung hat schon etwas wissenschaftliches. – Wie dem aber auch sei, das ist gewiß, daß bei den Indiern die Speculation so uralt und ihr Einfluß so überwiegend war, daß der metaphysische Sprachgebrauch in das Leben, wenigstens in die epische Poesie zurückgekehrt ist, und diese Erscheinung ist einzig in ihrer Art.<br>Meine Ansicht hängt freilich mit andern vielleicht paradoxen und deswegen besser esoterisch bleibenden Meynungen zusammen. Ich glaube nämlich, daß es ursprünglich tellurische, siderische und spirituale Sprachen giebt. Dieß würde auf die Eintheilung nach den drei <span class="slant-italic ">gûńa</span>’s hinauslaufen. Reine Exemplare von den drei Gattungen lassen sich freilich nicht nachweisen, man dürfte aber wohl versuchen, die Sprachen nach dem vorwaltenden Prinzip zu classifiziren.<br>Während ich dieses schrieb, empfing ich <span class="index-20049 tp-101730 ">Ihre Abhandlung über die Buchstabenschrift</span>, die ich sogleich verschlungen habe. In der Hauptsache bin ich ganz einverstanden. Mein einziger Zweifel ist nur der, ob nicht jene urweltliche Genialität, die bei der Erfindung der Buchstabenschrift gewaltet, jenes klare Bewußtseyn von den mit den Sprachorganen vorgenommenen und möglicher Weise vorzunehmenden Handlungen, von der symbolischen Bedeutung der Laute, ihrer Beziehung zu einander u. s. w.; ob, sage ich, jenes der Sprache bei ihrer Ausbildung nicht dieselben Dienste habe leisten können, als das materielle Vorhandenseyn der Buchstabenschrift?<br>Die Abweichung unsrer Ansichten – ich sage es mit Mistrauen gegen meine eigne Meynung – bezieht sich auf den Ursprung, und den frühesten Gang der menschlichen Cultur. Ich kann unmöglich die ersten großen Grundlagen als den späten und allmähligen Erfolg eines experimentirenden Herumtappens betrachten; sie scheinen mir ein genialischer Wurf zu seyn, wo alles mit Einemmale da ist, wie beim Anfange des organischen Lebens. Die Urväter des Menschengeschlechtes – einige, nicht alle; denn ich fürchte, ich bin in der dreifachen Ketzerei begriffen, ein Präadamit, ein Coadamit und ein Postadamit zu seyn – vergleiche ich mit Menschen, welche die Fähigkeit besessen hätten, in einem dunkeln Schacht durch die Kraft ihrer eignen Augen zu sehen, während unsre Bergleute sich der Lampen und Laternen bedienen müssen. <span class="index-942 tp-101731 ">Julius Caesar</span> sagte, die Schrift habe das Gedächtniß zu Grunde gerichtet. Ist es nicht mit allen Dingen so? Je vollkommner die Hülfsmittel, desto mehr erlischt der inwohnende Sinn, das angebohrne Talent. Divinatorische Durchschauung der Natur, und von außen her erworbene Erfahrung scheinen mir die beiden Pole der menschlichen Cultur zu seyn; jenes der positive, dieses der negative. Wenn einmal in einem Zeitalter, wo das letzte Princip herrschend ist, jenes durchblitzt, so nimmt selbst das Experiment einen neuen Schwung, und die mechanischen Physiker, welche die Ideen läugnen, werden mehr von ihnen geleitet, als sie selbst wissen.<br>Um auf die Buchstabenschrift zurückzukommen, sie wäre also – da ihr Wesen in der Analyse der articulirten Laute besteht – <span class="slant-italic ">virtualiter</span> schon in der ältesten Zeit vorhanden gewesen, wenn es auch an zubereiteten Stoffen fehlte, um sie in Ausübung zu bringen.<br>Auch darin bin ich ganz einverstanden, daß eine gewisse todte und einförmige Regelmäßigkeit gar keine Vollkommenheit der Sprachen ist. <span class="index-113 tp-101732 ">Adelung</span> hatte ganz richtig bemerkt, daß in der Deutschen Sprache die starke Conjugation (nach ihm die anomale) der schwachen mehr und mehr Platz einräume. Aber der geistlose Grammatiker hielt dieß für eine Vervollkommung, während es doch nur eine Abstumpfung ist. Die Mannigfaltigkeit der Formen, zB. der Declinationen und Conjugationen scheint mir, wenigstens imaginativ, bedeutsam gewesen zu seyn, was nachher verloren ging. <span class="index-1899 tp-101733 ">Grimm</span> betrachtet alle Anomalien als später und zufällig entstanden. Dieses gilt von den meisten, aber ich muß auch ursprüngliche, symbolische Anomalien annehmen, z. B. die der Personal-Pronomina in unsrer Sprachfamilie, und diesen Gesichtspunkt vermißte ich in <span class="index-2426 tp-101734 ">Bopps</span> <span class="index-9960 tp-101735 ">sonst vortrefflicher Abhandlung</span>. Eben so ist es mit der <span class="weight-bold ">grammatischen Homonymie</span>, wenn nämlich ganz verschiedene Biegungen gleich lauten. Dieses Gebrechen entsteht meistens aus der Abstumpfung, und nimmt daher bei nicht fixirten Sprachen, wie bisher bei der unsrigen, immer zu. Sollte es nicht aber auch ursprüngliche grammatische Homonymien geben, die symbolisch sind? ZB. logisch betrachtet ist es gleichgültig ob Subject und Object belebte Wesen oder unbelebte Dinge sind; imaginativ aber keinesweges, denn das Unbelebte handelt und leidet nicht eigentlich: es wirkt und erfährt Wirkungen. Diese neutrale Stellung wird nun durch die Gleichheit des Accusativus und Nominativus der Neutra [angedeutet], welche deswegen im Sanskrit, im Griechischen und Lateinischen eine wahre Schönheit ist. Im Deutschen ist es keine Schönheit mehr, weil so viele masculina und sämtliche feminina diese Eigenschaft mit den neutris gemein haben.<br>Ich kehre von meinen endlosen Abschweifungen zurück, um zu <span class="index-20049 tp-101736 ">Ihrer Abhandlung</span> eine kleine historische Bemerkung nachzutragen. Sie bemerken <span class="slant-italic ">p</span>. 1, daß die Chinesen die Europäische Buchstabenschrift verschmäht haben. Aber die Unmöglichkeit, sie ihrer Sprache anzueignen, erhellet doch noch weit stärker aus der unläugbaren Thatsache, daß die Indische Buchstabenschrift von den ersten Buddhistischen Missionaren überbracht worden war. <span class="index-3543 tp-101737 ">Rémusat</span> hat in <span class="index-20067 tp-101773 ">einem eignen Aufsatze</span>, ich weiß nicht mehr in <span class="index-5233 tp-101774 ">welcher Zeitschrift</span>, die Weise geschildert, wie ein chinesischer Autor von dieser fremden Theorie der Laute Rechenschaft giebt. <span class="index-19507 tp-101738 ">Der Baron Schilling von Canstadt</span> hat mir ein chinesisches Buch gezeigt, wo in einer Columne indische Sylben standen, in der nächsten die Lautbezeichnung, in chinesischer Schrift, in einer dritten die Bedeutung. Ohne Zweifel waren es <span class="slant-italic ">mantra</span>’s, ich hatte nicht Muße es näher zu untersuchen.<br>Nun noch einiges über meine französischen Kritiker und meine zu machenden Antikritiken. Wird es Ew. Excellenz unangenehm seyn, wenn ich in der Nachbarschaft Ihres so milden und ruhigen Aufsatzes mir einigen Spott über <span class="index-900 tp-101739 ">Chézy</span> und <span class="index-3590 tp-101740 ">Langlois</span> erlaube? Nach Ihrer gütigen Gesinnung für mich hatten die Artikel des letzteren Sie indignirt, und Sie hatten die magistrale Recension noch nicht gelesen. Auf <span class="index-2385 tp-101741 ">Colebrooke</span> haben sie denselben Eindruck gemacht. Er <span class="doc-4128 ">schrieb mir</span>: <span class="slant-italic ">The articles, to which you allude in </span><span class="slant-italic index-3520 tp-101742 ">the Journal Asiatique</span><span class="slant-italic ">, had not escaped me. I regretted to observe the tone of them. Such is not the spirit, which fellow-labourers in the great cause of Oriental litterature should evince towards each other</span>. Nun stellen Sie sich meine Ataraxie vor: bis jetzt eben, wo ich Ihre Bemerkungen genau von neuem durchging, hatte ich jene kaum flüchtig gelesen. Freilich wußte ich im voraus, daß Chézys Eifersucht zu einer wahren Wuth gesteigert war. Dieses dauert noch immer fort, und ist eine wahre Tragi-Komödie. Seine Absicht war im <span class="slant-italic ">Journal Asiatique</span> mich noch weit gröber anzugreifen, aber Rémusat protestirte nachdrücklich dagegen, und so wurden dem Langlois die Höflichkeiten in seinem ersten Artikel abgedrungen.<br>In <span class="index-292 tp-101743 ">London</span> bat ich Colebrooke, für meine Rechnung Commentare des Bhagavad Gita aus <span class="index-2552 tp-101744 ">Calcutta</span> zu verschreiben. Ich gedachte erst jede Beantwortung der Kritiken bis auf deren Ankunft zu verschieben, weil es sonst gewissermaßen ein Kampf mit ungleichen Waffen ist, da meine Gegner sich immer auf die Autorität des Scholiasten berufen. Indessen, da die Commentare leider nicht ankommen, so werden die Delinquenten doch nun wohl bei den nächsten Assisen vorgenommen werden müssen. Ich besitze nur das 2<span class="offset-4 underline-1 ">te</span> Capitel der Subôdhinê, in meiner eignen Abschrift; und dieses leistet mir schon gute Dienste. Zuverläßig hat Langlois – folglich auch Chézy – den Commentator häufig misverstanden. Er hat <span class="slant-italic ">Cahier</span> 34, <span class="slant-italic ">p</span>. 248 <span class="slant-italic ">ad</span> Bh.G. XI, 22, nicht gemerkt, daß das von ihm abgeschriebene Scholion eine Citation aus <span class="index-3870 tp-101745 ">den Véda’s</span> enthält.<br>Folgendes hätte mir gleich beim Empfange Ihres Schreibens einfallen sollen, und ich hole es mit Beschämung nach. <span class="index-2566 tp-101746 ">Mein Schüler</span> hat einen vollständigen und sauber geschriebenen <span class="slant-italic ">Index Verborum </span>zur Bhagavad Gita verfertigt: könnte dieser Ew. Excellenz bei der Beschäftigung mit dem Inhalte bequem seyn, so bin ich bereit ihn auf eine Zeitlang zu übersenden. Freilich müßte ich ihn bei der Antikritik zur Hand haben, aber diese kann ich wohl vorher abthun.<br>Ich bin fast entschlossen, sie französisch zu schreiben, damit sie doch an die rechte Adresse gelangt.<br>Wenn die Tugend in einer Mitte zwischen zwei Extremen besteht, so übe ich sie beim Briefwechsel gewiß nicht aus, indem ich entweder gar nicht oder endlos lange Briefe schreibe. Ich schließe mit dem Versprechen, mich wo möglich in beiden Punkten zu bessern. Mit unwandelbarer Verehrung und Ergebenheit<br>Ew. Excellenz<br>gehorsamster <br>AWvSchlegel.<br>Eine Sendung von einigen gedruckten Sachen, lateinischen und deutschen, wird hoffentlich richtig angekommen seyn.', '36_xml' => '<p><placeName key="887">Bonn</placeName> den 21sten Februar 1826.<lb/>Ew. Excellenz haben die gerechteste Ursache von der Welt, ungehalten zu seyn. Daß Sie den Briefwechsel eine Zeitlang hatten ruhen lassen, war ganz in der Ordnung, und Ew. Excellenz durften darüber keine Sylbe verlieren. Ich besitze eine reichhaltige Sammlung Ihrer Briefe, woraus ich oft neue Anregung und Belehrung schöpfe. Jede Bereicherung ist unendlich willkommen. Wenn aber Ew. Excellenz unter so tiefen und weitumfassenden Forschungen, die Sie mit unermüdlicher Thätigkeit verfolgen, keine Muße finden, mir zu schreiben, so bescheide ich mich gern, daß mein persönliches Interesse gegen das allgemeine zurückstehen muß, und bin zufrieden, wenn ich nur auf andern Wegen die Gewißheit von Ihrer ununterbrochenen Heiterkeit und Gesundheit erhalte; und dieß war in jenem Zeitraume der Fall. Daß ich hingegen eine solche Sendung, wie Ihre letzte ist, so lange unbeantwortet lassen konnte, ist unerhört und unverantwortlich. Ich will nicht versuchen, es zu entschuldigen; erklären könnte ich es wohl aus der Beschaffenheit der Störungen, die ununterbrochen auf einander folgten, und mit solchen Studien ganz unverträglich sind. Unter andern mußte ich, gleich nach Empfang <ref target="fud://3144">Ihres Schreibens</ref>, außer dem Rectorat über zwei Monate die Stelle des Regierungs-Bevollmächtigten vertreten. Doch ich müßte meinen ganzen zeitherigen Lebenslauf erzählen, und dieß wäre ein unnützer Zeitverlust. Ich komme lieber gleich zur Hauptsache.<lb/>Ew. Excellenz können nicht bezweifeln, daß ich mich sehr glücklich schätze, mit <name key="9946" type="work">Ihren Bemerkungen über die Bhagavad Gita</name> <name key="2322" type="periodical">meine Indische Bibliothek</name> auszuzieren. Das <name key="2543" type="work">meiner Übersetzung</name> ertheilte Lob ist freilich wohl etwas zu stark, um es selbst abdrucken zu lassen: aber wer mag sich entschließen, so etwas auszuschlagen? Nur des Sanskrit kundige Leser können das einzelne verstehen; aber alle denkenden Leser werden bei den vortrefflichen allgemeinen Bemerkungen ihre Rechnung finden. Leider kann ich noch nicht melden, daß an der Indischen Bibliothek wirklich gedruckt wird. Im Kopfe habe ich den Stoff zu mehreren Heften fertig, aber auf dem Papiere sehr weniges. Wie sehr ich gestört gewesen, können Ew. Excellenz eben daraus ermessen, daß ich, ungeachtet des neuen Antriebes, den Ihr Aufsatz mir gab, dennoch kein Heft zu Stande gebracht.<lb/>Ich war schon lange gesonnen, <hi rend="weight:bold">Nachträge zur Kritik und Auslegung der Bhagavad Gita </hi>zu geben: da werden sich nun die Ihrigen vortrefflich anschließen. Wäre es aber nicht gut, <name key="14597" type="work">die betreffenden Stellen von <persName key="3590">Langlois</persName></name> französisch mit abzudrucken? Meine etwanigen Nebenbemerkungen, beistimmend, bestätigend oder bezweifelnd, möchten, wenn Ew. Excellenz es genehmigen, in kleinerer Schrift unter die einzelnen Abschnitte, oder als Noten unter den Text gesetzt werden.<lb/>Die Erlaubniß, etwas als unrichtig wegzustreichen, ist mir zu bedenklich, um Gebrauch davon zu machen. Wo ich für jetzt nicht beistimmen kann, wird es meistens disputable Punkte betreffen. Indessen lege ich auf einem besondern Blatte einiges vor, was vielleicht Ew. Excellenz zur Zurücknahme oder Modification weniger Zeilen veranlassen könnte, und erwarte darüber Ihre Entscheidung.<lb/>Kaum wage ich eine schüchterne Bitte um die Auslassung eines einzigen Wortes, welches nur zweimal vorkommt. Es ist das Wort <hi rend="weight:bold">pantheistisch</hi>. Da hier die Lehre der Bhagavad Gita nicht im Ganzen erörtert wird, so kann es ja entbehrt werden, es dürfte bloß heißen: „in diesem System“. Überdieß steht es bei einem Satze, worin die christlichen Mystiker wohl so ziemlich mit dem Verfasser der Bhagavad Gita übereinstimmen. Hier bildet es ein Präjudiz als ob die Sache schon ausgemacht wäre. Wenn die Behauptung im allgemeinen ausgeführt wird, dann ist es etwas andres. <persName key="8">Mein Bruder</persName> hat schon früher die Lehre der Bhagavad Gita für Pantheismus erklärt. Ich habe ihm widersprochen, und behauptet, was ihn hiezu vermocht, seyen starke Ausdrücke von der dynamischen Allgegenwart. Ist zum reinen Theismus durchaus die Lehre von der Extramundanität der Gottheit erfoderlich? Die Immanenz des Weltalls lehrt <name key="3764" type="work">die Bhagavad Gita</name> freilich, unbeschadet der Emanation. Ist es im strengen Pantheismus möglich, die Gottheit von der Natur zu unterscheiden? Hört nicht alle Religion, alles ich und du, zwischen dem Gemüthe und der Gottheit auf? Ist damit die Lehre von der Vermittlung, von einer Herablassung der Gottheit um die Creatur zu sich heraufzuziehen, verträglich, welche doch so klar in der Bhagavad Gita vorgetragen wird? Ich habe ehemals die Schriften der Mystiker viel gelesen: mich dünkt, sie theilen sich in zwei Hauptclassen, die Theosophen und die Mystiker des Gefühls. Meines Erachtens stimmt mein Indischer Weiser so ziemlich mit den theosophischen Mystikern überein; weniger mit den letzteren, weil bei diesen der Sinn für die Natur ganz erloschen ist, welcher bei ihm in ursprünglicher mythologischer Fülle lebt.<lb/>Bei den scharfsinnigen Bemerkungen über die Bildung des philosophischen Sprachgebrauchs wage ich es, folgendes Ihrer Beurtheilung vorzulegen. In der Regel sind freilich die metaphysischen Ausdrücke von sinnlichen Vorstellungen übertragen; sollte es nicht aber auch in einigen Sprachen, und namentlich im Sanskrit, ursprünglich metaphysische Wörter geben? Z. B. <hi rend="slant:italic">dēha</hi> von <hi rend="slant:italic">dih</hi>, wie <hi rend="slant:italic">dēs͗a</hi> von <hi rend="slant:italic">dis͗</hi>, ganz etymologisch richtig. Nun heißt aber <hi rend="slant:italic">dih</hi> beschmieren, beflecken, besudeln. <persName key="2553">Wilson</persName> giebt zwar eine zweite Bedeutung, von der er es ableiten will. Aber ich kann mich nicht erinnern, das Verbum und insbesondre das häufige Participium <hi rend="slant:italic">digdha</hi> jemals anders als in der obigen Bedeutung gefunden zu haben. Auch steht in <name key="7022" type="work">dem Wurzel-Wörterbuch</name> bei <persName key="3715">Carey</persName> bloß <hi rend="slant:italic">lipi</hi>, in <name key="5662" type="work">der Englischen Übersetzung</name> bei <persName key="3481">Wilkins</persName> ebenfalls. Wunderlich genug steht aber dabei bloß Eine mit seiner Auslegung gar nicht übereinstimmende Definition <hi rend="slant:italic">upachayē</hi>, welches die zweite Bedeutung von Wilson ist. Wieder einmal ein Beispiel, wie unsere Elementar-Bücher noch beschaffen sind, und wie man sich überall selbst helfen, und die Augen offen haben muß! Wenn die zweite Bedeutung sich nicht praktisch bewährt, so bin ich sehr geneigt zu glauben, sie sei bloß von Indischen Grammatikern zum Behuf der Ableitung von <hi rend="slant:italic">dēha</hi> ersonnen. Ist es aber von <hi rend="slant:italic">dih</hi> in der Bedeutung von <hi rend="slant:italic">lipi</hi>, so liegt ja in dem einfachen Worte, wie im Keim, die ganze <persName key="146">Platonische</persName> Lehre. Auch die andre Ableitung hat schon etwas wissenschaftliches. – Wie dem aber auch sei, das ist gewiß, daß bei den Indiern die Speculation so uralt und ihr Einfluß so überwiegend war, daß der metaphysische Sprachgebrauch in das Leben, wenigstens in die epische Poesie zurückgekehrt ist, und diese Erscheinung ist einzig in ihrer Art.<lb/>Meine Ansicht hängt freilich mit andern vielleicht paradoxen und deswegen besser esoterisch bleibenden Meynungen zusammen. Ich glaube nämlich, daß es ursprünglich tellurische, siderische und spirituale Sprachen giebt. Dieß würde auf die Eintheilung nach den drei <hi rend="slant:italic">gûńa</hi>’s hinauslaufen. Reine Exemplare von den drei Gattungen lassen sich freilich nicht nachweisen, man dürfte aber wohl versuchen, die Sprachen nach dem vorwaltenden Prinzip zu classifiziren.<lb/>Während ich dieses schrieb, empfing ich <name key="20049" type="work">Ihre Abhandlung über die Buchstabenschrift</name>, die ich sogleich verschlungen habe. In der Hauptsache bin ich ganz einverstanden. Mein einziger Zweifel ist nur der, ob nicht jene urweltliche Genialität, die bei der Erfindung der Buchstabenschrift gewaltet, jenes klare Bewußtseyn von den mit den Sprachorganen vorgenommenen und möglicher Weise vorzunehmenden Handlungen, von der symbolischen Bedeutung der Laute, ihrer Beziehung zu einander u. s. w.; ob, sage ich, jenes der Sprache bei ihrer Ausbildung nicht dieselben Dienste habe leisten können, als das materielle Vorhandenseyn der Buchstabenschrift?<lb/>Die Abweichung unsrer Ansichten – ich sage es mit Mistrauen gegen meine eigne Meynung – bezieht sich auf den Ursprung, und den frühesten Gang der menschlichen Cultur. Ich kann unmöglich die ersten großen Grundlagen als den späten und allmähligen Erfolg eines experimentirenden Herumtappens betrachten; sie scheinen mir ein genialischer Wurf zu seyn, wo alles mit Einemmale da ist, wie beim Anfange des organischen Lebens. Die Urväter des Menschengeschlechtes – einige, nicht alle; denn ich fürchte, ich bin in der dreifachen Ketzerei begriffen, ein Präadamit, ein Coadamit und ein Postadamit zu seyn – vergleiche ich mit Menschen, welche die Fähigkeit besessen hätten, in einem dunkeln Schacht durch die Kraft ihrer eignen Augen zu sehen, während unsre Bergleute sich der Lampen und Laternen bedienen müssen. <persName key="942">Julius Caesar</persName> sagte, die Schrift habe das Gedächtniß zu Grunde gerichtet. Ist es nicht mit allen Dingen so? Je vollkommner die Hülfsmittel, desto mehr erlischt der inwohnende Sinn, das angebohrne Talent. Divinatorische Durchschauung der Natur, und von außen her erworbene Erfahrung scheinen mir die beiden Pole der menschlichen Cultur zu seyn; jenes der positive, dieses der negative. Wenn einmal in einem Zeitalter, wo das letzte Princip herrschend ist, jenes durchblitzt, so nimmt selbst das Experiment einen neuen Schwung, und die mechanischen Physiker, welche die Ideen läugnen, werden mehr von ihnen geleitet, als sie selbst wissen.<lb/>Um auf die Buchstabenschrift zurückzukommen, sie wäre also – da ihr Wesen in der Analyse der articulirten Laute besteht – <hi rend="slant:italic">virtualiter</hi> schon in der ältesten Zeit vorhanden gewesen, wenn es auch an zubereiteten Stoffen fehlte, um sie in Ausübung zu bringen.<lb/>Auch darin bin ich ganz einverstanden, daß eine gewisse todte und einförmige Regelmäßigkeit gar keine Vollkommenheit der Sprachen ist. <persName key="113">Adelung</persName> hatte ganz richtig bemerkt, daß in der Deutschen Sprache die starke Conjugation (nach ihm die anomale) der schwachen mehr und mehr Platz einräume. Aber der geistlose Grammatiker hielt dieß für eine Vervollkommung, während es doch nur eine Abstumpfung ist. Die Mannigfaltigkeit der Formen, zB. der Declinationen und Conjugationen scheint mir, wenigstens imaginativ, bedeutsam gewesen zu seyn, was nachher verloren ging. <persName key="1899">Grimm</persName> betrachtet alle Anomalien als später und zufällig entstanden. Dieses gilt von den meisten, aber ich muß auch ursprüngliche, symbolische Anomalien annehmen, z. B. die der Personal-Pronomina in unsrer Sprachfamilie, und diesen Gesichtspunkt vermißte ich in <persName key="2426">Bopps</persName> <name key="9960" type="work">sonst vortrefflicher Abhandlung</name>. Eben so ist es mit der <hi rend="weight:bold">grammatischen Homonymie</hi>, wenn nämlich ganz verschiedene Biegungen gleich lauten. Dieses Gebrechen entsteht meistens aus der Abstumpfung, und nimmt daher bei nicht fixirten Sprachen, wie bisher bei der unsrigen, immer zu. Sollte es nicht aber auch ursprüngliche grammatische Homonymien geben, die symbolisch sind? ZB. logisch betrachtet ist es gleichgültig ob Subject und Object belebte Wesen oder unbelebte Dinge sind; imaginativ aber keinesweges, denn das Unbelebte handelt und leidet nicht eigentlich: es wirkt und erfährt Wirkungen. Diese neutrale Stellung wird nun durch die Gleichheit des Accusativus und Nominativus der Neutra [angedeutet], welche deswegen im Sanskrit, im Griechischen und Lateinischen eine wahre Schönheit ist. Im Deutschen ist es keine Schönheit mehr, weil so viele masculina und sämtliche feminina diese Eigenschaft mit den neutris gemein haben.<lb/>Ich kehre von meinen endlosen Abschweifungen zurück, um zu <name key="20049" type="work">Ihrer Abhandlung</name> eine kleine historische Bemerkung nachzutragen. Sie bemerken <hi rend="slant:italic">p</hi>. 1, daß die Chinesen die Europäische Buchstabenschrift verschmäht haben. Aber die Unmöglichkeit, sie ihrer Sprache anzueignen, erhellet doch noch weit stärker aus der unläugbaren Thatsache, daß die Indische Buchstabenschrift von den ersten Buddhistischen Missionaren überbracht worden war. <persName key="3543">Rémusat</persName> hat in <name key="20067" type="work">einem eignen Aufsatze</name>, ich weiß nicht mehr in <name key="5233" type="work">welcher Zeitschrift</name>, die Weise geschildert, wie ein chinesischer Autor von dieser fremden Theorie der Laute Rechenschaft giebt. <persName key="19507">Der Baron Schilling von Canstadt</persName> hat mir ein chinesisches Buch gezeigt, wo in einer Columne indische Sylben standen, in der nächsten die Lautbezeichnung, in chinesischer Schrift, in einer dritten die Bedeutung. Ohne Zweifel waren es <hi rend="slant:italic">mantra</hi>’s, ich hatte nicht Muße es näher zu untersuchen.<lb/>Nun noch einiges über meine französischen Kritiker und meine zu machenden Antikritiken. Wird es Ew. Excellenz unangenehm seyn, wenn ich in der Nachbarschaft Ihres so milden und ruhigen Aufsatzes mir einigen Spott über <persName key="900">Chézy</persName> und <persName key="3590">Langlois</persName> erlaube? Nach Ihrer gütigen Gesinnung für mich hatten die Artikel des letzteren Sie indignirt, und Sie hatten die magistrale Recension noch nicht gelesen. Auf <persName key="2385">Colebrooke</persName> haben sie denselben Eindruck gemacht. Er <ref target="fud://4128">schrieb mir</ref>: <hi rend="slant:italic">The articles, to which you allude in <name key="3520" type="periodical">the Journal Asiatique</name>, had not escaped me. I regretted to observe the tone of them. Such is not the spirit, which fellow-labourers in the great cause of Oriental litterature should evince towards each other</hi>. Nun stellen Sie sich meine Ataraxie vor: bis jetzt eben, wo ich Ihre Bemerkungen genau von neuem durchging, hatte ich jene kaum flüchtig gelesen. Freilich wußte ich im voraus, daß Chézys Eifersucht zu einer wahren Wuth gesteigert war. Dieses dauert noch immer fort, und ist eine wahre Tragi-Komödie. Seine Absicht war im <hi rend="slant:italic">Journal Asiatique</hi> mich noch weit gröber anzugreifen, aber Rémusat protestirte nachdrücklich dagegen, und so wurden dem Langlois die Höflichkeiten in seinem ersten Artikel abgedrungen.<lb/>In <placeName key="292">London</placeName> bat ich Colebrooke, für meine Rechnung Commentare des Bhagavad Gita aus <placeName key="2552">Calcutta</placeName> zu verschreiben. Ich gedachte erst jede Beantwortung der Kritiken bis auf deren Ankunft zu verschieben, weil es sonst gewissermaßen ein Kampf mit ungleichen Waffen ist, da meine Gegner sich immer auf die Autorität des Scholiasten berufen. Indessen, da die Commentare leider nicht ankommen, so werden die Delinquenten doch nun wohl bei den nächsten Assisen vorgenommen werden müssen. Ich besitze nur das 2<hi rend="offset:4;underline:1">te</hi> Capitel der Subôdhinê, in meiner eignen Abschrift; und dieses leistet mir schon gute Dienste. Zuverläßig hat Langlois – folglich auch Chézy – den Commentator häufig misverstanden. Er hat <hi rend="slant:italic">Cahier</hi> 34, <hi rend="slant:italic">p</hi>. 248 <hi rend="slant:italic">ad</hi> Bh.G. XI, 22, nicht gemerkt, daß das von ihm abgeschriebene Scholion eine Citation aus <name key="3870" type="work">den Véda’s</name> enthält.<lb/>Folgendes hätte mir gleich beim Empfange Ihres Schreibens einfallen sollen, und ich hole es mit Beschämung nach. <persName key="2566">Mein Schüler</persName> hat einen vollständigen und sauber geschriebenen <hi rend="slant:italic">Index Verborum </hi>zur Bhagavad Gita verfertigt: könnte dieser Ew. Excellenz bei der Beschäftigung mit dem Inhalte bequem seyn, so bin ich bereit ihn auf eine Zeitlang zu übersenden. Freilich müßte ich ihn bei der Antikritik zur Hand haben, aber diese kann ich wohl vorher abthun.<lb/>Ich bin fast entschlossen, sie französisch zu schreiben, damit sie doch an die rechte Adresse gelangt.<lb/>Wenn die Tugend in einer Mitte zwischen zwei Extremen besteht, so übe ich sie beim Briefwechsel gewiß nicht aus, indem ich entweder gar nicht oder endlos lange Briefe schreibe. Ich schließe mit dem Versprechen, mich wo möglich in beiden Punkten zu bessern. Mit unwandelbarer Verehrung und Ergebenheit<lb/>Ew. Excellenz<lb/>gehorsamster <lb/>AWvSchlegel.<lb/>Eine Sendung von einigen gedruckten Sachen, lateinischen und deutschen, wird hoffentlich richtig angekommen seyn.</p>', '36_xml_standoff' => '<anchor type="b" n="887" ana="10" xml:id="NidB101698"/>Bonn<anchor type="e" n="887" ana="10" xml:id="NidE101698"/> den 21sten Februar 1826.<lb/>Ew. Excellenz haben die gerechteste Ursache von der Welt, ungehalten zu seyn. Daß Sie den Briefwechsel eine Zeitlang hatten ruhen lassen, war ganz in der Ordnung, und Ew. Excellenz durften darüber keine Sylbe verlieren. Ich besitze eine reichhaltige Sammlung Ihrer Briefe, woraus ich oft neue Anregung und Belehrung schöpfe. Jede Bereicherung ist unendlich willkommen. Wenn aber Ew. Excellenz unter so tiefen und weitumfassenden Forschungen, die Sie mit unermüdlicher Thätigkeit verfolgen, keine Muße finden, mir zu schreiben, so bescheide ich mich gern, daß mein persönliches Interesse gegen das allgemeine zurückstehen muß, und bin zufrieden, wenn ich nur auf andern Wegen die Gewißheit von Ihrer ununterbrochenen Heiterkeit und Gesundheit erhalte; und dieß war in jenem Zeitraume der Fall. Daß ich hingegen eine solche Sendung, wie Ihre letzte ist, so lange unbeantwortet lassen konnte, ist unerhört und unverantwortlich. Ich will nicht versuchen, es zu entschuldigen; erklären könnte ich es wohl aus der Beschaffenheit der Störungen, die ununterbrochen auf einander folgten, und mit solchen Studien ganz unverträglich sind. Unter andern mußte ich, gleich nach Empfang <ref target="fud://3144">Ihres Schreibens</ref>, außer dem Rectorat über zwei Monate die Stelle des Regierungs-Bevollmächtigten vertreten. Doch ich müßte meinen ganzen zeitherigen Lebenslauf erzählen, und dieß wäre ein unnützer Zeitverlust. Ich komme lieber gleich zur Hauptsache.<lb/>Ew. Excellenz können nicht bezweifeln, daß ich mich sehr glücklich schätze, mit <anchor type="b" n="9946" ana="12" xml:id="NidB101719"/>Ihren Bemerkungen über die Bhagavad Gita<anchor type="e" n="9946" ana="12" xml:id="NidE101719"/> <anchor type="b" n="2322" ana="13" xml:id="NidB101718"/>meine Indische Bibliothek<anchor type="e" n="2322" ana="13" xml:id="NidE101718"/> auszuzieren. Das <anchor type="b" n="2543" ana="12" xml:id="NidB101720"/>meiner Übersetzung<anchor type="e" n="2543" ana="12" xml:id="NidE101720"/> ertheilte Lob ist freilich wohl etwas zu stark, um es selbst abdrucken zu lassen: aber wer mag sich entschließen, so etwas auszuschlagen? Nur des Sanskrit kundige Leser können das einzelne verstehen; aber alle denkenden Leser werden bei den vortrefflichen allgemeinen Bemerkungen ihre Rechnung finden. Leider kann ich noch nicht melden, daß an der Indischen Bibliothek wirklich gedruckt wird. Im Kopfe habe ich den Stoff zu mehreren Heften fertig, aber auf dem Papiere sehr weniges. Wie sehr ich gestört gewesen, können Ew. Excellenz eben daraus ermessen, daß ich, ungeachtet des neuen Antriebes, den Ihr Aufsatz mir gab, dennoch kein Heft zu Stande gebracht.<lb/>Ich war schon lange gesonnen, <hi rend="weight:bold">Nachträge zur Kritik und Auslegung der Bhagavad Gita </hi>zu geben: da werden sich nun die Ihrigen vortrefflich anschließen. Wäre es aber nicht gut, <anchor type="b" n="14597" ana="12" xml:id="NidB101722"/>die betreffenden Stellen von <anchor type="b" n="3590" ana="11" xml:id="NidB101721"/>Langlois<anchor type="e" n="3590" ana="11" xml:id="NidE101721"/><anchor type="e" n="14597" ana="12" xml:id="NidE101722"/> französisch mit abzudrucken? Meine etwanigen Nebenbemerkungen, beistimmend, bestätigend oder bezweifelnd, möchten, wenn Ew. Excellenz es genehmigen, in kleinerer Schrift unter die einzelnen Abschnitte, oder als Noten unter den Text gesetzt werden.<lb/>Die Erlaubniß, etwas als unrichtig wegzustreichen, ist mir zu bedenklich, um Gebrauch davon zu machen. Wo ich für jetzt nicht beistimmen kann, wird es meistens disputable Punkte betreffen. Indessen lege ich auf einem besondern Blatte einiges vor, was vielleicht Ew. Excellenz zur Zurücknahme oder Modification weniger Zeilen veranlassen könnte, und erwarte darüber Ihre Entscheidung.<lb/>Kaum wage ich eine schüchterne Bitte um die Auslassung eines einzigen Wortes, welches nur zweimal vorkommt. Es ist das Wort <hi rend="weight:bold">pantheistisch</hi>. Da hier die Lehre der Bhagavad Gita nicht im Ganzen erörtert wird, so kann es ja entbehrt werden, es dürfte bloß heißen: „in diesem System“. Überdieß steht es bei einem Satze, worin die christlichen Mystiker wohl so ziemlich mit dem Verfasser der Bhagavad Gita übereinstimmen. Hier bildet es ein Präjudiz als ob die Sache schon ausgemacht wäre. Wenn die Behauptung im allgemeinen ausgeführt wird, dann ist es etwas andres. <anchor type="b" n="8" ana="11" xml:id="NidB101723"/>Mein Bruder<anchor type="e" n="8" ana="11" xml:id="NidE101723"/> hat schon früher die Lehre der Bhagavad Gita für Pantheismus erklärt. Ich habe ihm widersprochen, und behauptet, was ihn hiezu vermocht, seyen starke Ausdrücke von der dynamischen Allgegenwart. Ist zum reinen Theismus durchaus die Lehre von der Extramundanität der Gottheit erfoderlich? Die Immanenz des Weltalls lehrt <anchor type="b" n="3764" ana="12" xml:id="NidB101724"/>die Bhagavad Gita<anchor type="e" n="3764" ana="12" xml:id="NidE101724"/> freilich, unbeschadet der Emanation. Ist es im strengen Pantheismus möglich, die Gottheit von der Natur zu unterscheiden? Hört nicht alle Religion, alles ich und du, zwischen dem Gemüthe und der Gottheit auf? Ist damit die Lehre von der Vermittlung, von einer Herablassung der Gottheit um die Creatur zu sich heraufzuziehen, verträglich, welche doch so klar in der Bhagavad Gita vorgetragen wird? Ich habe ehemals die Schriften der Mystiker viel gelesen: mich dünkt, sie theilen sich in zwei Hauptclassen, die Theosophen und die Mystiker des Gefühls. Meines Erachtens stimmt mein Indischer Weiser so ziemlich mit den theosophischen Mystikern überein; weniger mit den letzteren, weil bei diesen der Sinn für die Natur ganz erloschen ist, welcher bei ihm in ursprünglicher mythologischer Fülle lebt.<lb/>Bei den scharfsinnigen Bemerkungen über die Bildung des philosophischen Sprachgebrauchs wage ich es, folgendes Ihrer Beurtheilung vorzulegen. In der Regel sind freilich die metaphysischen Ausdrücke von sinnlichen Vorstellungen übertragen; sollte es nicht aber auch in einigen Sprachen, und namentlich im Sanskrit, ursprünglich metaphysische Wörter geben? Z. B. <hi rend="slant:italic">dēha</hi> von <hi rend="slant:italic">dih</hi>, wie <hi rend="slant:italic">dēs͗a</hi> von <hi rend="slant:italic">dis͗</hi>, ganz etymologisch richtig. Nun heißt aber <hi rend="slant:italic">dih</hi> beschmieren, beflecken, besudeln. <anchor type="b" n="2553" ana="11" xml:id="NidB101747"/>Wilson<anchor type="e" n="2553" ana="11" xml:id="NidE101747"/> giebt zwar eine zweite Bedeutung, von der er es ableiten will. Aber ich kann mich nicht erinnern, das Verbum und insbesondre das häufige Participium <hi rend="slant:italic">digdha</hi> jemals anders als in der obigen Bedeutung gefunden zu haben. Auch steht in <anchor type="b" n="7022" ana="12" xml:id="NidB101726"/>dem Wurzel-Wörterbuch<anchor type="e" n="7022" ana="12" xml:id="NidE101726"/> bei <anchor type="b" n="3715" ana="11" xml:id="NidB101725"/>Carey<anchor type="e" n="3715" ana="11" xml:id="NidE101725"/> bloß <hi rend="slant:italic">lipi</hi>, in <anchor type="b" n="5662" ana="12" xml:id="NidB101728"/>der Englischen Übersetzung<anchor type="e" n="5662" ana="12" xml:id="NidE101728"/> bei <anchor type="b" n="3481" ana="11" xml:id="NidB101727"/>Wilkins<anchor type="e" n="3481" ana="11" xml:id="NidE101727"/> ebenfalls. Wunderlich genug steht aber dabei bloß Eine mit seiner Auslegung gar nicht übereinstimmende Definition <hi rend="slant:italic">upachayē</hi>, welches die zweite Bedeutung von Wilson ist. Wieder einmal ein Beispiel, wie unsere Elementar-Bücher noch beschaffen sind, und wie man sich überall selbst helfen, und die Augen offen haben muß! Wenn die zweite Bedeutung sich nicht praktisch bewährt, so bin ich sehr geneigt zu glauben, sie sei bloß von Indischen Grammatikern zum Behuf der Ableitung von <hi rend="slant:italic">dēha</hi> ersonnen. Ist es aber von <hi rend="slant:italic">dih</hi> in der Bedeutung von <hi rend="slant:italic">lipi</hi>, so liegt ja in dem einfachen Worte, wie im Keim, die ganze <anchor type="b" n="146" ana="11" xml:id="NidB101729"/>Platonische<anchor type="e" n="146" ana="11" xml:id="NidE101729"/> Lehre. Auch die andre Ableitung hat schon etwas wissenschaftliches. – Wie dem aber auch sei, das ist gewiß, daß bei den Indiern die Speculation so uralt und ihr Einfluß so überwiegend war, daß der metaphysische Sprachgebrauch in das Leben, wenigstens in die epische Poesie zurückgekehrt ist, und diese Erscheinung ist einzig in ihrer Art.<lb/>Meine Ansicht hängt freilich mit andern vielleicht paradoxen und deswegen besser esoterisch bleibenden Meynungen zusammen. Ich glaube nämlich, daß es ursprünglich tellurische, siderische und spirituale Sprachen giebt. Dieß würde auf die Eintheilung nach den drei <hi rend="slant:italic">gûńa</hi>’s hinauslaufen. Reine Exemplare von den drei Gattungen lassen sich freilich nicht nachweisen, man dürfte aber wohl versuchen, die Sprachen nach dem vorwaltenden Prinzip zu classifiziren.<lb/>Während ich dieses schrieb, empfing ich <anchor type="b" n="20049" ana="12" xml:id="NidB101730"/>Ihre Abhandlung über die Buchstabenschrift<anchor type="e" n="20049" ana="12" xml:id="NidE101730"/>, die ich sogleich verschlungen habe. In der Hauptsache bin ich ganz einverstanden. Mein einziger Zweifel ist nur der, ob nicht jene urweltliche Genialität, die bei der Erfindung der Buchstabenschrift gewaltet, jenes klare Bewußtseyn von den mit den Sprachorganen vorgenommenen und möglicher Weise vorzunehmenden Handlungen, von der symbolischen Bedeutung der Laute, ihrer Beziehung zu einander u. s. w.; ob, sage ich, jenes der Sprache bei ihrer Ausbildung nicht dieselben Dienste habe leisten können, als das materielle Vorhandenseyn der Buchstabenschrift?<lb/>Die Abweichung unsrer Ansichten – ich sage es mit Mistrauen gegen meine eigne Meynung – bezieht sich auf den Ursprung, und den frühesten Gang der menschlichen Cultur. Ich kann unmöglich die ersten großen Grundlagen als den späten und allmähligen Erfolg eines experimentirenden Herumtappens betrachten; sie scheinen mir ein genialischer Wurf zu seyn, wo alles mit Einemmale da ist, wie beim Anfange des organischen Lebens. Die Urväter des Menschengeschlechtes – einige, nicht alle; denn ich fürchte, ich bin in der dreifachen Ketzerei begriffen, ein Präadamit, ein Coadamit und ein Postadamit zu seyn – vergleiche ich mit Menschen, welche die Fähigkeit besessen hätten, in einem dunkeln Schacht durch die Kraft ihrer eignen Augen zu sehen, während unsre Bergleute sich der Lampen und Laternen bedienen müssen. <anchor type="b" n="942" ana="11" xml:id="NidB101731"/>Julius Caesar<anchor type="e" n="942" ana="11" xml:id="NidE101731"/> sagte, die Schrift habe das Gedächtniß zu Grunde gerichtet. Ist es nicht mit allen Dingen so? Je vollkommner die Hülfsmittel, desto mehr erlischt der inwohnende Sinn, das angebohrne Talent. Divinatorische Durchschauung der Natur, und von außen her erworbene Erfahrung scheinen mir die beiden Pole der menschlichen Cultur zu seyn; jenes der positive, dieses der negative. Wenn einmal in einem Zeitalter, wo das letzte Princip herrschend ist, jenes durchblitzt, so nimmt selbst das Experiment einen neuen Schwung, und die mechanischen Physiker, welche die Ideen läugnen, werden mehr von ihnen geleitet, als sie selbst wissen.<lb/>Um auf die Buchstabenschrift zurückzukommen, sie wäre also – da ihr Wesen in der Analyse der articulirten Laute besteht – <hi rend="slant:italic">virtualiter</hi> schon in der ältesten Zeit vorhanden gewesen, wenn es auch an zubereiteten Stoffen fehlte, um sie in Ausübung zu bringen.<lb/>Auch darin bin ich ganz einverstanden, daß eine gewisse todte und einförmige Regelmäßigkeit gar keine Vollkommenheit der Sprachen ist. <anchor type="b" n="113" ana="11" xml:id="NidB101732"/>Adelung<anchor type="e" n="113" ana="11" xml:id="NidE101732"/> hatte ganz richtig bemerkt, daß in der Deutschen Sprache die starke Conjugation (nach ihm die anomale) der schwachen mehr und mehr Platz einräume. Aber der geistlose Grammatiker hielt dieß für eine Vervollkommung, während es doch nur eine Abstumpfung ist. Die Mannigfaltigkeit der Formen, zB. der Declinationen und Conjugationen scheint mir, wenigstens imaginativ, bedeutsam gewesen zu seyn, was nachher verloren ging. <anchor type="b" n="1899" ana="11" xml:id="NidB101733"/>Grimm<anchor type="e" n="1899" ana="11" xml:id="NidE101733"/> betrachtet alle Anomalien als später und zufällig entstanden. Dieses gilt von den meisten, aber ich muß auch ursprüngliche, symbolische Anomalien annehmen, z. B. die der Personal-Pronomina in unsrer Sprachfamilie, und diesen Gesichtspunkt vermißte ich in <anchor type="b" n="2426" ana="11" xml:id="NidB101734"/>Bopps<anchor type="e" n="2426" ana="11" xml:id="NidE101734"/> <anchor type="b" n="9960" ana="12" xml:id="NidB101735"/>sonst vortrefflicher Abhandlung<anchor type="e" n="9960" ana="12" xml:id="NidE101735"/>. Eben so ist es mit der <hi rend="weight:bold">grammatischen Homonymie</hi>, wenn nämlich ganz verschiedene Biegungen gleich lauten. Dieses Gebrechen entsteht meistens aus der Abstumpfung, und nimmt daher bei nicht fixirten Sprachen, wie bisher bei der unsrigen, immer zu. Sollte es nicht aber auch ursprüngliche grammatische Homonymien geben, die symbolisch sind? ZB. logisch betrachtet ist es gleichgültig ob Subject und Object belebte Wesen oder unbelebte Dinge sind; imaginativ aber keinesweges, denn das Unbelebte handelt und leidet nicht eigentlich: es wirkt und erfährt Wirkungen. Diese neutrale Stellung wird nun durch die Gleichheit des Accusativus und Nominativus der Neutra [angedeutet], welche deswegen im Sanskrit, im Griechischen und Lateinischen eine wahre Schönheit ist. Im Deutschen ist es keine Schönheit mehr, weil so viele masculina und sämtliche feminina diese Eigenschaft mit den neutris gemein haben.<lb/>Ich kehre von meinen endlosen Abschweifungen zurück, um zu <anchor type="b" n="20049" ana="12" xml:id="NidB101736"/>Ihrer Abhandlung<anchor type="e" n="20049" ana="12" xml:id="NidE101736"/> eine kleine historische Bemerkung nachzutragen. Sie bemerken <hi rend="slant:italic">p</hi>. 1, daß die Chinesen die Europäische Buchstabenschrift verschmäht haben. Aber die Unmöglichkeit, sie ihrer Sprache anzueignen, erhellet doch noch weit stärker aus der unläugbaren Thatsache, daß die Indische Buchstabenschrift von den ersten Buddhistischen Missionaren überbracht worden war. <anchor type="b" n="3543" ana="11" xml:id="NidB101737"/>Rémusat<anchor type="e" n="3543" ana="11" xml:id="NidE101737"/> hat in <anchor type="b" n="20067" ana="12" xml:id="NidB101773"/>einem eignen Aufsatze<anchor type="e" n="20067" ana="12" xml:id="NidE101773"/>, ich weiß nicht mehr in <anchor type="b" n="5233" ana="12" xml:id="NidB101774"/>welcher Zeitschrift<anchor type="e" n="5233" ana="12" xml:id="NidE101774"/>, die Weise geschildert, wie ein chinesischer Autor von dieser fremden Theorie der Laute Rechenschaft giebt. <anchor type="b" n="19507" ana="11" xml:id="NidB101738"/>Der Baron Schilling von Canstadt<anchor type="e" n="19507" ana="11" xml:id="NidE101738"/> hat mir ein chinesisches Buch gezeigt, wo in einer Columne indische Sylben standen, in der nächsten die Lautbezeichnung, in chinesischer Schrift, in einer dritten die Bedeutung. Ohne Zweifel waren es <hi rend="slant:italic">mantra</hi>’s, ich hatte nicht Muße es näher zu untersuchen.<lb/>Nun noch einiges über meine französischen Kritiker und meine zu machenden Antikritiken. Wird es Ew. Excellenz unangenehm seyn, wenn ich in der Nachbarschaft Ihres so milden und ruhigen Aufsatzes mir einigen Spott über <anchor type="b" n="900" ana="11" xml:id="NidB101739"/>Chézy<anchor type="e" n="900" ana="11" xml:id="NidE101739"/> und <anchor type="b" n="3590" ana="11" xml:id="NidB101740"/>Langlois<anchor type="e" n="3590" ana="11" xml:id="NidE101740"/> erlaube? Nach Ihrer gütigen Gesinnung für mich hatten die Artikel des letzteren Sie indignirt, und Sie hatten die magistrale Recension noch nicht gelesen. Auf <anchor type="b" n="2385" ana="11" xml:id="NidB101741"/>Colebrooke<anchor type="e" n="2385" ana="11" xml:id="NidE101741"/> haben sie denselben Eindruck gemacht. Er <ref target="fud://4128">schrieb mir</ref>: <hi rend="slant:italic">The articles, to which you allude in <anchor type="b" n="3520" ana="13" xml:id="NidB101742"/>the Journal Asiatique<anchor type="e" n="3520" ana="13" xml:id="NidE101742"/>, had not escaped me. I regretted to observe the tone of them. Such is not the spirit, which fellow-labourers in the great cause of Oriental litterature should evince towards each other</hi>. Nun stellen Sie sich meine Ataraxie vor: bis jetzt eben, wo ich Ihre Bemerkungen genau von neuem durchging, hatte ich jene kaum flüchtig gelesen. Freilich wußte ich im voraus, daß Chézys Eifersucht zu einer wahren Wuth gesteigert war. Dieses dauert noch immer fort, und ist eine wahre Tragi-Komödie. Seine Absicht war im <hi rend="slant:italic">Journal Asiatique</hi> mich noch weit gröber anzugreifen, aber Rémusat protestirte nachdrücklich dagegen, und so wurden dem Langlois die Höflichkeiten in seinem ersten Artikel abgedrungen.<lb/>In <anchor type="b" n="292" ana="10" xml:id="NidB101743"/>London<anchor type="e" n="292" ana="10" xml:id="NidE101743"/> bat ich Colebrooke, für meine Rechnung Commentare des Bhagavad Gita aus <anchor type="b" n="2552" ana="10" xml:id="NidB101744"/>Calcutta<anchor type="e" n="2552" ana="10" xml:id="NidE101744"/> zu verschreiben. Ich gedachte erst jede Beantwortung der Kritiken bis auf deren Ankunft zu verschieben, weil es sonst gewissermaßen ein Kampf mit ungleichen Waffen ist, da meine Gegner sich immer auf die Autorität des Scholiasten berufen. Indessen, da die Commentare leider nicht ankommen, so werden die Delinquenten doch nun wohl bei den nächsten Assisen vorgenommen werden müssen. Ich besitze nur das 2<hi rend="offset:4;underline:1">te</hi> Capitel der Subôdhinê, in meiner eignen Abschrift; und dieses leistet mir schon gute Dienste. Zuverläßig hat Langlois – folglich auch Chézy – den Commentator häufig misverstanden. Er hat <hi rend="slant:italic">Cahier</hi> 34, <hi rend="slant:italic">p</hi>. 248 <hi rend="slant:italic">ad</hi> Bh.G. XI, 22, nicht gemerkt, daß das von ihm abgeschriebene Scholion eine Citation aus <anchor type="b" n="3870" ana="12" xml:id="NidB101745"/>den Véda’s<anchor type="e" n="3870" ana="12" xml:id="NidE101745"/> enthält.<lb/>Folgendes hätte mir gleich beim Empfange Ihres Schreibens einfallen sollen, und ich hole es mit Beschämung nach. <anchor type="b" n="2566" ana="11" xml:id="NidB101746"/>Mein Schüler<anchor type="e" n="2566" ana="11" xml:id="NidE101746"/> hat einen vollständigen und sauber geschriebenen <hi rend="slant:italic">Index Verborum </hi>zur Bhagavad Gita verfertigt: könnte dieser Ew. Excellenz bei der Beschäftigung mit dem Inhalte bequem seyn, so bin ich bereit ihn auf eine Zeitlang zu übersenden. Freilich müßte ich ihn bei der Antikritik zur Hand haben, aber diese kann ich wohl vorher abthun.<lb/>Ich bin fast entschlossen, sie französisch zu schreiben, damit sie doch an die rechte Adresse gelangt.<lb/>Wenn die Tugend in einer Mitte zwischen zwei Extremen besteht, so übe ich sie beim Briefwechsel gewiß nicht aus, indem ich entweder gar nicht oder endlos lange Briefe schreibe. Ich schließe mit dem Versprechen, mich wo möglich in beiden Punkten zu bessern. Mit unwandelbarer Verehrung und Ergebenheit<lb/>Ew. Excellenz<lb/>gehorsamster <lb/>AWvSchlegel.<lb/>Eine Sendung von einigen gedruckten Sachen, lateinischen und deutschen, wird hoffentlich richtig angekommen seyn.', '36_briefid' => 'Leitzmann1908_AWSanWvHumboldt_21021826', '36_absender' => array( (int) 0 => array( 'ID' => '7125', 'content' => 'August Wilhelm von Schlegel', 'bemerkung' => '', 'altBegriff' => 'Schlegel, August Wilhelm von', 'LmAdd' => array( [maximum depth reached] ) ) ), '36_adressat' => array( (int) 0 => array( 'ID' => '7317', 'content' => 'Wilhelm von Humboldt', 'bemerkung' => '', 'altBegriff' => 'Humboldt, Wilhelm von', 'LmAdd' => array( [maximum depth reached] ) ) ), '36_datumvon' => '1826-02-21', '36_sprache' => array( (int) 0 => 'Deutsch' ), '36_absenderort' => array( (int) 0 => array( 'ID' => '887', 'content' => 'Bonn', 'bemerkung' => 'GND:1001909-1', 'altBegriff' => '', 'LmAdd' => array([maximum depth reached]) ) ), '36_leitd' => 'Briefwechsel zwischen Wilhelm von Humboldt und August Wilhelm Schlegel. Hg. v. Albert Leitzmann. Halle 1908, S. 183‒192.', '36_status' => 'Einmal kollationierter Druckvolltext mit Registerauszeichnung', '36_Datum' => '1826-02-21', '36_facet_absender' => array( (int) 0 => 'August Wilhelm von Schlegel' ), '36_facet_absender_reverse' => array( (int) 0 => 'Schlegel, August Wilhelm von' ), '36_facet_adressat' => array( (int) 0 => 'Wilhelm von Humboldt' ), '36_facet_adressat_reverse' => array( (int) 0 => 'Humboldt, Wilhelm von' ), '36_facet_absenderort' => array( (int) 0 => 'Bonn' ), '36_facet_adressatort' => '', '36_facet_status' => 'Einmal kollationierter Druckvolltext mit Registerauszeichnung', '36_facet_datengeberhand' => '', '36_facet_sprache' => array( (int) 0 => 'Deutsch' ), '36_facet_korrespondenten' => array( (int) 0 => 'Wilhelm von Humboldt' ), '36_Digitalisat_Druck_Server' => array( (int) 0 => 'AWS-aw-0231-0.jpg', (int) 1 => 'AWS-aw-0231-1.jpg', (int) 2 => 'AWS-aw-0231-2.jpg', (int) 3 => 'AWS-aw-0231-3.jpg', (int) 4 => 'AWS-aw-0231-4.jpg', (int) 5 => 'AWS-aw-0231-5.jpg', (int) 6 => 'AWS-aw-0231-6.jpg', (int) 7 => 'AWS-aw-0231-7.jpg', (int) 8 => 'AWS-aw-0231-8.jpg', (int) 9 => 'AWS-aw-0231-9.jpg' ), '_label' => '', '_descr' => '', '_model' => 'Letter', '_model_title' => 'Letter', '_model_titles' => 'Letters', '_url' => '' ) $doctype_name = 'Letters' $captions = array( '36_dummy' => '', '36_absender' => 'Absender/Verfasser', '36_absverif1' => 'Verfasser Verifikation', '36_absender2' => 'Verfasser 2', '36_absverif2' => 'Verfasser 2 Verifikation', '36_absbrieftyp2' => 'Verfasser 2 Brieftyp', '36_absender3' => 'Verfasser 3', '36_absverif3' => 'Verfasser 3 Verifikation', '36_absbrieftyp3' => 'Verfasser 3 Brieftyp', '36_adressat' => 'Adressat/Empfänger', '36_adrverif1' => 'Empfänger Verifikation', '36_adressat2' => 'Empfänger 2', '36_adrverif2' => 'Empfänger 2 Verifikation', '36_adressat3' => 'Empfänger 3', '36_adrverif3' => 'Empfänger 3 Verifikation', '36_adressatfalsch' => 'Empfänger_falsch', '36_absenderort' => 'Ort Absender/Verfasser', '36_absortverif1' => 'Ort Verfasser Verifikation', '36_absortungenau' => 'Ort Verfasser ungenau', '36_absenderort2' => 'Ort Verfasser 2', '36_absortverif2' => 'Ort Verfasser 2 Verifikation', '36_absenderort3' => 'Ort Verfasser 3', '36_absortverif3' => 'Ort Verfasser 3 Verifikation', '36_adressatort' => 'Ort Adressat/Empfänger', '36_adrortverif' => 'Ort Empfänger Verifikation', '36_datumvon' => 'Datum von', '36_datumbis' => 'Datum bis', '36_altDat' => 'Datum/Datum manuell', '36_datumverif' => 'Datum Verifikation', '36_sortdatum' => 'Datum zum Sortieren', '36_wochentag' => 'Wochentag nicht erzeugen', '36_sortdatum1' => 'Briefsortierung', '36_fremddatierung' => 'Fremddatierung', '36_typ' => 'Brieftyp', '36_briefid' => 'Brief Identifier', '36_purl_web' => 'PURL web', '36_status' => 'Bearbeitungsstatus', '36_anmerkung' => 'Anmerkung (intern)', '36_anmerkungextern' => 'Anmerkung (extern)', '36_datengeber' => 'Datengeber', '36_purl' => 'OAI-Id', '36_leitd' => 'Druck 1:Bibliographische Angabe', '36_druck2' => 'Druck 2:Bibliographische Angabe', '36_druck3' => 'Druck 3:Bibliographische Angabe', '36_internhand' => 'Zugehörige Handschrift', '36_datengeberhand' => 'Datengeber', '36_purlhand' => 'OAI-Id', '36_purlhand_alt' => 'OAI-Id (alternative)', '36_signaturhand' => 'Signatur', '36_signaturhand_alt' => 'Signatur (alternative)', '36_h1prov' => 'Provenienz', '36_h1zahl' => 'Blatt-/Seitenzahl', '36_h1format' => 'Format', '36_h1besonder' => 'Besonderheiten', '36_hueberlieferung' => 'Ãœberlieferung', '36_infoinhalt' => 'Verschollen/erschlossen: Information über den Inhalt', '36_heditor' => 'Editor/in', '36_hredaktion' => 'Redakteur/in', '36_interndruck' => 'Zugehörige Druck', '36_band' => 'KFSA Band', '36_briefnr' => 'KFSA Brief-Nr.', '36_briefseite' => 'KFSA Seite', '36_incipit' => 'Incipit', '36_textgrundlage' => 'Textgrundlage Sigle', '36_uberstatus' => 'Ãœberlieferungsstatus', '36_gattung' => 'Gattung', '36_korrepsondentds' => 'Korrespondent_DS', '36_korrepsondentfs' => 'Korrespondent_FS', '36_ermitteltvon' => 'Ermittelt von', '36_metadatenintern' => 'Metadaten (intern)', '36_beilagen' => 'Beilage(en)', '36_abszusatz' => 'Verfasser Zusatzinfos', '36_adrzusatz' => 'Empfänger Zusatzinfos', '36_absortzusatz' => 'Verfasser Ort Zusatzinfos', '36_adrortzusatz' => 'Empfänger Ort Zusatzinfos', '36_datumzusatz' => 'Datum Zusatzinfos', '36_' => '', '36_KFSA Hand.hueberleiferung' => 'Ãœberlieferungsträger', '36_KFSA Hand.harchiv' => 'Archiv', '36_KFSA Hand.hsignatur' => 'Signatur', '36_KFSA Hand.hprovenienz' => 'Provenienz', '36_KFSA Hand.harchivlalt' => 'Archiv_alt', '36_KFSA Hand.hsignaturalt' => 'Signatur_alt', '36_KFSA Hand.hblattzahl' => 'Blattzahl', '36_KFSA Hand.hseitenzahl' => 'Seitenzahl', '36_KFSA Hand.hformat' => 'Format', '36_KFSA Hand.hadresse' => 'Adresse', '36_KFSA Hand.hvollstaendig' => 'Vollständigkeit', '36_KFSA Hand.hzusatzinfo' => 'H Zusatzinfos', '36_KFSA Druck.drliteratur' => 'Druck in', '36_KFSA Druck.drsigle' => 'Sigle', '36_KFSA Druck.drbandnrseite' => 'Bd./Nr./S.', '36_KFSA Druck.drfaksimile' => 'Faksimile', '36_KFSA Druck.drvollstaendig' => 'Vollständigkeit', '36_KFSA Druck.dzusatzinfo' => 'D Zusatzinfos', '36_KFSA Doku.dokliteratur' => 'Dokumentiert in', '36_KFSA Doku.doksigle' => 'Sigle', '36_KFSA Doku.dokbandnrseite' => 'Bd./Nr./S.', '36_KFSA Doku.dokfaksimile' => 'Faksimile', '36_KFSA Doku.dokvollstaendig' => 'Vollständigkeit', '36_KFSA Doku.dokzusatzinfo' => 'A Zusatzinfos', '36_Link Druck.url_titel_druck' => 'Titel/Bezeichnung', '36_Link Druck.url_image_druck' => 'Link zu Online-Dokument', '36_Link Hand.url_titel_hand' => 'Titel/Bezeichnung', '36_Link Hand.url_image_hand' => 'Link zu Online-Dokument', '36_preasentation' => 'Nicht in die Präsentation', '36_verlag' => 'Verlag', '36_anhang_tite0' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename0' => 'Image', '36_anhang_tite1' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename1' => 'Image', '36_anhang_tite2' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename2' => 'Image', '36_anhang_tite3' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename3' => 'Image', '36_anhang_tite4' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename4' => 'Image', '36_anhang_tite5' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename5' => 'Image', '36_anhang_tite6' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename6' => 'Image', '36_anhang_tite7' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename7' => 'Image', '36_anhang_tite8' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename8' => 'Image', '36_anhang_tite9' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename9' => 'Image', '36_anhang_titea' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcenamea' => 'Image', '36_anhang_titeb' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcenameb' => 'Image', '36_anhang_titec' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcenamec' => 'Image', '36_anhang_tited' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcenamed' => 'Image', '36_anhang_titee' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcenamee' => 'Image', '36_anhang_titeu' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcenameu' => 'Image', '36_anhang_titev' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcenamev' => 'Image', '36_anhang_titew' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcenamew' => 'Image', '36_anhang_titex' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcenamex' => 'Image', '36_anhang_titey' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcenamey' => 'Image', '36_anhang_titez' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcenamez' => 'Image', '36_anhang_tite10' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename10' => 'Image', '36_anhang_tite11' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename11' => 'Image', '36_anhang_tite12' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename12' => 'Image', '36_anhang_tite13' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename13' => 'Image', '36_anhang_tite14' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename14' => 'Image', '36_anhang_tite15' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename15' => 'Image', '36_anhang_tite16' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename16' => 'Image', '36_anhang_tite17' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename17' => 'Image', '36_anhang_tite18' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename18' => 'Image', '36_h_preasentation' => 'Nicht in die Präsentation', '36_anhang_titef' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcenamef' => 'Image', '36_anhang_titeg' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcenameg' => 'Image', '36_anhang_titeh' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcenameh' => 'Image', '36_anhang_titei' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcenamei' => 'Image', '36_anhang_titej' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcenamej' => 'Image', '36_anhang_titek' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcenamek' => 'Image', '36_anhang_titel' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcenamel' => 'Image', '36_anhang_titem' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcenamem' => 'Image', '36_anhang_titen' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcenamen' => 'Image', '36_anhang_titeo' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcenameo' => 'Image', '36_anhang_titep' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcenamep' => 'Image', '36_anhang_titeq' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcenameq' => 'Image', '36_anhang_titer' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcenamer' => 'Image', '36_anhang_tites' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcenames' => 'Image', '36_anhang_titet' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcenamet' => 'Image', '36_anhang_tite19' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename19' => 'Image', '36_anhang_tite20' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename20' => 'Image', '36_anhang_tite21' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename21' => 'Image', '36_anhang_tite22' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename22' => 'Image', '36_anhang_tite23' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename23' => 'Image', '36_anhang_tite24' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename24' => 'Image', '36_anhang_tite25' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename25' => 'Image', '36_anhang_tite26' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename26' => 'Image', '36_anhang_tite27' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename27' => 'Image', '36_anhang_tite28' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename28' => 'Image', '36_anhang_tite29' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename29' => 'Image', '36_anhang_tite30' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename30' => 'Image', '36_anhang_tite31' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename32' => 'Image', '36_anhang_tite33' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename33' => 'Image', '36_anhang_tite34' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename34' => 'Image', '36_Relationen.relation_art' => 'Art', '36_Relationen.relation_link' => 'Interner Link', '36_volltext' => 'Brieftext (Digitalisat Leitdruck oder Transkript Handschrift)', '36_History.hisbearbeiter' => 'Bearbeiter', '36_History.hisschritt' => 'Bearbeitungsschritt', '36_History.hisdatum' => 'Datum', '36_History.hisnotiz' => 'Notiz', '36_personen' => 'Personen', '36_werke' => 'Werke', '36_orte' => 'Orte', '36_themen' => 'Themen', '36_briedfehlt' => 'Fehlt', '36_briefbestellt' => 'Bestellt', '36_intrans' => 'Transkription', '36_intranskorr1' => 'Transkription Korrektur 1', '36_intranskorr2' => 'Transkription Korrektur 2', '36_intranscheck' => 'Transkription Korr. geprüft', '36_intranseintr' => 'Transkription Korr. eingetr', '36_inannotcheck' => 'Auszeichnungen Reg. geprüft', '36_inkollation' => 'Auszeichnungen Kollationierung', '36_inkollcheck' => 'Auszeichnungen Koll. geprüft', '36_himageupload' => 'H/h Digis hochgeladen', '36_dimageupload' => 'D Digis hochgeladen', '36_stand' => 'Bearbeitungsstand (Webseite)', '36_stand_d' => 'Bearbeitungsstand (Druck)', '36_timecreate' => 'Erstellt am', '36_timelastchg' => 'Zuletzt gespeichert am', '36_comment' => 'Kommentar(intern)', '36_accessid' => 'Access ID', '36_accessidalt' => 'Access ID-alt', '36_digifotos' => 'Digitalisat Fotos', '36_imagelink' => 'Imagelink', '36_vermekrbehler' => 'Notizen Behler', '36_vermekrotto' => 'Anmerkungen Otto', '36_vermekraccess' => 'Bearb-Vermerke Access', '36_zeugenbeschreib' => 'Zeugenbeschreibung', '36_sprache' => 'Sprache', '36_accessinfo1' => 'Archiv H (+ Signatur)', '36_korrekturbd36' => 'Korrekturen Bd. 36', '36_druckbd36' => 'Druckrelevant Bd. 36', '36_digitalisath1' => 'Digitalisat_H', '36_digitalisath2' => 'Digitalisat_h', '36_titelhs' => 'Titel_Hs', '36_accessinfo2' => 'Archiv H (+ Signatur)', '36_accessinfo3' => 'Sigle (Dokumentiert in + Bd./Nr./S.)', '36_accessinfo4' => 'Sigle (Druck in + Bd./Nr./S.)', '36_KFSA Hand.hschreibstoff' => 'Schreibstoff', '36_Relationen.relation_anmerkung' => null, '36_anhang_tite35' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename35' => 'Image', '36_anhang_tite36' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename36' => 'Image', '36_anhang_tite37' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename37' => 'Image', '36_anhang_tite38' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename38' => 'Image', '36_anhang_tite39' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename39' => 'Image', '36_anhang_tite40' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename40' => 'Image', '36_anhang_tite41' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename41' => 'Image', '36_anhang_tite42' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename42' => 'Image', '36_anhang_tite43' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename43' => 'Image', '36_anhang_tite44' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename44' => 'Image', '36_anhang_tite45' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename45' => 'Image', '36_anhang_tite46' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename46' => 'Image', '36_anhang_tite47' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename47' => 'Image', '36_anhang_tite48' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename48' => 'Image', '36_anhang_tite49' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename49' => 'Image', '36_anhang_tite50' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename50' => 'Image', '36_anhang_tite51' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename51' => 'Image', '36_anhang_tite52' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename52' => 'Image', '36_anhang_tite53' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename53' => 'Image', '36_anhang_tite54' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename54' => 'Image', '36_KFSA Hand.hbeschreibung' => 'Beschreibung', '36_KFSA Kritanhang.krit_infotyp' => 'Infotyp', '36_KFSA Kritanhang.krit_infotext' => 'Infotext', '36_datumspezif' => 'Datum Spezifikation', 'index_orte_10' => 'Orte', 'index_orte_10.content' => 'Orte', 'index_orte_10.comment' => 'Orte (Kommentar)', 'index_personen_11' => 'Personen', 'index_personen_11.content' => 'Personen', 'index_personen_11.comment' => 'Personen (Kommentar)', 'index_werke_12' => 'Werke', 'index_werke_12.content' => 'Werke', 'index_werke_12.comment' => 'Werke (Kommentar)', 'index_periodika_13' => 'Periodika', 'index_periodika_13.content' => 'Periodika', 'index_periodika_13.comment' => 'Periodika (Kommentar)', 'index_sachen_14' => 'Sachen', 'index_sachen_14.content' => 'Sachen', 'index_sachen_14.comment' => 'Sachen (Kommentar)', 'index_koerperschaften_15' => 'Koerperschaften', 'index_koerperschaften_15.content' => 'Koerperschaften', 'index_koerperschaften_15.comment' => 'Koerperschaften (Kommentar)', 'index_zitate_16' => 'Zitate', 'index_zitate_16.content' => 'Zitate', 'index_zitate_16.comment' => 'Zitate (Kommentar)', 'index_korrespondenzpartner_17' => 'Korrespondenzpartner', 'index_korrespondenzpartner_17.content' => 'Korrespondenzpartner', 'index_korrespondenzpartner_17.comment' => 'Korrespondenzpartner (Kommentar)', 'index_archive_18' => 'Archive', 'index_archive_18.content' => 'Archive', 'index_archive_18.comment' => 'Archive (Kommentar)', 'index_literatur_19' => 'Literatur', 'index_literatur_19.content' => 'Literatur', 'index_literatur_19.comment' => 'Literatur (Kommentar)', 'index_kunstwerke_kfsa_20' => 'Kunstwerke KFSA', 'index_kunstwerke_kfsa_20.content' => 'Kunstwerke KFSA', 'index_kunstwerke_kfsa_20.comment' => 'Kunstwerke KFSA (Kommentar)', 'index_druckwerke_kfsa_21' => 'Druckwerke KFSA', 'index_druckwerke_kfsa_21.content' => 'Druckwerke KFSA', 'index_druckwerke_kfsa_21.comment' => 'Druckwerke KFSA (Kommentar)', '36_fulltext' => 'XML Volltext', '36_html' => 'HTML Volltext', '36_publicHTML' => 'HTML Volltext', '36_plaintext' => 'Volltext', 'transcript.text' => 'Transkripte', 'folders' => 'Mappen', 'notes' => 'Notizen', 'notes.title' => 'Notizen (Titel)', 'notes.content' => 'Notizen', 'notes.category' => 'Notizen (Kategorie)', 'key' => 'FuD Schlüssel' ) $query_id = '674072a4be40d' $value = '„Bonn den 21sten Februar 1826.<br>Ew. Excellenz haben die gerechteste Ursache von der Welt, ungehalten zu seyn. Daß Sie den Briefwechsel eine [...]“' $key = 'Incipit' $adrModalInfo = array( 'ID' => '2949', 'project' => '1', 'timecreate' => '2013-10-17 13:02:22', 'timelastchg' => '2018-01-11 15:52:48', 'key' => 'AWS-ap-00av', 'docTyp' => array( 'name' => 'Person', 'id' => '39' ), '39_name' => 'Humboldt, Wilhelm von', '39_geschlecht' => 'm', '39_gebdatum' => '1767-06-22', '39_toddatum' => '1835-04-08', '39_pdb' => 'GND', '39_dbid' => '118554727', '39_quellen' => 'NDB@https://www.deutsche-biographie.de/gnd118554727.html#ndbcontent@ ADB@https://www.deutsche-biographie.de/gnd118554727.html#adbcontent@ WBIS@http://db.saur.de/WBIS/basicSearch.jsf@J023-835-2@ Wikipedia@https://de.wikipedia.org/wiki/Wilhelm_von_Humboldt@', '39_geburtsort' => array( 'ID' => '2275', 'content' => 'Potsdam', 'bemerkung' => 'GND:4046948-7', 'LmAdd' => array() ), '39_sterbeort' => array( 'ID' => '10056', 'content' => 'Tegel', 'bemerkung' => 'GND:5007835-5', 'LmAdd' => array() ), '39_lebenwirken' => 'Politiker, Sprachforscher, Publizist, Philosoph Wilhelm von Humboldt wuchs auf Schloss Tegel auf, dem Familienbesitz der Humboldts. Ab 1787 studierte Wilhelm zusammen mit seinem Bruder Alexander an der Universität in Frankfurt (Oder) Rechtswissenschaften. Ein Jahr später wechselte er an die Universität Göttingen, wo er den gleichfalls dort studierenden AWS kennenlernte. 1789 führte ihn eine Reise in das revolutionäre Paris. Anfang 1790 trat er nach Beendigung des Studiums in den Staatsdienst und erhielt eine Anstellung im Justizdepartement. 1791 heiratete er Caroline von Dacheröden, die Tochter eines preußischen Kammergerichtsrates. Im selben Jahr schied er aus dem Staatsdienst aus, um auf den Gütern der Familie von Dacheröden seine Studien der altgriechischen Sprache, Kultur, Kunst und Philosophie fortzusetzen. 1794 zog er nach Jena. Humboldt fungierte als konstruktiver Kritiker und gelehrter Ratgeber für die Protagonisten der Weimarer Klassik. Ab November 1797 lebte er in Paris, um seine Studien fortzuführen. Ausgiebige Reisen nach Spanien dienten auch der Erforschung der baskischen Kultur und Sprache. Von 1802 bis 1808 agierte Humboldt als preußischer Gesandter beim Heiligen Stuhl in Rom. Mit der Aufgabe der konsularischen Vertretung war Humboldt zeitlich nicht überfordert, so dass er genug Gelegenheit hatte, seine Studien weiter zu betreiben und sein Domizil zu einem gesellschaftlichen Mittelpunkt zu machen. 1809 wurde er Sektionschef für Kultus und Unterricht im Ministerium des Innern in Berlin. Humboldt galt als liberaler Bildungsreformer. Zu seinen Leistungen gehören ein neu gegliedertes Bildungssystem, das allen Schichten die Möglichkeit des Zugangs zu Bildung zusichern sollte, und die Vereinheitlichung der Abschlussprüfungen. Als weiterer Meilenstein kann Humboldts Beteiligung bei der Gründung der Universität Berlin gelten; zahlreiche renommierte Wissenschaftler konnten für die Lehrstühle gewonnen werden. Die Eröffnung der Universität im Oktober 1810 fand allerdings ohne Humboldt statt. Nach Auseinandersetzungen verließ er den Bildungssektor und ging als preußischer Gesandter nach Wien, später nach London. In dieser Funktion war er am Wiener Kongress beteiligt. 1819 schied er aus dem Staatsdienst aus und beschäftigte sich weiter mit sprachwissenschaftlichen Forschungen, darunter auch dem Sanskrit und dem Kâwi, der Sprache der indonesischen Insel Java. Wilhelms Bruder Alexander von Humboldt war ein bedeutender Naturforscher, die Brüder Humboldt gelten als die „preußischen Dioskuren“.', '39_namevar' => 'Humboldt, Friedrich Wilhelm Christian Karl Ferdinand von Humboldt, Carl W. von Humboldt, Wilhelm F. von Humboldt, Guillaume de Humboldt, Karl W. von Humboldt, Carl Wilhelm von Humboldt, G. de', '39_beziehung' => 'AWS kannte Wilhelm von Humboldt schon aus Göttinger Studentenzeiten, in Jena begegneten sie sich wieder. Schlegel war 1805 Gast Humboldts in Rom, zur Zeit von dessen preußischer Gesandtschaft. Humboldt und AWS korrespondierten auch über ihre sprachwissenschaftlichen Studien, von großer Kenntnis Humboldts zeugen die ausführlichen brieflichen Diskussionen über das Sanskrit. Humboldt steuerte Aufsätze zu Schlegels „Indischer Bibliothek“ bei. Beide Gelehrte begegneten sich mit großem Respekt, auch wenn sie nicht in allen fachlichen Überzeugungen übereinstimmten.', '39_status_person' => 'Vollständig', '39_sourcename0' => 'AWS-ap-00av-0.jpg', 'folders' => array( (int) 0 => 'Personen', (int) 1 => 'Personen' ), '_label' => '', '_descr' => '', '_model' => 'Person', '_model_title' => 'Person', '_model_titles' => 'People', '_url' => '' ) $version = 'version-04-20' $domain = 'https://august-wilhelm-schlegel.de' $url = 'https://august-wilhelm-schlegel.de/version-04-20' $purl_web = 'https://august-wilhelm-schlegel.de/version-04-20/letters/view/3165' $state = '01.04.2020' $citation = 'Digitale Edition der Korrespondenz August Wilhelm Schlegels [01.04.2020]; August Wilhelm von Schlegel an Wilhelm von Humboldt; 21.02.1826' $lettermsg1 = 'August Wilhelm Schlegel: Digitale Edition der Korrespondenz [Version-04-20]' $lettermsg2 = ' <a href="https://august-wilhelm-schlegel.de/version-04-20/letters/view/3165">https://august-wilhelm-schlegel.de/version-04-20/letters/view/3165</a>.' $changeLeit = array( (int) 0 => 'Briefwechsel zwischen Wilhelm von Humboldt und August Wilhelm Schlegel. Hg. v. Albert Leitzmann. Halle 1908' ) $sprache = 'Deutsch' $caption = array( 'exists' => '1', 'content' => 'Digitalisat Druck' ) $tab = 'druck' $n = (int) 1
include - APP/View/Letters/view.ctp, line 339 View::_evaluate() - APP/Lib/cakephp/lib/Cake/View/View.php, line 971 View::_render() - APP/Lib/cakephp/lib/Cake/View/View.php, line 933 View::render() - APP/Lib/cakephp/lib/Cake/View/View.php, line 473 Controller::render() - APP/Lib/cakephp/lib/Cake/Controller/Controller.php, line 968 Dispatcher::_invoke() - APP/Lib/cakephp/lib/Cake/Routing/Dispatcher.php, line 200 Dispatcher::dispatch() - APP/Lib/cakephp/lib/Cake/Routing/Dispatcher.php, line 167 [main] - APP/webroot/index.php, line 109
Bonn den 21sten Februar 1826.
Ew. Excellenz haben die gerechteste Ursache von der Welt, ungehalten zu seyn. Daß Sie den Briefwechsel eine Zeitlang hatten ruhen lassen, war ganz in der Ordnung, und Ew. Excellenz durften darüber keine Sylbe verlieren. Ich besitze eine reichhaltige Sammlung Ihrer Briefe, woraus ich oft neue Anregung und Belehrung schöpfe. Jede Bereicherung ist unendlich willkommen. Wenn aber Ew. Excellenz unter so tiefen und weitumfassenden Forschungen, die Sie mit unermüdlicher Thätigkeit verfolgen, keine Muße finden, mir zu schreiben, so bescheide ich mich gern, daß mein persönliches Interesse gegen das allgemeine zurückstehen muß, und bin zufrieden, wenn ich nur auf andern Wegen die Gewißheit von Ihrer ununterbrochenen Heiterkeit und Gesundheit erhalte; und dieß war in jenem Zeitraume der Fall. Daß ich hingegen eine solche Sendung, wie Ihre letzte ist, so lange unbeantwortet lassen konnte, ist unerhört und unverantwortlich. Ich will nicht versuchen, es zu entschuldigen; erklären könnte ich es wohl aus der Beschaffenheit der Störungen, die ununterbrochen auf einander folgten, und mit solchen Studien ganz unverträglich sind. Unter andern mußte ich, gleich nach Empfang Ihres Schreibens, außer dem Rectorat über zwei Monate die Stelle des Regierungs-Bevollmächtigten vertreten. Doch ich müßte meinen ganzen zeitherigen Lebenslauf erzählen, und dieß wäre ein unnützer Zeitverlust. Ich komme lieber gleich zur Hauptsache.
Ew. Excellenz können nicht bezweifeln, daß ich mich sehr glücklich schätze, mit Ihren Bemerkungen über die Bhagavad Gita meine Indische Bibliothek auszuzieren. Das meiner Übersetzung ertheilte Lob ist freilich wohl etwas zu stark, um es selbst abdrucken zu lassen: aber wer mag sich entschließen, so etwas auszuschlagen? Nur des Sanskrit kundige Leser können das einzelne verstehen; aber alle denkenden Leser werden bei den vortrefflichen allgemeinen Bemerkungen ihre Rechnung finden. Leider kann ich noch nicht melden, daß an der Indischen Bibliothek wirklich gedruckt wird. Im Kopfe habe ich den Stoff zu mehreren Heften fertig, aber auf dem Papiere sehr weniges. Wie sehr ich gestört gewesen, können Ew. Excellenz eben daraus ermessen, daß ich, ungeachtet des neuen Antriebes, den Ihr Aufsatz mir gab, dennoch kein Heft zu Stande gebracht.
Ich war schon lange gesonnen, Nachträge zur Kritik und Auslegung der Bhagavad Gita zu geben: da werden sich nun die Ihrigen vortrefflich anschließen. Wäre es aber nicht gut, die betreffenden Stellen von Langlois französisch mit abzudrucken? Meine etwanigen Nebenbemerkungen, beistimmend, bestätigend oder bezweifelnd, möchten, wenn Ew. Excellenz es genehmigen, in kleinerer Schrift unter die einzelnen Abschnitte, oder als Noten unter den Text gesetzt werden.
Die Erlaubniß, etwas als unrichtig wegzustreichen, ist mir zu bedenklich, um Gebrauch davon zu machen. Wo ich für jetzt nicht beistimmen kann, wird es meistens disputable Punkte betreffen. Indessen lege ich auf einem besondern Blatte einiges vor, was vielleicht Ew. Excellenz zur Zurücknahme oder Modification weniger Zeilen veranlassen könnte, und erwarte darüber Ihre Entscheidung.
Kaum wage ich eine schüchterne Bitte um die Auslassung eines einzigen Wortes, welches nur zweimal vorkommt. Es ist das Wort pantheistisch. Da hier die Lehre der Bhagavad Gita nicht im Ganzen erörtert wird, so kann es ja entbehrt werden, es dürfte bloß heißen: „in diesem System“. Überdieß steht es bei einem Satze, worin die christlichen Mystiker wohl so ziemlich mit dem Verfasser der Bhagavad Gita übereinstimmen. Hier bildet es ein Präjudiz als ob die Sache schon ausgemacht wäre. Wenn die Behauptung im allgemeinen ausgeführt wird, dann ist es etwas andres. Mein Bruder hat schon früher die Lehre der Bhagavad Gita für Pantheismus erklärt. Ich habe ihm widersprochen, und behauptet, was ihn hiezu vermocht, seyen starke Ausdrücke von der dynamischen Allgegenwart. Ist zum reinen Theismus durchaus die Lehre von der Extramundanität der Gottheit erfoderlich? Die Immanenz des Weltalls lehrt die Bhagavad Gita freilich, unbeschadet der Emanation. Ist es im strengen Pantheismus möglich, die Gottheit von der Natur zu unterscheiden? Hört nicht alle Religion, alles ich und du, zwischen dem Gemüthe und der Gottheit auf? Ist damit die Lehre von der Vermittlung, von einer Herablassung der Gottheit um die Creatur zu sich heraufzuziehen, verträglich, welche doch so klar in der Bhagavad Gita vorgetragen wird? Ich habe ehemals die Schriften der Mystiker viel gelesen: mich dünkt, sie theilen sich in zwei Hauptclassen, die Theosophen und die Mystiker des Gefühls. Meines Erachtens stimmt mein Indischer Weiser so ziemlich mit den theosophischen Mystikern überein; weniger mit den letzteren, weil bei diesen der Sinn für die Natur ganz erloschen ist, welcher bei ihm in ursprünglicher mythologischer Fülle lebt.
Bei den scharfsinnigen Bemerkungen über die Bildung des philosophischen Sprachgebrauchs wage ich es, folgendes Ihrer Beurtheilung vorzulegen. In der Regel sind freilich die metaphysischen Ausdrücke von sinnlichen Vorstellungen übertragen; sollte es nicht aber auch in einigen Sprachen, und namentlich im Sanskrit, ursprünglich metaphysische Wörter geben? Z. B. dēha von dih, wie dēs͗a von dis͗, ganz etymologisch richtig. Nun heißt aber dih beschmieren, beflecken, besudeln. Wilson giebt zwar eine zweite Bedeutung, von der er es ableiten will. Aber ich kann mich nicht erinnern, das Verbum und insbesondre das häufige Participium digdha jemals anders als in der obigen Bedeutung gefunden zu haben. Auch steht in dem Wurzel-Wörterbuch bei Carey bloß lipi, in der Englischen Übersetzung bei Wilkins ebenfalls. Wunderlich genug steht aber dabei bloß Eine mit seiner Auslegung gar nicht übereinstimmende Definition upachayē, welches die zweite Bedeutung von Wilson ist. Wieder einmal ein Beispiel, wie unsere Elementar-Bücher noch beschaffen sind, und wie man sich überall selbst helfen, und die Augen offen haben muß! Wenn die zweite Bedeutung sich nicht praktisch bewährt, so bin ich sehr geneigt zu glauben, sie sei bloß von Indischen Grammatikern zum Behuf der Ableitung von dēha ersonnen. Ist es aber von dih in der Bedeutung von lipi, so liegt ja in dem einfachen Worte, wie im Keim, die ganze Platonische Lehre. Auch die andre Ableitung hat schon etwas wissenschaftliches. – Wie dem aber auch sei, das ist gewiß, daß bei den Indiern die Speculation so uralt und ihr Einfluß so überwiegend war, daß der metaphysische Sprachgebrauch in das Leben, wenigstens in die epische Poesie zurückgekehrt ist, und diese Erscheinung ist einzig in ihrer Art.
Meine Ansicht hängt freilich mit andern vielleicht paradoxen und deswegen besser esoterisch bleibenden Meynungen zusammen. Ich glaube nämlich, daß es ursprünglich tellurische, siderische und spirituale Sprachen giebt. Dieß würde auf die Eintheilung nach den drei gûńa’s hinauslaufen. Reine Exemplare von den drei Gattungen lassen sich freilich nicht nachweisen, man dürfte aber wohl versuchen, die Sprachen nach dem vorwaltenden Prinzip zu classifiziren.
Während ich dieses schrieb, empfing ich Ihre Abhandlung über die Buchstabenschrift, die ich sogleich verschlungen habe. In der Hauptsache bin ich ganz einverstanden. Mein einziger Zweifel ist nur der, ob nicht jene urweltliche Genialität, die bei der Erfindung der Buchstabenschrift gewaltet, jenes klare Bewußtseyn von den mit den Sprachorganen vorgenommenen und möglicher Weise vorzunehmenden Handlungen, von der symbolischen Bedeutung der Laute, ihrer Beziehung zu einander u. s. w.; ob, sage ich, jenes der Sprache bei ihrer Ausbildung nicht dieselben Dienste habe leisten können, als das materielle Vorhandenseyn der Buchstabenschrift?
Die Abweichung unsrer Ansichten – ich sage es mit Mistrauen gegen meine eigne Meynung – bezieht sich auf den Ursprung, und den frühesten Gang der menschlichen Cultur. Ich kann unmöglich die ersten großen Grundlagen als den späten und allmähligen Erfolg eines experimentirenden Herumtappens betrachten; sie scheinen mir ein genialischer Wurf zu seyn, wo alles mit Einemmale da ist, wie beim Anfange des organischen Lebens. Die Urväter des Menschengeschlechtes – einige, nicht alle; denn ich fürchte, ich bin in der dreifachen Ketzerei begriffen, ein Präadamit, ein Coadamit und ein Postadamit zu seyn – vergleiche ich mit Menschen, welche die Fähigkeit besessen hätten, in einem dunkeln Schacht durch die Kraft ihrer eignen Augen zu sehen, während unsre Bergleute sich der Lampen und Laternen bedienen müssen. Julius Caesar sagte, die Schrift habe das Gedächtniß zu Grunde gerichtet. Ist es nicht mit allen Dingen so? Je vollkommner die Hülfsmittel, desto mehr erlischt der inwohnende Sinn, das angebohrne Talent. Divinatorische Durchschauung der Natur, und von außen her erworbene Erfahrung scheinen mir die beiden Pole der menschlichen Cultur zu seyn; jenes der positive, dieses der negative. Wenn einmal in einem Zeitalter, wo das letzte Princip herrschend ist, jenes durchblitzt, so nimmt selbst das Experiment einen neuen Schwung, und die mechanischen Physiker, welche die Ideen läugnen, werden mehr von ihnen geleitet, als sie selbst wissen.
Um auf die Buchstabenschrift zurückzukommen, sie wäre also – da ihr Wesen in der Analyse der articulirten Laute besteht – virtualiter schon in der ältesten Zeit vorhanden gewesen, wenn es auch an zubereiteten Stoffen fehlte, um sie in Ausübung zu bringen.
Auch darin bin ich ganz einverstanden, daß eine gewisse todte und einförmige Regelmäßigkeit gar keine Vollkommenheit der Sprachen ist. Adelung hatte ganz richtig bemerkt, daß in der Deutschen Sprache die starke Conjugation (nach ihm die anomale) der schwachen mehr und mehr Platz einräume. Aber der geistlose Grammatiker hielt dieß für eine Vervollkommung, während es doch nur eine Abstumpfung ist. Die Mannigfaltigkeit der Formen, zB. der Declinationen und Conjugationen scheint mir, wenigstens imaginativ, bedeutsam gewesen zu seyn, was nachher verloren ging. Grimm betrachtet alle Anomalien als später und zufällig entstanden. Dieses gilt von den meisten, aber ich muß auch ursprüngliche, symbolische Anomalien annehmen, z. B. die der Personal-Pronomina in unsrer Sprachfamilie, und diesen Gesichtspunkt vermißte ich in Bopps sonst vortrefflicher Abhandlung. Eben so ist es mit der grammatischen Homonymie, wenn nämlich ganz verschiedene Biegungen gleich lauten. Dieses Gebrechen entsteht meistens aus der Abstumpfung, und nimmt daher bei nicht fixirten Sprachen, wie bisher bei der unsrigen, immer zu. Sollte es nicht aber auch ursprüngliche grammatische Homonymien geben, die symbolisch sind? ZB. logisch betrachtet ist es gleichgültig ob Subject und Object belebte Wesen oder unbelebte Dinge sind; imaginativ aber keinesweges, denn das Unbelebte handelt und leidet nicht eigentlich: es wirkt und erfährt Wirkungen. Diese neutrale Stellung wird nun durch die Gleichheit des Accusativus und Nominativus der Neutra [angedeutet], welche deswegen im Sanskrit, im Griechischen und Lateinischen eine wahre Schönheit ist. Im Deutschen ist es keine Schönheit mehr, weil so viele masculina und sämtliche feminina diese Eigenschaft mit den neutris gemein haben.
Ich kehre von meinen endlosen Abschweifungen zurück, um zu Ihrer Abhandlung eine kleine historische Bemerkung nachzutragen. Sie bemerken p. 1, daß die Chinesen die Europäische Buchstabenschrift verschmäht haben. Aber die Unmöglichkeit, sie ihrer Sprache anzueignen, erhellet doch noch weit stärker aus der unläugbaren Thatsache, daß die Indische Buchstabenschrift von den ersten Buddhistischen Missionaren überbracht worden war. Rémusat hat in einem eignen Aufsatze, ich weiß nicht mehr in welcher Zeitschrift, die Weise geschildert, wie ein chinesischer Autor von dieser fremden Theorie der Laute Rechenschaft giebt. Der Baron Schilling von Canstadt hat mir ein chinesisches Buch gezeigt, wo in einer Columne indische Sylben standen, in der nächsten die Lautbezeichnung, in chinesischer Schrift, in einer dritten die Bedeutung. Ohne Zweifel waren es mantra’s, ich hatte nicht Muße es näher zu untersuchen.
Nun noch einiges über meine französischen Kritiker und meine zu machenden Antikritiken. Wird es Ew. Excellenz unangenehm seyn, wenn ich in der Nachbarschaft Ihres so milden und ruhigen Aufsatzes mir einigen Spott über Chézy und Langlois erlaube? Nach Ihrer gütigen Gesinnung für mich hatten die Artikel des letzteren Sie indignirt, und Sie hatten die magistrale Recension noch nicht gelesen. Auf Colebrooke haben sie denselben Eindruck gemacht. Er schrieb mir: The articles, to which you allude in the Journal Asiatique, had not escaped me. I regretted to observe the tone of them. Such is not the spirit, which fellow-labourers in the great cause of Oriental litterature should evince towards each other. Nun stellen Sie sich meine Ataraxie vor: bis jetzt eben, wo ich Ihre Bemerkungen genau von neuem durchging, hatte ich jene kaum flüchtig gelesen. Freilich wußte ich im voraus, daß Chézys Eifersucht zu einer wahren Wuth gesteigert war. Dieses dauert noch immer fort, und ist eine wahre Tragi-Komödie. Seine Absicht war im Journal Asiatique mich noch weit gröber anzugreifen, aber Rémusat protestirte nachdrücklich dagegen, und so wurden dem Langlois die Höflichkeiten in seinem ersten Artikel abgedrungen.
In London bat ich Colebrooke, für meine Rechnung Commentare des Bhagavad Gita aus Calcutta zu verschreiben. Ich gedachte erst jede Beantwortung der Kritiken bis auf deren Ankunft zu verschieben, weil es sonst gewissermaßen ein Kampf mit ungleichen Waffen ist, da meine Gegner sich immer auf die Autorität des Scholiasten berufen. Indessen, da die Commentare leider nicht ankommen, so werden die Delinquenten doch nun wohl bei den nächsten Assisen vorgenommen werden müssen. Ich besitze nur das 2te Capitel der Subôdhinê, in meiner eignen Abschrift; und dieses leistet mir schon gute Dienste. Zuverläßig hat Langlois – folglich auch Chézy – den Commentator häufig misverstanden. Er hat Cahier 34, p. 248 ad Bh.G. XI, 22, nicht gemerkt, daß das von ihm abgeschriebene Scholion eine Citation aus den Véda’s enthält.
Folgendes hätte mir gleich beim Empfange Ihres Schreibens einfallen sollen, und ich hole es mit Beschämung nach. Mein Schüler hat einen vollständigen und sauber geschriebenen Index Verborum zur Bhagavad Gita verfertigt: könnte dieser Ew. Excellenz bei der Beschäftigung mit dem Inhalte bequem seyn, so bin ich bereit ihn auf eine Zeitlang zu übersenden. Freilich müßte ich ihn bei der Antikritik zur Hand haben, aber diese kann ich wohl vorher abthun.
Ich bin fast entschlossen, sie französisch zu schreiben, damit sie doch an die rechte Adresse gelangt.
Wenn die Tugend in einer Mitte zwischen zwei Extremen besteht, so übe ich sie beim Briefwechsel gewiß nicht aus, indem ich entweder gar nicht oder endlos lange Briefe schreibe. Ich schließe mit dem Versprechen, mich wo möglich in beiden Punkten zu bessern. Mit unwandelbarer Verehrung und Ergebenheit
Ew. Excellenz
gehorsamster
AWvSchlegel.
Eine Sendung von einigen gedruckten Sachen, lateinischen und deutschen, wird hoffentlich richtig angekommen seyn.
Ew. Excellenz haben die gerechteste Ursache von der Welt, ungehalten zu seyn. Daß Sie den Briefwechsel eine Zeitlang hatten ruhen lassen, war ganz in der Ordnung, und Ew. Excellenz durften darüber keine Sylbe verlieren. Ich besitze eine reichhaltige Sammlung Ihrer Briefe, woraus ich oft neue Anregung und Belehrung schöpfe. Jede Bereicherung ist unendlich willkommen. Wenn aber Ew. Excellenz unter so tiefen und weitumfassenden Forschungen, die Sie mit unermüdlicher Thätigkeit verfolgen, keine Muße finden, mir zu schreiben, so bescheide ich mich gern, daß mein persönliches Interesse gegen das allgemeine zurückstehen muß, und bin zufrieden, wenn ich nur auf andern Wegen die Gewißheit von Ihrer ununterbrochenen Heiterkeit und Gesundheit erhalte; und dieß war in jenem Zeitraume der Fall. Daß ich hingegen eine solche Sendung, wie Ihre letzte ist, so lange unbeantwortet lassen konnte, ist unerhört und unverantwortlich. Ich will nicht versuchen, es zu entschuldigen; erklären könnte ich es wohl aus der Beschaffenheit der Störungen, die ununterbrochen auf einander folgten, und mit solchen Studien ganz unverträglich sind. Unter andern mußte ich, gleich nach Empfang Ihres Schreibens, außer dem Rectorat über zwei Monate die Stelle des Regierungs-Bevollmächtigten vertreten. Doch ich müßte meinen ganzen zeitherigen Lebenslauf erzählen, und dieß wäre ein unnützer Zeitverlust. Ich komme lieber gleich zur Hauptsache.
Ew. Excellenz können nicht bezweifeln, daß ich mich sehr glücklich schätze, mit Ihren Bemerkungen über die Bhagavad Gita meine Indische Bibliothek auszuzieren. Das meiner Übersetzung ertheilte Lob ist freilich wohl etwas zu stark, um es selbst abdrucken zu lassen: aber wer mag sich entschließen, so etwas auszuschlagen? Nur des Sanskrit kundige Leser können das einzelne verstehen; aber alle denkenden Leser werden bei den vortrefflichen allgemeinen Bemerkungen ihre Rechnung finden. Leider kann ich noch nicht melden, daß an der Indischen Bibliothek wirklich gedruckt wird. Im Kopfe habe ich den Stoff zu mehreren Heften fertig, aber auf dem Papiere sehr weniges. Wie sehr ich gestört gewesen, können Ew. Excellenz eben daraus ermessen, daß ich, ungeachtet des neuen Antriebes, den Ihr Aufsatz mir gab, dennoch kein Heft zu Stande gebracht.
Ich war schon lange gesonnen, Nachträge zur Kritik und Auslegung der Bhagavad Gita zu geben: da werden sich nun die Ihrigen vortrefflich anschließen. Wäre es aber nicht gut, die betreffenden Stellen von Langlois französisch mit abzudrucken? Meine etwanigen Nebenbemerkungen, beistimmend, bestätigend oder bezweifelnd, möchten, wenn Ew. Excellenz es genehmigen, in kleinerer Schrift unter die einzelnen Abschnitte, oder als Noten unter den Text gesetzt werden.
Die Erlaubniß, etwas als unrichtig wegzustreichen, ist mir zu bedenklich, um Gebrauch davon zu machen. Wo ich für jetzt nicht beistimmen kann, wird es meistens disputable Punkte betreffen. Indessen lege ich auf einem besondern Blatte einiges vor, was vielleicht Ew. Excellenz zur Zurücknahme oder Modification weniger Zeilen veranlassen könnte, und erwarte darüber Ihre Entscheidung.
Kaum wage ich eine schüchterne Bitte um die Auslassung eines einzigen Wortes, welches nur zweimal vorkommt. Es ist das Wort pantheistisch. Da hier die Lehre der Bhagavad Gita nicht im Ganzen erörtert wird, so kann es ja entbehrt werden, es dürfte bloß heißen: „in diesem System“. Überdieß steht es bei einem Satze, worin die christlichen Mystiker wohl so ziemlich mit dem Verfasser der Bhagavad Gita übereinstimmen. Hier bildet es ein Präjudiz als ob die Sache schon ausgemacht wäre. Wenn die Behauptung im allgemeinen ausgeführt wird, dann ist es etwas andres. Mein Bruder hat schon früher die Lehre der Bhagavad Gita für Pantheismus erklärt. Ich habe ihm widersprochen, und behauptet, was ihn hiezu vermocht, seyen starke Ausdrücke von der dynamischen Allgegenwart. Ist zum reinen Theismus durchaus die Lehre von der Extramundanität der Gottheit erfoderlich? Die Immanenz des Weltalls lehrt die Bhagavad Gita freilich, unbeschadet der Emanation. Ist es im strengen Pantheismus möglich, die Gottheit von der Natur zu unterscheiden? Hört nicht alle Religion, alles ich und du, zwischen dem Gemüthe und der Gottheit auf? Ist damit die Lehre von der Vermittlung, von einer Herablassung der Gottheit um die Creatur zu sich heraufzuziehen, verträglich, welche doch so klar in der Bhagavad Gita vorgetragen wird? Ich habe ehemals die Schriften der Mystiker viel gelesen: mich dünkt, sie theilen sich in zwei Hauptclassen, die Theosophen und die Mystiker des Gefühls. Meines Erachtens stimmt mein Indischer Weiser so ziemlich mit den theosophischen Mystikern überein; weniger mit den letzteren, weil bei diesen der Sinn für die Natur ganz erloschen ist, welcher bei ihm in ursprünglicher mythologischer Fülle lebt.
Bei den scharfsinnigen Bemerkungen über die Bildung des philosophischen Sprachgebrauchs wage ich es, folgendes Ihrer Beurtheilung vorzulegen. In der Regel sind freilich die metaphysischen Ausdrücke von sinnlichen Vorstellungen übertragen; sollte es nicht aber auch in einigen Sprachen, und namentlich im Sanskrit, ursprünglich metaphysische Wörter geben? Z. B. dēha von dih, wie dēs͗a von dis͗, ganz etymologisch richtig. Nun heißt aber dih beschmieren, beflecken, besudeln. Wilson giebt zwar eine zweite Bedeutung, von der er es ableiten will. Aber ich kann mich nicht erinnern, das Verbum und insbesondre das häufige Participium digdha jemals anders als in der obigen Bedeutung gefunden zu haben. Auch steht in dem Wurzel-Wörterbuch bei Carey bloß lipi, in der Englischen Übersetzung bei Wilkins ebenfalls. Wunderlich genug steht aber dabei bloß Eine mit seiner Auslegung gar nicht übereinstimmende Definition upachayē, welches die zweite Bedeutung von Wilson ist. Wieder einmal ein Beispiel, wie unsere Elementar-Bücher noch beschaffen sind, und wie man sich überall selbst helfen, und die Augen offen haben muß! Wenn die zweite Bedeutung sich nicht praktisch bewährt, so bin ich sehr geneigt zu glauben, sie sei bloß von Indischen Grammatikern zum Behuf der Ableitung von dēha ersonnen. Ist es aber von dih in der Bedeutung von lipi, so liegt ja in dem einfachen Worte, wie im Keim, die ganze Platonische Lehre. Auch die andre Ableitung hat schon etwas wissenschaftliches. – Wie dem aber auch sei, das ist gewiß, daß bei den Indiern die Speculation so uralt und ihr Einfluß so überwiegend war, daß der metaphysische Sprachgebrauch in das Leben, wenigstens in die epische Poesie zurückgekehrt ist, und diese Erscheinung ist einzig in ihrer Art.
Meine Ansicht hängt freilich mit andern vielleicht paradoxen und deswegen besser esoterisch bleibenden Meynungen zusammen. Ich glaube nämlich, daß es ursprünglich tellurische, siderische und spirituale Sprachen giebt. Dieß würde auf die Eintheilung nach den drei gûńa’s hinauslaufen. Reine Exemplare von den drei Gattungen lassen sich freilich nicht nachweisen, man dürfte aber wohl versuchen, die Sprachen nach dem vorwaltenden Prinzip zu classifiziren.
Während ich dieses schrieb, empfing ich Ihre Abhandlung über die Buchstabenschrift, die ich sogleich verschlungen habe. In der Hauptsache bin ich ganz einverstanden. Mein einziger Zweifel ist nur der, ob nicht jene urweltliche Genialität, die bei der Erfindung der Buchstabenschrift gewaltet, jenes klare Bewußtseyn von den mit den Sprachorganen vorgenommenen und möglicher Weise vorzunehmenden Handlungen, von der symbolischen Bedeutung der Laute, ihrer Beziehung zu einander u. s. w.; ob, sage ich, jenes der Sprache bei ihrer Ausbildung nicht dieselben Dienste habe leisten können, als das materielle Vorhandenseyn der Buchstabenschrift?
Die Abweichung unsrer Ansichten – ich sage es mit Mistrauen gegen meine eigne Meynung – bezieht sich auf den Ursprung, und den frühesten Gang der menschlichen Cultur. Ich kann unmöglich die ersten großen Grundlagen als den späten und allmähligen Erfolg eines experimentirenden Herumtappens betrachten; sie scheinen mir ein genialischer Wurf zu seyn, wo alles mit Einemmale da ist, wie beim Anfange des organischen Lebens. Die Urväter des Menschengeschlechtes – einige, nicht alle; denn ich fürchte, ich bin in der dreifachen Ketzerei begriffen, ein Präadamit, ein Coadamit und ein Postadamit zu seyn – vergleiche ich mit Menschen, welche die Fähigkeit besessen hätten, in einem dunkeln Schacht durch die Kraft ihrer eignen Augen zu sehen, während unsre Bergleute sich der Lampen und Laternen bedienen müssen. Julius Caesar sagte, die Schrift habe das Gedächtniß zu Grunde gerichtet. Ist es nicht mit allen Dingen so? Je vollkommner die Hülfsmittel, desto mehr erlischt der inwohnende Sinn, das angebohrne Talent. Divinatorische Durchschauung der Natur, und von außen her erworbene Erfahrung scheinen mir die beiden Pole der menschlichen Cultur zu seyn; jenes der positive, dieses der negative. Wenn einmal in einem Zeitalter, wo das letzte Princip herrschend ist, jenes durchblitzt, so nimmt selbst das Experiment einen neuen Schwung, und die mechanischen Physiker, welche die Ideen läugnen, werden mehr von ihnen geleitet, als sie selbst wissen.
Um auf die Buchstabenschrift zurückzukommen, sie wäre also – da ihr Wesen in der Analyse der articulirten Laute besteht – virtualiter schon in der ältesten Zeit vorhanden gewesen, wenn es auch an zubereiteten Stoffen fehlte, um sie in Ausübung zu bringen.
Auch darin bin ich ganz einverstanden, daß eine gewisse todte und einförmige Regelmäßigkeit gar keine Vollkommenheit der Sprachen ist. Adelung hatte ganz richtig bemerkt, daß in der Deutschen Sprache die starke Conjugation (nach ihm die anomale) der schwachen mehr und mehr Platz einräume. Aber der geistlose Grammatiker hielt dieß für eine Vervollkommung, während es doch nur eine Abstumpfung ist. Die Mannigfaltigkeit der Formen, zB. der Declinationen und Conjugationen scheint mir, wenigstens imaginativ, bedeutsam gewesen zu seyn, was nachher verloren ging. Grimm betrachtet alle Anomalien als später und zufällig entstanden. Dieses gilt von den meisten, aber ich muß auch ursprüngliche, symbolische Anomalien annehmen, z. B. die der Personal-Pronomina in unsrer Sprachfamilie, und diesen Gesichtspunkt vermißte ich in Bopps sonst vortrefflicher Abhandlung. Eben so ist es mit der grammatischen Homonymie, wenn nämlich ganz verschiedene Biegungen gleich lauten. Dieses Gebrechen entsteht meistens aus der Abstumpfung, und nimmt daher bei nicht fixirten Sprachen, wie bisher bei der unsrigen, immer zu. Sollte es nicht aber auch ursprüngliche grammatische Homonymien geben, die symbolisch sind? ZB. logisch betrachtet ist es gleichgültig ob Subject und Object belebte Wesen oder unbelebte Dinge sind; imaginativ aber keinesweges, denn das Unbelebte handelt und leidet nicht eigentlich: es wirkt und erfährt Wirkungen. Diese neutrale Stellung wird nun durch die Gleichheit des Accusativus und Nominativus der Neutra [angedeutet], welche deswegen im Sanskrit, im Griechischen und Lateinischen eine wahre Schönheit ist. Im Deutschen ist es keine Schönheit mehr, weil so viele masculina und sämtliche feminina diese Eigenschaft mit den neutris gemein haben.
Ich kehre von meinen endlosen Abschweifungen zurück, um zu Ihrer Abhandlung eine kleine historische Bemerkung nachzutragen. Sie bemerken p. 1, daß die Chinesen die Europäische Buchstabenschrift verschmäht haben. Aber die Unmöglichkeit, sie ihrer Sprache anzueignen, erhellet doch noch weit stärker aus der unläugbaren Thatsache, daß die Indische Buchstabenschrift von den ersten Buddhistischen Missionaren überbracht worden war. Rémusat hat in einem eignen Aufsatze, ich weiß nicht mehr in welcher Zeitschrift, die Weise geschildert, wie ein chinesischer Autor von dieser fremden Theorie der Laute Rechenschaft giebt. Der Baron Schilling von Canstadt hat mir ein chinesisches Buch gezeigt, wo in einer Columne indische Sylben standen, in der nächsten die Lautbezeichnung, in chinesischer Schrift, in einer dritten die Bedeutung. Ohne Zweifel waren es mantra’s, ich hatte nicht Muße es näher zu untersuchen.
Nun noch einiges über meine französischen Kritiker und meine zu machenden Antikritiken. Wird es Ew. Excellenz unangenehm seyn, wenn ich in der Nachbarschaft Ihres so milden und ruhigen Aufsatzes mir einigen Spott über Chézy und Langlois erlaube? Nach Ihrer gütigen Gesinnung für mich hatten die Artikel des letzteren Sie indignirt, und Sie hatten die magistrale Recension noch nicht gelesen. Auf Colebrooke haben sie denselben Eindruck gemacht. Er schrieb mir: The articles, to which you allude in the Journal Asiatique, had not escaped me. I regretted to observe the tone of them. Such is not the spirit, which fellow-labourers in the great cause of Oriental litterature should evince towards each other. Nun stellen Sie sich meine Ataraxie vor: bis jetzt eben, wo ich Ihre Bemerkungen genau von neuem durchging, hatte ich jene kaum flüchtig gelesen. Freilich wußte ich im voraus, daß Chézys Eifersucht zu einer wahren Wuth gesteigert war. Dieses dauert noch immer fort, und ist eine wahre Tragi-Komödie. Seine Absicht war im Journal Asiatique mich noch weit gröber anzugreifen, aber Rémusat protestirte nachdrücklich dagegen, und so wurden dem Langlois die Höflichkeiten in seinem ersten Artikel abgedrungen.
In London bat ich Colebrooke, für meine Rechnung Commentare des Bhagavad Gita aus Calcutta zu verschreiben. Ich gedachte erst jede Beantwortung der Kritiken bis auf deren Ankunft zu verschieben, weil es sonst gewissermaßen ein Kampf mit ungleichen Waffen ist, da meine Gegner sich immer auf die Autorität des Scholiasten berufen. Indessen, da die Commentare leider nicht ankommen, so werden die Delinquenten doch nun wohl bei den nächsten Assisen vorgenommen werden müssen. Ich besitze nur das 2te Capitel der Subôdhinê, in meiner eignen Abschrift; und dieses leistet mir schon gute Dienste. Zuverläßig hat Langlois – folglich auch Chézy – den Commentator häufig misverstanden. Er hat Cahier 34, p. 248 ad Bh.G. XI, 22, nicht gemerkt, daß das von ihm abgeschriebene Scholion eine Citation aus den Véda’s enthält.
Folgendes hätte mir gleich beim Empfange Ihres Schreibens einfallen sollen, und ich hole es mit Beschämung nach. Mein Schüler hat einen vollständigen und sauber geschriebenen Index Verborum zur Bhagavad Gita verfertigt: könnte dieser Ew. Excellenz bei der Beschäftigung mit dem Inhalte bequem seyn, so bin ich bereit ihn auf eine Zeitlang zu übersenden. Freilich müßte ich ihn bei der Antikritik zur Hand haben, aber diese kann ich wohl vorher abthun.
Ich bin fast entschlossen, sie französisch zu schreiben, damit sie doch an die rechte Adresse gelangt.
Wenn die Tugend in einer Mitte zwischen zwei Extremen besteht, so übe ich sie beim Briefwechsel gewiß nicht aus, indem ich entweder gar nicht oder endlos lange Briefe schreibe. Ich schließe mit dem Versprechen, mich wo möglich in beiden Punkten zu bessern. Mit unwandelbarer Verehrung und Ergebenheit
Ew. Excellenz
gehorsamster
AWvSchlegel.
Eine Sendung von einigen gedruckten Sachen, lateinischen und deutschen, wird hoffentlich richtig angekommen seyn.