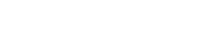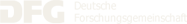Notice (8): Undefined offset: 0 [APP/View/Letters/view.ctp, line 360]
Code Context
/version-04-20/letters/view/3494" data-language=""></ul></div><div id="zoomImage1" style="height:695px" class="open-sea-dragon" data-src="<?php echo $this->Html->url($dzi_imagesDruck[0]) ?>" data-language="<?=$this->Session->read('Config.language')?>"></div>
$viewFile = '/var/www/awschlegel/version-04-20/app/View/Letters/view.ctp' $dataForView = array( 'html' => '[1] [<span class="index-887 tp-99166 ">Bonn</span>,] 19. Januar 1820.<br><span class="doc-3500 ">Ihren Brief vom 8. Januar</span> erhielt ich vor einigen Tagen, mein teurer und hochverehrter Freund, und eile zuvörderst, Ihren freundschaftlichen Vorwürfen zu begegnen. Meine Gesinnungen gegen Sie können sich nie ändern. Ich werde Ihnen zeitlebens dankbar sein für die freundschaftliche Wärme, womit Sie zu meiner Hilfe herbeigeeilt sind, als ich in <span class="index-898 tp-99167 ">Auxerre</span> krank lag: <span class="cite tp-54866 ">ich erzähle es gern, daß Sie mich damals den Klauen ungeschickter Ärzte, oder was einerlei ist, dem Tode entrissen haben</span>. Aber ich fand nicht bloß eine Befriedigung des Herzens in Ihrem Wohlwollen, Ihr Umgang gewährte mir den lebhaftesten Genuß, und die Tage, die ich mit Ihnen in <span class="index-171 tp-99168 ">Paris</span>, auf dem Lande, in der Schweiz, oder wo es sein mochte, zugebracht, gehören zu meinen angenehmsten Erinnerungen.<br>Immer freute ich mich, in Ihnen den witzigen Gesellschafter, den geistreichen Beobachter der Welt, den ideenreichen Forscher wiederzufinden und meinen Geist durch Ihre Mitteilungen anzuregen. Als ich im Jahre 1817 <span class="index-222 tp-99170 ">einen unersetzlichen Verlust</span> erlitten hatte, als die Auflösung eines Verhältnisses ohnegleichen durch den Tod mir eine unerwünschte Freiheit wiedergab, habe ich in Ihren Einladungen zur Rückkehr nach Deutschland aufs neue Ihren freundschaftlichen Eifer erkannt. Bei unserem Zusammentreffen in <span class="index-1591 tp-99169 ">Koblenz</span> und in Bonn glaubte ich von Ihrer Seite einige Zurückhaltung [2] zu bemerken und vermied es, diese Grenze zu durchbrechen. Seitdem ist, soviel ich weiß, keine Botschaft von Ihnen zu mir gelangt, sonst wäre sie nicht unerwidert geblieben. Sie kennen meine alte Nachlässigkeit im Briefschreiben: es ist ein Familienfehler, den sogar <span class="index-8 tp-99171 ">mein Bruder</span> mir zugute halten muß, so wie ich ihm. Überdies, was hätte ich Ihnen, der Sie in mannigfaltigen und bedeutenden Weltverhältnissen leben, aus meiner wissenschaftlichen Eingezogenheit Unterhaltendes melden können? Dazu kam, daß ich seit meiner Ankunft in Bonn sehr häufig verstimmt war, und zwar durch einen Verdruß der Art, wovon man nicht gern redet. Dies führt mich auf die Verleumdungen, deren Sie erwähnen. Sie können, mein teurer Freund, keine sehr schweren Kämpfe zu bestehen gehabt haben, denn die lügenhafte Abgeschmacktheit dieser Verleumdungen mußte jedem Unbefangenen in die Augen springen. Vergebens habe ich <span class="index-243 tp-99173 index-186 tp-99172 index-2402 tp-99174 ">die Urheber</span> durch die geringschätzigste Zurückweisung ihrer Zumutungen aufgefordert, ans Licht hervorzutreten, um mir alsdann volle Genugtuung zu schaffen. Sie haben sich wohl davor gehütet. Sie hatten mit bleiernen Pfeilen auf eine stählerne Rüstung geschossen. Das flüchtige Aufsehen ist längst in tiefe Vergessenheit begraben, ich genieße aus der Ferne und Nähe der gewohnten Achtung. Übrigens waren in Berlin zwei verehrte Freunde von mir, <span class="index-2429 tp-99175 ">der General v. Müffling</span> und <span class="index-276 tp-99176 ">der Staatsrat Hufeland</span>, näher von der Sache unterrichtet und werden [3] wohl gelegentlich das Nötige gesagt haben. Wenn es Sie interessieren kann, will ich Sie ein andermal davon unterhalten: mir ist es nun schon gleichgültig geworden, aber es bleibt immer eine seltsam merkwürdige Geschichte.<br>Sie sehen, daß ich das Bedürfnis habe, zu Ihnen im vollen Vertrauen der Freundschaft zu reden. Aber kommen wir nach dieser schon allzu langen Vorrede auf die Hauptsache. Auch hier muß ich zuvörderst einige irrige Annahmen aus dem Wege räumen, die ich in Ihrem Briefe bemerke.<br>Ich gebe Ihnen mein Ehrenwort, daß ich den getanen Schritt mit niemandem verabredet, noch viel weniger mich dazu verbindlich gemacht [habe]. Der Entschluß ist ganz aus mir selbst hervorgegangen. Sollte in einer Stelle Ihres Briefes, was ich kaum glauben kann, <span class="index-2323 tp-99177 ">unser allgemein geliebter und verehrter, leider ehemaliger Kurator</span> gemeint sein, so kann ich versichern, daß er, wiewohl es ihn geschmerzt hat, sich für jetzt von <span class="index-6155 tp-99178 ">der Universität</span> zu trennen, den aufrichtigsten Anteil an ihrem fortwährenden Gedeihen nimmt, und daß er, in der Voraussetzung, ich könnte im Sinne haben, mich von dem Lehramte zurückzuziehen, mir die dringendsten Gründe entgegengestellt hat. Ich habe die Sache ganz als meine Privatangelegenheit behandelt, ich habe mich nur wenigen Freunden im engsten Vertrauen [4] eröffnet, ich habe fortgefahren, <span class="index-2452 tp-99223 index-3452 tp-99220 index-4972 tp-99224 index-2435 tp-99221 index-3730 tp-99225 index-4965 tp-99226 index-3511 tp-99227 index-2475 tp-99228 ">meine Vorlesungen</span> mit dem gewohnten Fleiße zu geben, und das hiesige Publikum hat erst aus dem Berlinischen Zeitungsartikel etwas erfahren. Aber auch jetzt weiche ich den deshalb an mich geschehenden Anfragen durch unbestimmte Äußerungen aus. <br>Ferner muß ich erklären, daß der Aufenthalt in Bonn mir keineswegs mißfällt, sondern daß ich vielmehr eine große Neigung dazu gefaßt habe. Die heitere Gegend, das milde Klima, die bequeme Lage zu kleinen und großen Reisen, das freundschaftliche Verhältnis mit meinen Amtsgenossen, die gesellige Ungezwungenheit, selbst Beschränktheit einer kleinen Stadt sagten mir zu. Dazu kommt nun, daß ich meine gelehrten Vorräte nicht ohne Mühe und Kosten um mich her versammelt und mich angenehm eingerichtet habe. Ich hatte es recht eigentlich darauf angelegt, in meinem Hause einen literarischen Zirkel zu bilden. Ich hege keine Abneigung gegen <span class="index-15 tp-99179 ">Berlin</span>, das ich ja von alter Zeit kenne. Nur scheute ich das rauhere Klima und die weite Entfernung von meinen Freunden in Frankreich. Auch glaubte ich den geselligen Anforderungen dort nicht ausweichen zu können, und meine Gesundheit sowohl als meine weit aussehenden Forschungen fordern eine von den Zerstreuungen der großen Welt ungestörte Ruhe. <br>[5] Ich habe ja selbst um die Verlängerung meines hiesigen Aufenthalts bis zum nächsten Herbst angehalten, und <span class="index-5440 tp-99180 ">das Ministerium</span> hat die Gnade gehabt, mein Gesuch zu bewilligen. Ich hoffte in der Folge, vielleicht mit dem Vorbehalt, eine Reihe von Vorlesungen in Berlin zu geben, meine definitive Bestimmung für Bonn auszuwirken. Hier fand ich eine besonders erfreuliche Sphäre gelehrter Tätigkeit, wo man die Früchte seines Fleißes gleichsam vor seinen Augen wachsen und reifen sehen konnte. Es war ein herrlicher Gedanke, hier am Rheine gründliche deutsche Bildung und Liebe dazu zu verbreiten. Sie haben recht, teuerster Freund, <span class="index-12214 tp-99181 ">die kgl. preußische Regierung</span> hat unendlich viel für Kunst und Wissenschaft getan, und die Stiftung von Bonn war ein echt vaterländisches Ereignis. Die Wahl des Ortes war die glücklichste: die königliche Freigebigkeit <span class="index-515 tp-99182 ">des Monarchen</span>, die weise Sorgfalt des Ministeriums können nicht genug gepriesen werden. Ich war stolz darauf, Fremden, die mich besuchten, dem Grafen Montlosier, <span class="index-2321 tp-99183 ">dem Herzog von Richelieu</span>, <span class="index-1386 tp-99184 ">dem Grafen Reinhard</span>, den großen Umfang und die Vortrefflichkeit der neuen Anstalt darlegen zu können. Ich brachte sie zu dem Geständnis, daß es in Frankreich, wenigstens außer Paris, nichts Ähnliches gebe. Ich lege Ihnen einen Brief des Herzogs von Richelieu bei, den er mir kurz nach seinem Besuche schrieb. <br>Wenn viel für uns [6] geschehen war, so haben wir uns auch unsererseits wacker gerührt. Vierhundert Studierende, darunter eine große Anzahl schon gebildeter junger Männer aus allen Gegenden Deutschlands, im ersten Jahre nach der Stiftung: das ist in den Annalen der Universitäten unerhört. Ich gebe diesen Winter eine öffentliche Vorlesung vor zweihundert Zuhörern. ‒ Wenn es ungestört so fortgegangen wäre, so hätten wir in einigen Jahren an Frequenz und Ruhm auch im Auslande, mit <span class="index-6154 tp-99186 index-2 tp-99185 ">Göttingen</span> wetteifern mögen. <br>Freilich, es ist ein Großes, wenn der Staat Aufwand für wissenschaftliche Anstalten macht, den Gelehrten ihre Existenz reichlich sichert. Aber diese Wohltaten verlieren ihre Kraft, wenn nicht noch eine, die höchste hinzukommt: ehrenvolle Auszeichnungen, aufmunternde Beweise des Wohlwollens von seiten der Regierung. Der akademische Lehrer insbesondere kann das Zutrauen nicht entbehren. Und dieses Zutrauen haben wir nun durch eine unglückliche Konstellation verwirkt, ich weiß nicht wie; wenigstens scheinen mir die Anlässe in gar keinem Verhältnisse mit den Folgen zu stehen. Von einem großen Staatenverein ist das Anathema ausgesprochen worden. Der Widerhall davon ist durch Europa erschollen, und wir mögen nun bald in amerikanischen Zeitungsblättern lesen, daß wir, sämtlich oder großenteils, Verführer der Jugend sind. Doch ich will auf das, was die deutschen Universitäten im allgemeinen seit <span class="index-19747 tp-99200 index-3392 tp-99201 ">der Schrift</span> von <span class="index-2427 tp-99192 ">Stourdza</span> betroffen hat, nicht eingehen. Mein Brief würde zum Buche [7] werden, Sie würden meiner Ansicht Ihre Gründe entgegenstellen, und am Ende würde vielleicht keiner den anderen überzeugen. Ich beschränke mich auf meine eigene Angelegenheit. Zu dem getanen Schritte hat mich nichts anderes bewogen als die Überzeugung, wovon ich auch jetzt nicht weichen kann, daß das Amt, wozu ich vor anderthalb Jahren so ehrenvoll berufen wurde, nicht mehr dasselbe ist, daß es durch die neuen Einrichtungen seine wesentlichsten Vorrechte, seine Annehmlichkeit und seine Würde verloren hat. <br>Sie erlassen mir wohl den Beweis, sonst bin ich erbötig, ihn nachdrücklich zu führen. <br>Aber Sie sagen mir, die notwendig befundenen Vorkehrungsmaßregeln seien nicht gegen Gelehrte von meinem Charakter gemeint. Es ist wahr, ich habe nie den Ehrgeiz gehabt, eine politische Rolle zu spielen, weder als Schriftsteller, noch auf andere Art: sonst hätte ich nicht so manche günstige Gelegenheit vorbeigehen lassen. Ein einziges Mal habe ich meinen Namen eingezeichnet, das war in der allgemeinen Sache des Vaterlandes, in dem europäischen Kampfe für die Selbständigkeit der Staaten. Ich bin es seit langen Jahren gewohnt, in der Mitte politischer Gärungen als ruhiger Zuschauer zu stehen, nur eine mäßigende und vermittelnde Stimme hören zu lassen und mit Menschen von allen Parteien in freundlichem Verhältnisse zu bleiben. Noch am Tage meiner Abreise [8] von Paris <span class="doc-4754 ">schrieb mir </span><span class="doc-4754 index-631 tp-99202 ">Herr von Chateaubriand</span>, ich sei dazu berufen, die Geschichte Frankreichs im Mittelalter zu schreiben. Allein das in Deutschland erwachte Mißtrauen gegen die Gelehrten und Schriftsteller überhaupt liegt am Tage; und ein solches Mißtrauen ist nicht wie eine gewöhnliche Flamme, welche erlischt, wenn der Nahrungsstoff erschöpft ist: es phosphoresziert nur um so heller in luftleerem Raume. Wenn der Verdacht sich auf Meinungen, auch auf nicht ausgesprochene, richtet, kann ich sicher sein, daß die Meinungen des Verfassers <span class="index-3369 tp-99203 ">der Schrift „</span><span class="index-3369 tp-99203 weight-bold ">Sur le système continental</span><span class="index-3369 tp-99203 ">“</span> und <span class="index-11635 tp-99204 ">einiger anderer politischer Schriften</span> im Jahre 1813, des vieljährigen Freundes <span class="index-222 tp-99206 ">der Frau von Staël</span>, des Mitherausgebers <span class="index-2409 tp-99208 ">ihres nachgelassenen Werkes</span> (ich will Sie geflissentlich an alles erinnern), immer unverdächtig scheinen werden? <br>Mit dem besten Willen kam ich nach Deutschland. Meine Freunde in Frankreich ließen mich ungern von sich und würden mich mit offenen Armen wieder aufnehmen. Sie wissen, daß ich dort sehr angenehme Verhältnisse habe, und wenn ich bloß meine Neigung befragt hätte, so wäre ich wohl immer da geblieben. Aber es schien mir vielleicht rühmlicher, gewiß verdienstlicher und berufsgemäßer, meine Kräfte zum Nutzen des Vaterlandes zu verwenden. Ich fand alles in scheinbar tiefer Ruhe. Plötzlich ist ein Ungewitter aufgezogen, aus einem Wölkchen, wie das war, welches der Prophet Elias am Horizont erblickte. Mein erster [9] Gedanke war, ein Obdach zu suchen. Glauben Sie mir, ich bilde mir nicht ein, zu irgend etwas notwendig zu sein: meine Entfernung vom öffentlichen Unterricht würde keine merkliche Lücke verursachen. Mein Fach gehört zu den entbehrlichen, für die nur dann Begünstigung zu hoffen ist, wenn bei vollkommen heiterer Stimmung auch an äußere Verzierung gedacht wird. Der Inhalt Ihres Briefes war mir daher etwas ganz Unerwartetes. <br>Sie bezeugen mir die unendlich ehrenvolle Hochschätzung <span class="index-553 tp-99209 ">des Fürsten Staatskanzlers</span>: ich bitte Sie, den Ausdruck meiner ehrerbietigsten Gesinnungen und meiner Dankbarkeit vor Se. Durchlaucht zu bringen. Wenn ich die schmeichelhafte Überzeugung hegen darf, daß der Staatskanzler, daß <span class="index-2403 tp-99210 ">der Minister von Altenstein</span>, dessen Briefe ich als kostbare Beweise der Anerkennung aufbewahre, auf die Fortsetzung meiner wissenschaftlichen Tätigkeit im Dienste des Staats einigen Wert legen, so wirft das freilich ein bedeutendes Gewicht in die andere Wagschale.<br>Lassen Sie uns also miteinander überlegen, ob sich irgendein Ausweg finden läßt. Sie sagen mir, „die getroffenen Maßregeln werden mich auf keine Art unangenehm berühren, mein Leben und Wirken stehe da, vor jeder unfreundlichen Berührung geschützt, wie von einer Ägide, die kein Pfeil durchbohrt.“ Könnten Sie mir darüber eine amtliche Versicherung schaffen? Brief und Siegel? Das wäre ja gewissermaßen<br>[10] <span class="index-19749 tp-99212 ">„Ein eisern Privilegium,<br>Zu hexen frank und frei herum.“</span><br>Aber im Ernst, kann irgendein Einzelner billigerweise verlangen, daß zu seinen Gunsten eine Ausnahme gemacht werde von einer allgemeinen Maßregel, die so viele würdige Männer trifft? Sonst standen zwischen den Professoren und dem Ministerium nur die Kuratoren, Männer von erlauchter Geburt und in hohen Staatsämtern, deren Namen schon den Universitäten zur Zierde gereichte; und ihre Wirksamkeit war durchaus nicht hemmend, sondern eine fördernde und aufmunternde Fürsorge. Von spezieller Aufsicht war gar nicht die Rede; sie schien um so weniger nötig, da die Grundsätze der Lehrer vor ihrer Anstellung meist durch ihre Schriften bekannt waren. In dem unerhörten Fall, daß ein Lehrer sein Amt zu übeln Zwecken gemißbraucht hätte, kam es zunächst dem akademischen Senate zu, für die Ehre und Unbescholtenheit der Universität zu sorgen. Jetzt sind Aufseher in der Nähe hingestellt mit einer unbedingten und bisher beispiellosen Vollmacht. Wie ist einem solchen Verhältnis auszuweichen? Ich sehe nur ein einziges Mittel. Die Maßregel ist nur als transitorisch, das Verhältnis der Universitäten zu den Kuratoren nur als suspendiert angekündigt worden. Es käme also darauf an, einen speziellen wissenschaftlichen Auftrag auszumitteln, dessen Ausführung mich während [11] dieser Zeit hinlänglich beschäftigte, auch wenn ich einstweilen der gewöhnlichen Geschäfte eines akademischen Lehrers überhoben würde.<br>Einen solchen Auftrag wüßte ich wohl. Sogleich bei meiner Rückkehr in Deutschland habe ich mein Augenmerk darauf gerichtet; aber ich hegte nicht mehr die Hoffnung, jetzt, da die Bewegungen des Augenblicks die Gemüter ganz in Anspruch nehmen, Begünstigung dafür zu finden. Sie erregen diese Hoffnung von neuem, indem Sie mir sagen, der preußische Staat werde auch jetzt fortfahren, väterlich und liberaler als jeder andre für das Gedeihen der Wissenschaft und Kunst zu sorgen.<br>Mein Wunsch wäre nämlich, das Studium des Sanskrit und der indischen Literatur überhaupt in Deutschland auf eine gründliche Art einheimisch zu machen. Das große gelehrte Interesse der Sache brauche ich Ihnen nicht auseinanderzusetzen: Sie sind im Besitz aller darauf bezüglichen Ideen. Ich lege <span class="index-2555 tp-99233 ">einen Aufsatz</span> bei, wodurch ich die Gönner der Wissenschaften in Berlin aufmerksam zu machen gesucht habe, er ist <span class="index-3471 tp-99232 ">den Bonnischen Jahrbüchern</span> eingerückt worden.<br>Noch will ich erinnern, daß nicht nur in Paris ein eigner Lehrstuhl für das Sanskrit errichtet ist, sondern daß ein deutscher Gelehrter, <span class="index-2426 tp-99214 ">Fr. Bopp</span>, mit Unterstützung <span class="index-11752 tp-99218 ">der bayerischen Regierung</span>, und, auf meine Empfehlung, insbesondere <span class="index-634 tp-99217 ">des Kronprinzen von Bayern</span>, seit einer Anzahl von Jahren in Paris, jetzt in <span class="index-292 tp-99215 ">London</span>, einzig zu diesem Zwecke studiert und das Versprechen [12] einer Professur in <span class="index-230 tp-99216 ">Würzburg</span> erhalten hat. Er hat jetzt einen indischen Text in London sehr lobenswert herausgegeben, worüber ich nächstens eine Beurteilung drucken lassen werde. In Göttingen ist noch nichts geschehen, doch steht es über kurz oder lang zu erwarten, da die Verhältnisse mit England es dort besonders erleichtern.<br>Wenn man also, wie billig, bei keiner Erweiterung der Wissenschaft zurückbleiben will, so wäre es nötig, auf irgendeiner der preußischen Universitäten etwas für das Studium der indischen Literatur zu tun. Ich glaube, es würde für Bonn keine gleichgültige Auszeichnung sein, wenn man hier die Hilfsmittel des Sanskrit, die ich schon großenteils besitze, beisammen fände; wenn man in der Folge auch Elementarbücher und indische Texte drucken könnte. Die Lage ist besonders günstig wegen der Nähe von London und Paris, wo allein indische Manuskripte sind. Einige außerordentliche Unterstützung wäre erforderlich, aber sie würde nicht unerschwinglich sein, keineswegs außer Verhältnis mit dem, was das hohe Ministerium für andre auch nicht ganz notwendige Studien so freigebig bewilligt hat.<br>Diesen Lieblingsplan hatte ich nun schon völlig aufgegeben, als ich vor sechs Wochen nach Berlin schrieb. Ich überlasse es Ihnen, mein teuerster Freund, ob Sie den Versuch wagen wollen, der Sache Eingang zu verschaffen. Auf erhaltenen Befehl würde ich sogleich <span class="index-2403 tp-99236 ">dem Minister [13] des öffentlichen Unterrichts</span> einen ins einzelne gehenden Plan vorlegen.<br>Ich weiß wohl, daß die Ausführung mir eine Menge mühseliger und trockener Arbeiten auferlegen und daß ich einige Jahre hindurch alle Hände voll zu tun haben würde, statt daß ich, bei individueller Fortsetzung des Studiums, nur die Blüte davon pflücken und sie zu welthistorischen, philosophischen, dichterischen Zwecken benutzen könnte. Aber die Liebe zur Sache würde mir die Schwierigkeiten überwinden helfen. <br>Ich hoffe, Sie werden in diesen Äußerungen die Bereitwilligkeit erkennen, den Eröffnungen, die Sie mir von seiten eines erlauchten Gönners gemacht haben, entgegenzukommen. Eine Reise nach Berlin halte ich in dem gegenwärtigen Augenblick durchaus nicht für zweckmäßig.<br>Leben Sie recht wohl, mein teurer Freund, und erfreuen Sie mich bald mit einer Antwort. Denn nach dem getanen Schritte bin ich in der Lage jenes alten Ritters in einer spanischen Romanze:<br>„Schon den einen Fuß im Bügel.“<br>Und um einen neuen Lebensplan auszuführen, müssen doch mancherlei Anstalten getroffen werden.<br>[14]<br>[15]<br>[16]', 'isaprint' => true, 'isnewtranslation' => false, 'statemsg' => 'betamsg13', 'cittitle' => '', 'description' => 'August Wilhelm von Schlegel an Johann Ferdinand Koreff am 19.01.1820, Bonn', 'adressatort' => 'Unknown', 'absendeort' => 'Bonn <a class="gndmetadata" target="_blank" href="http://d-nb.info/gnd/1001909-1">GND</a>', 'date' => '19.01.1820', 'adressat' => array( (int) 3113 => array( 'ID' => '3113', 'project' => '1', 'timecreate' => '2013-11-05 16:09:39', 'timelastchg' => '2017-12-20 18:27:53', 'key' => 'AWS-ap-00bu', 'docTyp' => array( [maximum depth reached] ), '39_gebdatum' => '1783-02-01', '39_toddatum' => '1851-05-15', '39_name' => 'Koreff, Johann Ferdinand', '39_geschlecht' => 'm', '39_lebenwirken' => 'Geheimrat, Arzt, Schriftsteller Johann Ferdinand Korreff absolvierte ein Studium der Medizin in Halle und Berlin. 1803 kam Korreff zur klinischen Ausbildung nach Berlin, wo er bald Anschluss an den frühromantischen Kreis um Karl August Varnhagen von Ense fand. Anschließend war er als niedergelassener Arzt in Paris tätig, bis er 1811 Marquise Delphine de Custine als deren Leibarzt auf ihren Reisen nach Italien und in die Schweiz begleitete. Dort lernte er Karl August von Hardenberg kennen, als dessen Leibarzt er nach Berlin kam. 1816 wurde er dort Professor der Medizin und Chirurgie an der Berliner Universität und zwei Jahre später zum Regierungsrat ernannt. Korreff befasste sich mit der Theorie des Magnetismus. Als Mitglied der Akademie der Naturforschung Leopoldina veröffentlichte er neben naturphilosophischen auch literarische Schriften. Seine jüdische Herkunft und die Tatsache, dass er in der Gunst des Kanzlers Hardenberg stand, ließen ihn zum Opfer einer Intrige werden. Er ging nach Paris, wo er insbesondere die Rezeption der Werke E.T.A. Hoffmanns anstieß und sich erneut als Arzt zu etablieren versuchte.', '39_dbid' => '118777831 ', '39_pdb' => 'GND', '39_geburtsort' => array( [maximum depth reached] ), '39_sterbeort' => array( [maximum depth reached] ), '39_quellen' => 'NDB@https://www.deutsche-biographie.de/gnd118777831.html#ndbcontent@ WBIS@http://db.saur.de/WBIS/basicSearch.jsf@D437-122-X@ extern@Roger Paulin: August Wilhelm Schlegel. Cosmopolitan of Art and Poetry. Cambridge 2016, S. 581.@ Wikipedia@https://de.wikipedia.org/wiki/David_Ferdinand_Koreff@', '39_beziehung' => 'Koreff behandelte August Wilhelm Schlegel als Arzt. Später beförderte er maßgeblich die Gründung der Bonner Universität und setzte sich persönlich für die Berufung Schlegels ein.', '39_namevar' => 'Koreff, Johann David Ferdinand Koreff, David Johann Koreff, David Ferdinand (M) Koreff, David Koreff, F.', '39_status_person' => 'Vollständig', '39_sourcename0' => 'AWS-ap-00bu-0.jpg', 'folders' => array( [maximum depth reached] ), '_label' => '', '_descr' => '', '_model' => 'Person', '_model_title' => 'Person', '_model_titles' => 'People', '_url' => '' ) ), 'adrCitation' => 'Johann Ferdinand Koreff', 'absender' => array(), 'absCitation' => 'August Wilhelm von Schlegel', 'percount' => (int) 1, 'notabs' => false, 'tabs' => array( 'text' => array( 'content' => 'Volltext Handschrift', 'exists' => '1' ), 'manuscript' => array( 'exists' => '1', 'content' => 'Digitalisat Handschrift' ), 'related' => array( 'data' => array( [maximum depth reached] ), 'exists' => '1', 'content' => 'Zugehörige Dokumente' ) ), 'parallelview' => array( (int) 0 => '1', (int) 1 => '1', (int) 2 => '1' ), 'dzi_imagesHand' => array( (int) 0 => '/cake_fud/files/temp/images/dzi/b5b763a2cd8dcda28a9301bc32bf5b06.jpg.xml', (int) 1 => '/cake_fud/files/temp/images/dzi/a57d539f54870867fc4efd8a20bccea9.jpg.xml', (int) 2 => '/cake_fud/files/temp/images/dzi/c97e2b58fdbda94bc0df5159b94edd33.jpg.xml', (int) 3 => '/cake_fud/files/temp/images/dzi/c5bdd4a915da1ee380931aeb4848ddef.jpg.xml', (int) 4 => '/cake_fud/files/temp/images/dzi/8f25e541d1045f425a282d928f86ba92.jpg.xml', (int) 5 => '/cake_fud/files/temp/images/dzi/86e9174dee01b392cb5205b0059c828e.jpg.xml', (int) 6 => '/cake_fud/files/temp/images/dzi/5d1247ba92f742214fe91bfa26b63cdd.jpg.xml', (int) 7 => '/cake_fud/files/temp/images/dzi/ac3357b5a7129617dca211071626d3ce.jpg.xml', (int) 8 => '/cake_fud/files/temp/images/dzi/0efd948a1d65e91f390490c0be2a3fa4.jpg.xml', (int) 9 => '/cake_fud/files/temp/images/dzi/1c1e2b7e45904bb0a071b4c6895a7c32.jpg.xml', (int) 10 => '/cake_fud/files/temp/images/dzi/4c7fbb3568f0415a0fbcd0be23a9cf0e.jpg.xml', (int) 11 => '/cake_fud/files/temp/images/dzi/c20ffe87f86372becd87d88dbc89a1a7.jpg.xml', (int) 12 => '/cake_fud/files/temp/images/dzi/bb91f61e61b1aaa719b5ad5385958c4d.jpg.xml', (int) 13 => '/cake_fud/files/temp/images/dzi/a414f3897afba53a995cb160e3411284.jpg.xml', (int) 14 => '/cake_fud/files/temp/images/dzi/f40028f1906e530ba66c753826864d51.jpg.xml', (int) 15 => '/cake_fud/files/temp/images/dzi/76fc9363be063aad87c6ebd7da78948b.jpg.xml' ), 'dzi_imagesDruck' => array(), 'indexesintext' => array( 'Namen' => array( (int) 0 => array( [maximum depth reached] ), (int) 1 => array( [maximum depth reached] ), (int) 2 => array( [maximum depth reached] ), (int) 3 => array( [maximum depth reached] ), (int) 4 => array( [maximum depth reached] ), (int) 5 => array( [maximum depth reached] ), (int) 6 => array( [maximum depth reached] ), (int) 7 => array( [maximum depth reached] ), (int) 8 => array( [maximum depth reached] ), (int) 9 => array( [maximum depth reached] ), (int) 10 => array( [maximum depth reached] ), (int) 11 => array( [maximum depth reached] ), (int) 12 => array( [maximum depth reached] ), (int) 13 => array( [maximum depth reached] ), (int) 14 => array( [maximum depth reached] ), (int) 15 => array( [maximum depth reached] ), (int) 16 => array( [maximum depth reached] ) ), 'Körperschaften' => array( (int) 0 => array( [maximum depth reached] ), (int) 1 => array( [maximum depth reached] ), (int) 2 => array( [maximum depth reached] ), (int) 3 => array( [maximum depth reached] ), (int) 4 => array( [maximum depth reached] ) ), 'Orte' => array( (int) 0 => array( [maximum depth reached] ), (int) 1 => array( [maximum depth reached] ), (int) 2 => array( [maximum depth reached] ), (int) 3 => array( [maximum depth reached] ), (int) 4 => array( [maximum depth reached] ), (int) 5 => array( [maximum depth reached] ), (int) 6 => array( [maximum depth reached] ), (int) 7 => array( [maximum depth reached] ) ), 'Werke' => array( (int) 0 => array( [maximum depth reached] ), (int) 1 => array( [maximum depth reached] ), (int) 2 => array( [maximum depth reached] ), (int) 3 => array( [maximum depth reached] ), (int) 4 => array( [maximum depth reached] ), (int) 5 => array( [maximum depth reached] ), (int) 6 => array( [maximum depth reached] ), (int) 7 => array( [maximum depth reached] ), (int) 8 => array( [maximum depth reached] ), (int) 9 => array( [maximum depth reached] ), (int) 10 => array( [maximum depth reached] ), (int) 11 => array( [maximum depth reached] ), (int) 12 => array( [maximum depth reached] ), (int) 13 => array( [maximum depth reached] ), (int) 14 => array( [maximum depth reached] ) ), 'Periodika' => array( (int) 0 => array( [maximum depth reached] ) ) ), 'right' => '', 'left' => 'manuscript', 'handschrift' => array( 'Datengeber' => 'Dresden, Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitätsbibliothek', 'OAI Id' => 'DE-1a-33958', 'Signatur' => 'Mscr.Dresd.e.90,XIX,Bd.13,Nr.45', 'Blatt-/Seitenzahl' => '13 S. auf Doppelbl., hs. m. U.', 'Format' => '18,4 x 12,1 cm' ), 'druck' => array( 'Bibliographische Angabe' => 'Oppeln-Bronikowski, Friedrich von: David Ferdinand Koreff. Berlin u.a. 1928, S. 330‒339.', 'Verlag' => 'Gebrüder Paetel', 'Incipit' => '„[1] [Bonn,] 19. Januar 1820.<br>Ihren Brief vom 8. Januar erhielt ich vor einigen Tagen, mein teurer und hochverehrter Freund, und eile [...]“' ), 'docmain' => array( 'ID' => '3494', 'project' => '1', 'timecreate' => '2013-12-18 13:48:43', 'timelastchg' => '2020-01-30 16:38:39', 'key' => 'AWS-aw-02av', 'docTyp' => array( 'name' => 'Brief', 'id' => '36' ), 'index_orte_10' => array( (int) 0 => array( [maximum depth reached] ), (int) 1 => array( [maximum depth reached] ), (int) 2 => array( [maximum depth reached] ), (int) 3 => array( [maximum depth reached] ), (int) 4 => array( [maximum depth reached] ), (int) 5 => array( [maximum depth reached] ), (int) 6 => array( [maximum depth reached] ), (int) 7 => array( [maximum depth reached] ) ), 'index_koerperschaften_15' => array( (int) 0 => array( [maximum depth reached] ), (int) 1 => array( [maximum depth reached] ), (int) 2 => array( [maximum depth reached] ), (int) 3 => array( [maximum depth reached] ), (int) 4 => array( [maximum depth reached] ) ), 'index_personen_11' => array( (int) 0 => array( [maximum depth reached] ), (int) 1 => array( [maximum depth reached] ), (int) 2 => array( [maximum depth reached] ), (int) 3 => array( [maximum depth reached] ), (int) 4 => array( [maximum depth reached] ), (int) 5 => array( [maximum depth reached] ), (int) 6 => array( [maximum depth reached] ), (int) 7 => array( [maximum depth reached] ), (int) 8 => array( [maximum depth reached] ), (int) 9 => array( [maximum depth reached] ), (int) 10 => array( [maximum depth reached] ), (int) 11 => array( [maximum depth reached] ), (int) 12 => array( [maximum depth reached] ), (int) 13 => array( [maximum depth reached] ), (int) 14 => array( [maximum depth reached] ), (int) 15 => array( [maximum depth reached] ), (int) 16 => array( [maximum depth reached] ) ), 'index_werke_12' => array( (int) 0 => array( [maximum depth reached] ), (int) 1 => array( [maximum depth reached] ), (int) 2 => array( [maximum depth reached] ), (int) 3 => array( [maximum depth reached] ), (int) 4 => array( [maximum depth reached] ), (int) 5 => array( [maximum depth reached] ), (int) 6 => array( [maximum depth reached] ), (int) 7 => array( [maximum depth reached] ), (int) 8 => array( [maximum depth reached] ), (int) 9 => array( [maximum depth reached] ), (int) 10 => array( [maximum depth reached] ), (int) 11 => array( [maximum depth reached] ), (int) 12 => array( [maximum depth reached] ), (int) 13 => array( [maximum depth reached] ), (int) 14 => array( [maximum depth reached] ) ), 'index_periodika_13' => array( (int) 0 => array( [maximum depth reached] ) ), '36_html' => '[1] [<span class="index-887 tp-99166 ">Bonn</span>,] 19. Januar 1820.<br><span class="doc-3500 ">Ihren Brief vom 8. Januar</span> erhielt ich vor einigen Tagen, mein teurer und hochverehrter Freund, und eile zuvörderst, Ihren freundschaftlichen Vorwürfen zu begegnen. Meine Gesinnungen gegen Sie können sich nie ändern. Ich werde Ihnen zeitlebens dankbar sein für die freundschaftliche Wärme, womit Sie zu meiner Hilfe herbeigeeilt sind, als ich in <span class="index-898 tp-99167 ">Auxerre</span> krank lag: <span class="cite tp-54866 ">ich erzähle es gern, daß Sie mich damals den Klauen ungeschickter Ärzte, oder was einerlei ist, dem Tode entrissen haben</span>. Aber ich fand nicht bloß eine Befriedigung des Herzens in Ihrem Wohlwollen, Ihr Umgang gewährte mir den lebhaftesten Genuß, und die Tage, die ich mit Ihnen in <span class="index-171 tp-99168 ">Paris</span>, auf dem Lande, in der Schweiz, oder wo es sein mochte, zugebracht, gehören zu meinen angenehmsten Erinnerungen.<br>Immer freute ich mich, in Ihnen den witzigen Gesellschafter, den geistreichen Beobachter der Welt, den ideenreichen Forscher wiederzufinden und meinen Geist durch Ihre Mitteilungen anzuregen. Als ich im Jahre 1817 <span class="index-222 tp-99170 ">einen unersetzlichen Verlust</span> erlitten hatte, als die Auflösung eines Verhältnisses ohnegleichen durch den Tod mir eine unerwünschte Freiheit wiedergab, habe ich in Ihren Einladungen zur Rückkehr nach Deutschland aufs neue Ihren freundschaftlichen Eifer erkannt. Bei unserem Zusammentreffen in <span class="index-1591 tp-99169 ">Koblenz</span> und in Bonn glaubte ich von Ihrer Seite einige Zurückhaltung [2] zu bemerken und vermied es, diese Grenze zu durchbrechen. Seitdem ist, soviel ich weiß, keine Botschaft von Ihnen zu mir gelangt, sonst wäre sie nicht unerwidert geblieben. Sie kennen meine alte Nachlässigkeit im Briefschreiben: es ist ein Familienfehler, den sogar <span class="index-8 tp-99171 ">mein Bruder</span> mir zugute halten muß, so wie ich ihm. Überdies, was hätte ich Ihnen, der Sie in mannigfaltigen und bedeutenden Weltverhältnissen leben, aus meiner wissenschaftlichen Eingezogenheit Unterhaltendes melden können? Dazu kam, daß ich seit meiner Ankunft in Bonn sehr häufig verstimmt war, und zwar durch einen Verdruß der Art, wovon man nicht gern redet. Dies führt mich auf die Verleumdungen, deren Sie erwähnen. Sie können, mein teurer Freund, keine sehr schweren Kämpfe zu bestehen gehabt haben, denn die lügenhafte Abgeschmacktheit dieser Verleumdungen mußte jedem Unbefangenen in die Augen springen. Vergebens habe ich <span class="index-243 tp-99173 index-186 tp-99172 index-2402 tp-99174 ">die Urheber</span> durch die geringschätzigste Zurückweisung ihrer Zumutungen aufgefordert, ans Licht hervorzutreten, um mir alsdann volle Genugtuung zu schaffen. Sie haben sich wohl davor gehütet. Sie hatten mit bleiernen Pfeilen auf eine stählerne Rüstung geschossen. Das flüchtige Aufsehen ist längst in tiefe Vergessenheit begraben, ich genieße aus der Ferne und Nähe der gewohnten Achtung. Übrigens waren in Berlin zwei verehrte Freunde von mir, <span class="index-2429 tp-99175 ">der General v. Müffling</span> und <span class="index-276 tp-99176 ">der Staatsrat Hufeland</span>, näher von der Sache unterrichtet und werden [3] wohl gelegentlich das Nötige gesagt haben. Wenn es Sie interessieren kann, will ich Sie ein andermal davon unterhalten: mir ist es nun schon gleichgültig geworden, aber es bleibt immer eine seltsam merkwürdige Geschichte.<br>Sie sehen, daß ich das Bedürfnis habe, zu Ihnen im vollen Vertrauen der Freundschaft zu reden. Aber kommen wir nach dieser schon allzu langen Vorrede auf die Hauptsache. Auch hier muß ich zuvörderst einige irrige Annahmen aus dem Wege räumen, die ich in Ihrem Briefe bemerke.<br>Ich gebe Ihnen mein Ehrenwort, daß ich den getanen Schritt mit niemandem verabredet, noch viel weniger mich dazu verbindlich gemacht [habe]. Der Entschluß ist ganz aus mir selbst hervorgegangen. Sollte in einer Stelle Ihres Briefes, was ich kaum glauben kann, <span class="index-2323 tp-99177 ">unser allgemein geliebter und verehrter, leider ehemaliger Kurator</span> gemeint sein, so kann ich versichern, daß er, wiewohl es ihn geschmerzt hat, sich für jetzt von <span class="index-6155 tp-99178 ">der Universität</span> zu trennen, den aufrichtigsten Anteil an ihrem fortwährenden Gedeihen nimmt, und daß er, in der Voraussetzung, ich könnte im Sinne haben, mich von dem Lehramte zurückzuziehen, mir die dringendsten Gründe entgegengestellt hat. Ich habe die Sache ganz als meine Privatangelegenheit behandelt, ich habe mich nur wenigen Freunden im engsten Vertrauen [4] eröffnet, ich habe fortgefahren, <span class="index-2452 tp-99223 index-3452 tp-99220 index-4972 tp-99224 index-2435 tp-99221 index-3730 tp-99225 index-4965 tp-99226 index-3511 tp-99227 index-2475 tp-99228 ">meine Vorlesungen</span> mit dem gewohnten Fleiße zu geben, und das hiesige Publikum hat erst aus dem Berlinischen Zeitungsartikel etwas erfahren. Aber auch jetzt weiche ich den deshalb an mich geschehenden Anfragen durch unbestimmte Äußerungen aus. <br>Ferner muß ich erklären, daß der Aufenthalt in Bonn mir keineswegs mißfällt, sondern daß ich vielmehr eine große Neigung dazu gefaßt habe. Die heitere Gegend, das milde Klima, die bequeme Lage zu kleinen und großen Reisen, das freundschaftliche Verhältnis mit meinen Amtsgenossen, die gesellige Ungezwungenheit, selbst Beschränktheit einer kleinen Stadt sagten mir zu. Dazu kommt nun, daß ich meine gelehrten Vorräte nicht ohne Mühe und Kosten um mich her versammelt und mich angenehm eingerichtet habe. Ich hatte es recht eigentlich darauf angelegt, in meinem Hause einen literarischen Zirkel zu bilden. Ich hege keine Abneigung gegen <span class="index-15 tp-99179 ">Berlin</span>, das ich ja von alter Zeit kenne. Nur scheute ich das rauhere Klima und die weite Entfernung von meinen Freunden in Frankreich. Auch glaubte ich den geselligen Anforderungen dort nicht ausweichen zu können, und meine Gesundheit sowohl als meine weit aussehenden Forschungen fordern eine von den Zerstreuungen der großen Welt ungestörte Ruhe. <br>[5] Ich habe ja selbst um die Verlängerung meines hiesigen Aufenthalts bis zum nächsten Herbst angehalten, und <span class="index-5440 tp-99180 ">das Ministerium</span> hat die Gnade gehabt, mein Gesuch zu bewilligen. Ich hoffte in der Folge, vielleicht mit dem Vorbehalt, eine Reihe von Vorlesungen in Berlin zu geben, meine definitive Bestimmung für Bonn auszuwirken. Hier fand ich eine besonders erfreuliche Sphäre gelehrter Tätigkeit, wo man die Früchte seines Fleißes gleichsam vor seinen Augen wachsen und reifen sehen konnte. Es war ein herrlicher Gedanke, hier am Rheine gründliche deutsche Bildung und Liebe dazu zu verbreiten. Sie haben recht, teuerster Freund, <span class="index-12214 tp-99181 ">die kgl. preußische Regierung</span> hat unendlich viel für Kunst und Wissenschaft getan, und die Stiftung von Bonn war ein echt vaterländisches Ereignis. Die Wahl des Ortes war die glücklichste: die königliche Freigebigkeit <span class="index-515 tp-99182 ">des Monarchen</span>, die weise Sorgfalt des Ministeriums können nicht genug gepriesen werden. Ich war stolz darauf, Fremden, die mich besuchten, dem Grafen Montlosier, <span class="index-2321 tp-99183 ">dem Herzog von Richelieu</span>, <span class="index-1386 tp-99184 ">dem Grafen Reinhard</span>, den großen Umfang und die Vortrefflichkeit der neuen Anstalt darlegen zu können. Ich brachte sie zu dem Geständnis, daß es in Frankreich, wenigstens außer Paris, nichts Ähnliches gebe. Ich lege Ihnen einen Brief des Herzogs von Richelieu bei, den er mir kurz nach seinem Besuche schrieb. <br>Wenn viel für uns [6] geschehen war, so haben wir uns auch unsererseits wacker gerührt. Vierhundert Studierende, darunter eine große Anzahl schon gebildeter junger Männer aus allen Gegenden Deutschlands, im ersten Jahre nach der Stiftung: das ist in den Annalen der Universitäten unerhört. Ich gebe diesen Winter eine öffentliche Vorlesung vor zweihundert Zuhörern. ‒ Wenn es ungestört so fortgegangen wäre, so hätten wir in einigen Jahren an Frequenz und Ruhm auch im Auslande, mit <span class="index-6154 tp-99186 index-2 tp-99185 ">Göttingen</span> wetteifern mögen. <br>Freilich, es ist ein Großes, wenn der Staat Aufwand für wissenschaftliche Anstalten macht, den Gelehrten ihre Existenz reichlich sichert. Aber diese Wohltaten verlieren ihre Kraft, wenn nicht noch eine, die höchste hinzukommt: ehrenvolle Auszeichnungen, aufmunternde Beweise des Wohlwollens von seiten der Regierung. Der akademische Lehrer insbesondere kann das Zutrauen nicht entbehren. Und dieses Zutrauen haben wir nun durch eine unglückliche Konstellation verwirkt, ich weiß nicht wie; wenigstens scheinen mir die Anlässe in gar keinem Verhältnisse mit den Folgen zu stehen. Von einem großen Staatenverein ist das Anathema ausgesprochen worden. Der Widerhall davon ist durch Europa erschollen, und wir mögen nun bald in amerikanischen Zeitungsblättern lesen, daß wir, sämtlich oder großenteils, Verführer der Jugend sind. Doch ich will auf das, was die deutschen Universitäten im allgemeinen seit <span class="index-19747 tp-99200 index-3392 tp-99201 ">der Schrift</span> von <span class="index-2427 tp-99192 ">Stourdza</span> betroffen hat, nicht eingehen. Mein Brief würde zum Buche [7] werden, Sie würden meiner Ansicht Ihre Gründe entgegenstellen, und am Ende würde vielleicht keiner den anderen überzeugen. Ich beschränke mich auf meine eigene Angelegenheit. Zu dem getanen Schritte hat mich nichts anderes bewogen als die Überzeugung, wovon ich auch jetzt nicht weichen kann, daß das Amt, wozu ich vor anderthalb Jahren so ehrenvoll berufen wurde, nicht mehr dasselbe ist, daß es durch die neuen Einrichtungen seine wesentlichsten Vorrechte, seine Annehmlichkeit und seine Würde verloren hat. <br>Sie erlassen mir wohl den Beweis, sonst bin ich erbötig, ihn nachdrücklich zu führen. <br>Aber Sie sagen mir, die notwendig befundenen Vorkehrungsmaßregeln seien nicht gegen Gelehrte von meinem Charakter gemeint. Es ist wahr, ich habe nie den Ehrgeiz gehabt, eine politische Rolle zu spielen, weder als Schriftsteller, noch auf andere Art: sonst hätte ich nicht so manche günstige Gelegenheit vorbeigehen lassen. Ein einziges Mal habe ich meinen Namen eingezeichnet, das war in der allgemeinen Sache des Vaterlandes, in dem europäischen Kampfe für die Selbständigkeit der Staaten. Ich bin es seit langen Jahren gewohnt, in der Mitte politischer Gärungen als ruhiger Zuschauer zu stehen, nur eine mäßigende und vermittelnde Stimme hören zu lassen und mit Menschen von allen Parteien in freundlichem Verhältnisse zu bleiben. Noch am Tage meiner Abreise [8] von Paris <span class="doc-4754 ">schrieb mir </span><span class="doc-4754 index-631 tp-99202 ">Herr von Chateaubriand</span>, ich sei dazu berufen, die Geschichte Frankreichs im Mittelalter zu schreiben. Allein das in Deutschland erwachte Mißtrauen gegen die Gelehrten und Schriftsteller überhaupt liegt am Tage; und ein solches Mißtrauen ist nicht wie eine gewöhnliche Flamme, welche erlischt, wenn der Nahrungsstoff erschöpft ist: es phosphoresziert nur um so heller in luftleerem Raume. Wenn der Verdacht sich auf Meinungen, auch auf nicht ausgesprochene, richtet, kann ich sicher sein, daß die Meinungen des Verfassers <span class="index-3369 tp-99203 ">der Schrift „</span><span class="index-3369 tp-99203 weight-bold ">Sur le système continental</span><span class="index-3369 tp-99203 ">“</span> und <span class="index-11635 tp-99204 ">einiger anderer politischer Schriften</span> im Jahre 1813, des vieljährigen Freundes <span class="index-222 tp-99206 ">der Frau von Staël</span>, des Mitherausgebers <span class="index-2409 tp-99208 ">ihres nachgelassenen Werkes</span> (ich will Sie geflissentlich an alles erinnern), immer unverdächtig scheinen werden? <br>Mit dem besten Willen kam ich nach Deutschland. Meine Freunde in Frankreich ließen mich ungern von sich und würden mich mit offenen Armen wieder aufnehmen. Sie wissen, daß ich dort sehr angenehme Verhältnisse habe, und wenn ich bloß meine Neigung befragt hätte, so wäre ich wohl immer da geblieben. Aber es schien mir vielleicht rühmlicher, gewiß verdienstlicher und berufsgemäßer, meine Kräfte zum Nutzen des Vaterlandes zu verwenden. Ich fand alles in scheinbar tiefer Ruhe. Plötzlich ist ein Ungewitter aufgezogen, aus einem Wölkchen, wie das war, welches der Prophet Elias am Horizont erblickte. Mein erster [9] Gedanke war, ein Obdach zu suchen. Glauben Sie mir, ich bilde mir nicht ein, zu irgend etwas notwendig zu sein: meine Entfernung vom öffentlichen Unterricht würde keine merkliche Lücke verursachen. Mein Fach gehört zu den entbehrlichen, für die nur dann Begünstigung zu hoffen ist, wenn bei vollkommen heiterer Stimmung auch an äußere Verzierung gedacht wird. Der Inhalt Ihres Briefes war mir daher etwas ganz Unerwartetes. <br>Sie bezeugen mir die unendlich ehrenvolle Hochschätzung <span class="index-553 tp-99209 ">des Fürsten Staatskanzlers</span>: ich bitte Sie, den Ausdruck meiner ehrerbietigsten Gesinnungen und meiner Dankbarkeit vor Se. Durchlaucht zu bringen. Wenn ich die schmeichelhafte Überzeugung hegen darf, daß der Staatskanzler, daß <span class="index-2403 tp-99210 ">der Minister von Altenstein</span>, dessen Briefe ich als kostbare Beweise der Anerkennung aufbewahre, auf die Fortsetzung meiner wissenschaftlichen Tätigkeit im Dienste des Staats einigen Wert legen, so wirft das freilich ein bedeutendes Gewicht in die andere Wagschale.<br>Lassen Sie uns also miteinander überlegen, ob sich irgendein Ausweg finden läßt. Sie sagen mir, „die getroffenen Maßregeln werden mich auf keine Art unangenehm berühren, mein Leben und Wirken stehe da, vor jeder unfreundlichen Berührung geschützt, wie von einer Ägide, die kein Pfeil durchbohrt.“ Könnten Sie mir darüber eine amtliche Versicherung schaffen? Brief und Siegel? Das wäre ja gewissermaßen<br>[10] <span class="index-19749 tp-99212 ">„Ein eisern Privilegium,<br>Zu hexen frank und frei herum.“</span><br>Aber im Ernst, kann irgendein Einzelner billigerweise verlangen, daß zu seinen Gunsten eine Ausnahme gemacht werde von einer allgemeinen Maßregel, die so viele würdige Männer trifft? Sonst standen zwischen den Professoren und dem Ministerium nur die Kuratoren, Männer von erlauchter Geburt und in hohen Staatsämtern, deren Namen schon den Universitäten zur Zierde gereichte; und ihre Wirksamkeit war durchaus nicht hemmend, sondern eine fördernde und aufmunternde Fürsorge. Von spezieller Aufsicht war gar nicht die Rede; sie schien um so weniger nötig, da die Grundsätze der Lehrer vor ihrer Anstellung meist durch ihre Schriften bekannt waren. In dem unerhörten Fall, daß ein Lehrer sein Amt zu übeln Zwecken gemißbraucht hätte, kam es zunächst dem akademischen Senate zu, für die Ehre und Unbescholtenheit der Universität zu sorgen. Jetzt sind Aufseher in der Nähe hingestellt mit einer unbedingten und bisher beispiellosen Vollmacht. Wie ist einem solchen Verhältnis auszuweichen? Ich sehe nur ein einziges Mittel. Die Maßregel ist nur als transitorisch, das Verhältnis der Universitäten zu den Kuratoren nur als suspendiert angekündigt worden. Es käme also darauf an, einen speziellen wissenschaftlichen Auftrag auszumitteln, dessen Ausführung mich während [11] dieser Zeit hinlänglich beschäftigte, auch wenn ich einstweilen der gewöhnlichen Geschäfte eines akademischen Lehrers überhoben würde.<br>Einen solchen Auftrag wüßte ich wohl. Sogleich bei meiner Rückkehr in Deutschland habe ich mein Augenmerk darauf gerichtet; aber ich hegte nicht mehr die Hoffnung, jetzt, da die Bewegungen des Augenblicks die Gemüter ganz in Anspruch nehmen, Begünstigung dafür zu finden. Sie erregen diese Hoffnung von neuem, indem Sie mir sagen, der preußische Staat werde auch jetzt fortfahren, väterlich und liberaler als jeder andre für das Gedeihen der Wissenschaft und Kunst zu sorgen.<br>Mein Wunsch wäre nämlich, das Studium des Sanskrit und der indischen Literatur überhaupt in Deutschland auf eine gründliche Art einheimisch zu machen. Das große gelehrte Interesse der Sache brauche ich Ihnen nicht auseinanderzusetzen: Sie sind im Besitz aller darauf bezüglichen Ideen. Ich lege <span class="index-2555 tp-99233 ">einen Aufsatz</span> bei, wodurch ich die Gönner der Wissenschaften in Berlin aufmerksam zu machen gesucht habe, er ist <span class="index-3471 tp-99232 ">den Bonnischen Jahrbüchern</span> eingerückt worden.<br>Noch will ich erinnern, daß nicht nur in Paris ein eigner Lehrstuhl für das Sanskrit errichtet ist, sondern daß ein deutscher Gelehrter, <span class="index-2426 tp-99214 ">Fr. Bopp</span>, mit Unterstützung <span class="index-11752 tp-99218 ">der bayerischen Regierung</span>, und, auf meine Empfehlung, insbesondere <span class="index-634 tp-99217 ">des Kronprinzen von Bayern</span>, seit einer Anzahl von Jahren in Paris, jetzt in <span class="index-292 tp-99215 ">London</span>, einzig zu diesem Zwecke studiert und das Versprechen [12] einer Professur in <span class="index-230 tp-99216 ">Würzburg</span> erhalten hat. Er hat jetzt einen indischen Text in London sehr lobenswert herausgegeben, worüber ich nächstens eine Beurteilung drucken lassen werde. In Göttingen ist noch nichts geschehen, doch steht es über kurz oder lang zu erwarten, da die Verhältnisse mit England es dort besonders erleichtern.<br>Wenn man also, wie billig, bei keiner Erweiterung der Wissenschaft zurückbleiben will, so wäre es nötig, auf irgendeiner der preußischen Universitäten etwas für das Studium der indischen Literatur zu tun. Ich glaube, es würde für Bonn keine gleichgültige Auszeichnung sein, wenn man hier die Hilfsmittel des Sanskrit, die ich schon großenteils besitze, beisammen fände; wenn man in der Folge auch Elementarbücher und indische Texte drucken könnte. Die Lage ist besonders günstig wegen der Nähe von London und Paris, wo allein indische Manuskripte sind. Einige außerordentliche Unterstützung wäre erforderlich, aber sie würde nicht unerschwinglich sein, keineswegs außer Verhältnis mit dem, was das hohe Ministerium für andre auch nicht ganz notwendige Studien so freigebig bewilligt hat.<br>Diesen Lieblingsplan hatte ich nun schon völlig aufgegeben, als ich vor sechs Wochen nach Berlin schrieb. Ich überlasse es Ihnen, mein teuerster Freund, ob Sie den Versuch wagen wollen, der Sache Eingang zu verschaffen. Auf erhaltenen Befehl würde ich sogleich <span class="index-2403 tp-99236 ">dem Minister [13] des öffentlichen Unterrichts</span> einen ins einzelne gehenden Plan vorlegen.<br>Ich weiß wohl, daß die Ausführung mir eine Menge mühseliger und trockener Arbeiten auferlegen und daß ich einige Jahre hindurch alle Hände voll zu tun haben würde, statt daß ich, bei individueller Fortsetzung des Studiums, nur die Blüte davon pflücken und sie zu welthistorischen, philosophischen, dichterischen Zwecken benutzen könnte. Aber die Liebe zur Sache würde mir die Schwierigkeiten überwinden helfen. <br>Ich hoffe, Sie werden in diesen Äußerungen die Bereitwilligkeit erkennen, den Eröffnungen, die Sie mir von seiten eines erlauchten Gönners gemacht haben, entgegenzukommen. Eine Reise nach Berlin halte ich in dem gegenwärtigen Augenblick durchaus nicht für zweckmäßig.<br>Leben Sie recht wohl, mein teurer Freund, und erfreuen Sie mich bald mit einer Antwort. Denn nach dem getanen Schritte bin ich in der Lage jenes alten Ritters in einer spanischen Romanze:<br>„Schon den einen Fuß im Bügel.“<br>Und um einen neuen Lebensplan auszuführen, müssen doch mancherlei Anstalten getroffen werden.<br>[14]<br>[15]<br>[16]', '36_xml' => '<p>[1] [<placeName key="887">Bonn</placeName>,] 19. Januar 1820.<lb/><ref target="fud://3500">Ihren Brief vom 8. Januar</ref> erhielt ich vor einigen Tagen, mein teurer und hochverehrter Freund, und eile zuvörderst, Ihren freundschaftlichen Vorwürfen zu begegnen. Meine Gesinnungen gegen Sie können sich nie ändern. Ich werde Ihnen zeitlebens dankbar sein für die freundschaftliche Wärme, womit Sie zu meiner Hilfe herbeigeeilt sind, als ich in <placeName key="898">Auxerre</placeName> krank lag: ich erzähle es gern, daß Sie mich damals den Klauen ungeschickter Ärzte, oder was einerlei ist, dem Tode entrissen haben. Aber ich fand nicht bloß eine Befriedigung des Herzens in Ihrem Wohlwollen, Ihr Umgang gewährte mir den lebhaftesten Genuß, und die Tage, die ich mit Ihnen in <placeName key="171">Paris</placeName>, auf dem Lande, in der Schweiz, oder wo es sein mochte, zugebracht, gehören zu meinen angenehmsten Erinnerungen.<lb/>Immer freute ich mich, in Ihnen den witzigen Gesellschafter, den geistreichen Beobachter der Welt, den ideenreichen Forscher wiederzufinden und meinen Geist durch Ihre Mitteilungen anzuregen. Als ich im Jahre 1817 <persName key="222">einen unersetzlichen Verlust</persName> erlitten hatte, als die Auflösung eines Verhältnisses ohnegleichen durch den Tod mir eine unerwünschte Freiheit wiedergab, habe ich in Ihren Einladungen zur Rückkehr nach Deutschland aufs neue Ihren freundschaftlichen Eifer erkannt. Bei unserem Zusammentreffen in <placeName key="1591">Koblenz</placeName> und in Bonn glaubte ich von Ihrer Seite einige Zurückhaltung [2] zu bemerken und vermied es, diese Grenze zu durchbrechen. Seitdem ist, soviel ich weiß, keine Botschaft von Ihnen zu mir gelangt, sonst wäre sie nicht unerwidert geblieben. Sie kennen meine alte Nachlässigkeit im Briefschreiben: es ist ein Familienfehler, den sogar <persName key="8">mein Bruder</persName> mir zugute halten muß, so wie ich ihm. Überdies, was hätte ich Ihnen, der Sie in mannigfaltigen und bedeutenden Weltverhältnissen leben, aus meiner wissenschaftlichen Eingezogenheit Unterhaltendes melden können? Dazu kam, daß ich seit meiner Ankunft in Bonn sehr häufig verstimmt war, und zwar durch einen Verdruß der Art, wovon man nicht gern redet. Dies führt mich auf die Verleumdungen, deren Sie erwähnen. Sie können, mein teurer Freund, keine sehr schweren Kämpfe zu bestehen gehabt haben, denn die lügenhafte Abgeschmacktheit dieser Verleumdungen mußte jedem Unbefangenen in die Augen springen. Vergebens habe ich <persName key="243"><persName key="186"><persName key="2402">die Urheber</persName></persName></persName> durch die geringschätzigste Zurückweisung ihrer Zumutungen aufgefordert, ans Licht hervorzutreten, um mir alsdann volle Genugtuung zu schaffen. Sie haben sich wohl davor gehütet. Sie hatten mit bleiernen Pfeilen auf eine stählerne Rüstung geschossen. Das flüchtige Aufsehen ist längst in tiefe Vergessenheit begraben, ich genieße aus der Ferne und Nähe der gewohnten Achtung. Übrigens waren in Berlin zwei verehrte Freunde von mir, <persName key="2429">der General v. Müffling</persName> und <persName key="276">der Staatsrat Hufeland</persName>, näher von der Sache unterrichtet und werden [3] wohl gelegentlich das Nötige gesagt haben. Wenn es Sie interessieren kann, will ich Sie ein andermal davon unterhalten: mir ist es nun schon gleichgültig geworden, aber es bleibt immer eine seltsam merkwürdige Geschichte.<lb/>Sie sehen, daß ich das Bedürfnis habe, zu Ihnen im vollen Vertrauen der Freundschaft zu reden. Aber kommen wir nach dieser schon allzu langen Vorrede auf die Hauptsache. Auch hier muß ich zuvörderst einige irrige Annahmen aus dem Wege räumen, die ich in Ihrem Briefe bemerke.<lb/>Ich gebe Ihnen mein Ehrenwort, daß ich den getanen Schritt mit niemandem verabredet, noch viel weniger mich dazu verbindlich gemacht [habe]. Der Entschluß ist ganz aus mir selbst hervorgegangen. Sollte in einer Stelle Ihres Briefes, was ich kaum glauben kann, <persName key="2323">unser allgemein geliebter und verehrter, leider ehemaliger Kurator</persName> gemeint sein, so kann ich versichern, daß er, wiewohl es ihn geschmerzt hat, sich für jetzt von <orgName key="6155">der Universität</orgName> zu trennen, den aufrichtigsten Anteil an ihrem fortwährenden Gedeihen nimmt, und daß er, in der Voraussetzung, ich könnte im Sinne haben, mich von dem Lehramte zurückzuziehen, mir die dringendsten Gründe entgegengestellt hat. Ich habe die Sache ganz als meine Privatangelegenheit behandelt, ich habe mich nur wenigen Freunden im engsten Vertrauen [4] eröffnet, ich habe fortgefahren, <name key="2452" type="work"><name key="3452" type="work"><name key="4972" type="work"><name key="2435" type="work"><name key="3730" type="work"><name key="4965" type="work"><name key="3511" type="work"><name key="2475" type="work">meine Vorlesungen</name></name></name></name></name></name></name></name> mit dem gewohnten Fleiße zu geben, und das hiesige Publikum hat erst aus dem Berlinischen Zeitungsartikel etwas erfahren. Aber auch jetzt weiche ich den deshalb an mich geschehenden Anfragen durch unbestimmte Äußerungen aus. <lb/>Ferner muß ich erklären, daß der Aufenthalt in Bonn mir keineswegs mißfällt, sondern daß ich vielmehr eine große Neigung dazu gefaßt habe. Die heitere Gegend, das milde Klima, die bequeme Lage zu kleinen und großen Reisen, das freundschaftliche Verhältnis mit meinen Amtsgenossen, die gesellige Ungezwungenheit, selbst Beschränktheit einer kleinen Stadt sagten mir zu. Dazu kommt nun, daß ich meine gelehrten Vorräte nicht ohne Mühe und Kosten um mich her versammelt und mich angenehm eingerichtet habe. Ich hatte es recht eigentlich darauf angelegt, in meinem Hause einen literarischen Zirkel zu bilden. Ich hege keine Abneigung gegen <placeName key="15">Berlin</placeName>, das ich ja von alter Zeit kenne. Nur scheute ich das rauhere Klima und die weite Entfernung von meinen Freunden in Frankreich. Auch glaubte ich den geselligen Anforderungen dort nicht ausweichen zu können, und meine Gesundheit sowohl als meine weit aussehenden Forschungen fordern eine von den Zerstreuungen der großen Welt ungestörte Ruhe. <lb/>[5] Ich habe ja selbst um die Verlängerung meines hiesigen Aufenthalts bis zum nächsten Herbst angehalten, und <orgName key="5440">das Ministerium</orgName> hat die Gnade gehabt, mein Gesuch zu bewilligen. Ich hoffte in der Folge, vielleicht mit dem Vorbehalt, eine Reihe von Vorlesungen in Berlin zu geben, meine definitive Bestimmung für Bonn auszuwirken. Hier fand ich eine besonders erfreuliche Sphäre gelehrter Tätigkeit, wo man die Früchte seines Fleißes gleichsam vor seinen Augen wachsen und reifen sehen konnte. Es war ein herrlicher Gedanke, hier am Rheine gründliche deutsche Bildung und Liebe dazu zu verbreiten. Sie haben recht, teuerster Freund, <orgName key="12214">die kgl. preußische Regierung</orgName> hat unendlich viel für Kunst und Wissenschaft getan, und die Stiftung von Bonn war ein echt vaterländisches Ereignis. Die Wahl des Ortes war die glücklichste: die königliche Freigebigkeit <persName key="515">des Monarchen</persName>, die weise Sorgfalt des Ministeriums können nicht genug gepriesen werden. Ich war stolz darauf, Fremden, die mich besuchten, dem Grafen Montlosier, <persName key="2321">dem Herzog von Richelieu</persName>, <persName key="1386">dem Grafen Reinhard</persName>, den großen Umfang und die Vortrefflichkeit der neuen Anstalt darlegen zu können. Ich brachte sie zu dem Geständnis, daß es in Frankreich, wenigstens außer Paris, nichts Ähnliches gebe. Ich lege Ihnen einen Brief des Herzogs von Richelieu bei, den er mir kurz nach seinem Besuche schrieb. <lb/>Wenn viel für uns [6] geschehen war, so haben wir uns auch unsererseits wacker gerührt. Vierhundert Studierende, darunter eine große Anzahl schon gebildeter junger Männer aus allen Gegenden Deutschlands, im ersten Jahre nach der Stiftung: das ist in den Annalen der Universitäten unerhört. Ich gebe diesen Winter eine öffentliche Vorlesung vor zweihundert Zuhörern. ‒ Wenn es ungestört so fortgegangen wäre, so hätten wir in einigen Jahren an Frequenz und Ruhm auch im Auslande, mit <orgName key="6154"><placeName key="2">Göttingen</placeName></orgName> wetteifern mögen. <lb/>Freilich, es ist ein Großes, wenn der Staat Aufwand für wissenschaftliche Anstalten macht, den Gelehrten ihre Existenz reichlich sichert. Aber diese Wohltaten verlieren ihre Kraft, wenn nicht noch eine, die höchste hinzukommt: ehrenvolle Auszeichnungen, aufmunternde Beweise des Wohlwollens von seiten der Regierung. Der akademische Lehrer insbesondere kann das Zutrauen nicht entbehren. Und dieses Zutrauen haben wir nun durch eine unglückliche Konstellation verwirkt, ich weiß nicht wie; wenigstens scheinen mir die Anlässe in gar keinem Verhältnisse mit den Folgen zu stehen. Von einem großen Staatenverein ist das Anathema ausgesprochen worden. Der Widerhall davon ist durch Europa erschollen, und wir mögen nun bald in amerikanischen Zeitungsblättern lesen, daß wir, sämtlich oder großenteils, Verführer der Jugend sind. Doch ich will auf das, was die deutschen Universitäten im allgemeinen seit <name key="19747" type="work"><name key="3392" type="work">der Schrift</name></name> von <persName key="2427">Stourdza</persName> betroffen hat, nicht eingehen. Mein Brief würde zum Buche [7] werden, Sie würden meiner Ansicht Ihre Gründe entgegenstellen, und am Ende würde vielleicht keiner den anderen überzeugen. Ich beschränke mich auf meine eigene Angelegenheit. Zu dem getanen Schritte hat mich nichts anderes bewogen als die Überzeugung, wovon ich auch jetzt nicht weichen kann, daß das Amt, wozu ich vor anderthalb Jahren so ehrenvoll berufen wurde, nicht mehr dasselbe ist, daß es durch die neuen Einrichtungen seine wesentlichsten Vorrechte, seine Annehmlichkeit und seine Würde verloren hat. <lb/>Sie erlassen mir wohl den Beweis, sonst bin ich erbötig, ihn nachdrücklich zu führen. <lb/>Aber Sie sagen mir, die notwendig befundenen Vorkehrungsmaßregeln seien nicht gegen Gelehrte von meinem Charakter gemeint. Es ist wahr, ich habe nie den Ehrgeiz gehabt, eine politische Rolle zu spielen, weder als Schriftsteller, noch auf andere Art: sonst hätte ich nicht so manche günstige Gelegenheit vorbeigehen lassen. Ein einziges Mal habe ich meinen Namen eingezeichnet, das war in der allgemeinen Sache des Vaterlandes, in dem europäischen Kampfe für die Selbständigkeit der Staaten. Ich bin es seit langen Jahren gewohnt, in der Mitte politischer Gärungen als ruhiger Zuschauer zu stehen, nur eine mäßigende und vermittelnde Stimme hören zu lassen und mit Menschen von allen Parteien in freundlichem Verhältnisse zu bleiben. Noch am Tage meiner Abreise [8] von Paris <ref target="fud://4754">schrieb mir <persName key="631">Herr von Chateaubriand</persName></ref>, ich sei dazu berufen, die Geschichte Frankreichs im Mittelalter zu schreiben. Allein das in Deutschland erwachte Mißtrauen gegen die Gelehrten und Schriftsteller überhaupt liegt am Tage; und ein solches Mißtrauen ist nicht wie eine gewöhnliche Flamme, welche erlischt, wenn der Nahrungsstoff erschöpft ist: es phosphoresziert nur um so heller in luftleerem Raume. Wenn der Verdacht sich auf Meinungen, auch auf nicht ausgesprochene, richtet, kann ich sicher sein, daß die Meinungen des Verfassers <name key="3369" type="work">der Schrift „<hi rend="weight:bold">Sur le système continental</hi>“</name> und <name key="11635" type="work">einiger anderer politischer Schriften</name> im Jahre 1813, des vieljährigen Freundes <persName key="222">der Frau von Staël</persName>, des Mitherausgebers <name key="2409" type="work">ihres nachgelassenen Werkes</name> (ich will Sie geflissentlich an alles erinnern), immer unverdächtig scheinen werden? <lb/>Mit dem besten Willen kam ich nach Deutschland. Meine Freunde in Frankreich ließen mich ungern von sich und würden mich mit offenen Armen wieder aufnehmen. Sie wissen, daß ich dort sehr angenehme Verhältnisse habe, und wenn ich bloß meine Neigung befragt hätte, so wäre ich wohl immer da geblieben. Aber es schien mir vielleicht rühmlicher, gewiß verdienstlicher und berufsgemäßer, meine Kräfte zum Nutzen des Vaterlandes zu verwenden. Ich fand alles in scheinbar tiefer Ruhe. Plötzlich ist ein Ungewitter aufgezogen, aus einem Wölkchen, wie das war, welches der Prophet Elias am Horizont erblickte. Mein erster [9] Gedanke war, ein Obdach zu suchen. Glauben Sie mir, ich bilde mir nicht ein, zu irgend etwas notwendig zu sein: meine Entfernung vom öffentlichen Unterricht würde keine merkliche Lücke verursachen. Mein Fach gehört zu den entbehrlichen, für die nur dann Begünstigung zu hoffen ist, wenn bei vollkommen heiterer Stimmung auch an äußere Verzierung gedacht wird. Der Inhalt Ihres Briefes war mir daher etwas ganz Unerwartetes. <lb/>Sie bezeugen mir die unendlich ehrenvolle Hochschätzung <persName key="553">des Fürsten Staatskanzlers</persName>: ich bitte Sie, den Ausdruck meiner ehrerbietigsten Gesinnungen und meiner Dankbarkeit vor Se. Durchlaucht zu bringen. Wenn ich die schmeichelhafte Überzeugung hegen darf, daß der Staatskanzler, daß <persName key="2403">der Minister von Altenstein</persName>, dessen Briefe ich als kostbare Beweise der Anerkennung aufbewahre, auf die Fortsetzung meiner wissenschaftlichen Tätigkeit im Dienste des Staats einigen Wert legen, so wirft das freilich ein bedeutendes Gewicht in die andere Wagschale.<lb/>Lassen Sie uns also miteinander überlegen, ob sich irgendein Ausweg finden läßt. Sie sagen mir, „die getroffenen Maßregeln werden mich auf keine Art unangenehm berühren, mein Leben und Wirken stehe da, vor jeder unfreundlichen Berührung geschützt, wie von einer Ägide, die kein Pfeil durchbohrt.“ Könnten Sie mir darüber eine amtliche Versicherung schaffen? Brief und Siegel? Das wäre ja gewissermaßen<lb/>[10] <name key="19749" type="work">„Ein eisern Privilegium,<lb/>Zu hexen frank und frei herum.“</name><lb/>Aber im Ernst, kann irgendein Einzelner billigerweise verlangen, daß zu seinen Gunsten eine Ausnahme gemacht werde von einer allgemeinen Maßregel, die so viele würdige Männer trifft? Sonst standen zwischen den Professoren und dem Ministerium nur die Kuratoren, Männer von erlauchter Geburt und in hohen Staatsämtern, deren Namen schon den Universitäten zur Zierde gereichte; und ihre Wirksamkeit war durchaus nicht hemmend, sondern eine fördernde und aufmunternde Fürsorge. Von spezieller Aufsicht war gar nicht die Rede; sie schien um so weniger nötig, da die Grundsätze der Lehrer vor ihrer Anstellung meist durch ihre Schriften bekannt waren. In dem unerhörten Fall, daß ein Lehrer sein Amt zu übeln Zwecken gemißbraucht hätte, kam es zunächst dem akademischen Senate zu, für die Ehre und Unbescholtenheit der Universität zu sorgen. Jetzt sind Aufseher in der Nähe hingestellt mit einer unbedingten und bisher beispiellosen Vollmacht. Wie ist einem solchen Verhältnis auszuweichen? Ich sehe nur ein einziges Mittel. Die Maßregel ist nur als transitorisch, das Verhältnis der Universitäten zu den Kuratoren nur als suspendiert angekündigt worden. Es käme also darauf an, einen speziellen wissenschaftlichen Auftrag auszumitteln, dessen Ausführung mich während [11] dieser Zeit hinlänglich beschäftigte, auch wenn ich einstweilen der gewöhnlichen Geschäfte eines akademischen Lehrers überhoben würde.<lb/>Einen solchen Auftrag wüßte ich wohl. Sogleich bei meiner Rückkehr in Deutschland habe ich mein Augenmerk darauf gerichtet; aber ich hegte nicht mehr die Hoffnung, jetzt, da die Bewegungen des Augenblicks die Gemüter ganz in Anspruch nehmen, Begünstigung dafür zu finden. Sie erregen diese Hoffnung von neuem, indem Sie mir sagen, der preußische Staat werde auch jetzt fortfahren, väterlich und liberaler als jeder andre für das Gedeihen der Wissenschaft und Kunst zu sorgen.<lb/>Mein Wunsch wäre nämlich, das Studium des Sanskrit und der indischen Literatur überhaupt in Deutschland auf eine gründliche Art einheimisch zu machen. Das große gelehrte Interesse der Sache brauche ich Ihnen nicht auseinanderzusetzen: Sie sind im Besitz aller darauf bezüglichen Ideen. Ich lege <name key="2555" type="work">einen Aufsatz</name> bei, wodurch ich die Gönner der Wissenschaften in Berlin aufmerksam zu machen gesucht habe, er ist <name key="3471" type="periodical">den Bonnischen Jahrbüchern</name> eingerückt worden.<lb/>Noch will ich erinnern, daß nicht nur in Paris ein eigner Lehrstuhl für das Sanskrit errichtet ist, sondern daß ein deutscher Gelehrter, <persName key="2426">Fr. Bopp</persName>, mit Unterstützung <orgName key="11752">der bayerischen Regierung</orgName>, und, auf meine Empfehlung, insbesondere <persName key="634">des Kronprinzen von Bayern</persName>, seit einer Anzahl von Jahren in Paris, jetzt in <placeName key="292">London</placeName>, einzig zu diesem Zwecke studiert und das Versprechen [12] einer Professur in <placeName key="230">Würzburg</placeName> erhalten hat. Er hat jetzt einen indischen Text in London sehr lobenswert herausgegeben, worüber ich nächstens eine Beurteilung drucken lassen werde. In Göttingen ist noch nichts geschehen, doch steht es über kurz oder lang zu erwarten, da die Verhältnisse mit England es dort besonders erleichtern.<lb/>Wenn man also, wie billig, bei keiner Erweiterung der Wissenschaft zurückbleiben will, so wäre es nötig, auf irgendeiner der preußischen Universitäten etwas für das Studium der indischen Literatur zu tun. Ich glaube, es würde für Bonn keine gleichgültige Auszeichnung sein, wenn man hier die Hilfsmittel des Sanskrit, die ich schon großenteils besitze, beisammen fände; wenn man in der Folge auch Elementarbücher und indische Texte drucken könnte. Die Lage ist besonders günstig wegen der Nähe von London und Paris, wo allein indische Manuskripte sind. Einige außerordentliche Unterstützung wäre erforderlich, aber sie würde nicht unerschwinglich sein, keineswegs außer Verhältnis mit dem, was das hohe Ministerium für andre auch nicht ganz notwendige Studien so freigebig bewilligt hat.<lb/>Diesen Lieblingsplan hatte ich nun schon völlig aufgegeben, als ich vor sechs Wochen nach Berlin schrieb. Ich überlasse es Ihnen, mein teuerster Freund, ob Sie den Versuch wagen wollen, der Sache Eingang zu verschaffen. Auf erhaltenen Befehl würde ich sogleich <persName key="2403">dem Minister [13] des öffentlichen Unterrichts</persName> einen ins einzelne gehenden Plan vorlegen.<lb/>Ich weiß wohl, daß die Ausführung mir eine Menge mühseliger und trockener Arbeiten auferlegen und daß ich einige Jahre hindurch alle Hände voll zu tun haben würde, statt daß ich, bei individueller Fortsetzung des Studiums, nur die Blüte davon pflücken und sie zu welthistorischen, philosophischen, dichterischen Zwecken benutzen könnte. Aber die Liebe zur Sache würde mir die Schwierigkeiten überwinden helfen. <lb/>Ich hoffe, Sie werden in diesen Äußerungen die Bereitwilligkeit erkennen, den Eröffnungen, die Sie mir von seiten eines erlauchten Gönners gemacht haben, entgegenzukommen. Eine Reise nach Berlin halte ich in dem gegenwärtigen Augenblick durchaus nicht für zweckmäßig.<lb/>Leben Sie recht wohl, mein teurer Freund, und erfreuen Sie mich bald mit einer Antwort. Denn nach dem getanen Schritte bin ich in der Lage jenes alten Ritters in einer spanischen Romanze:<lb/>„Schon den einen Fuß im Bügel.“<lb/>Und um einen neuen Lebensplan auszuführen, müssen doch mancherlei Anstalten getroffen werden.<lb/>[14]<lb/>[15]<lb/>[16]</p>', '36_xml_standoff' => '[1] [<anchor type="b" n="887" ana="10" xml:id="NidB99166"/>Bonn<anchor type="e" n="887" ana="10" xml:id="NidE99166"/>,] 19. Januar 1820.<lb/><ref target="fud://3500">Ihren Brief vom 8. Januar</ref> erhielt ich vor einigen Tagen, mein teurer und hochverehrter Freund, und eile zuvörderst, Ihren freundschaftlichen Vorwürfen zu begegnen. Meine Gesinnungen gegen Sie können sich nie ändern. Ich werde Ihnen zeitlebens dankbar sein für die freundschaftliche Wärme, womit Sie zu meiner Hilfe herbeigeeilt sind, als ich in <anchor type="b" n="898" ana="10" xml:id="NidB99167"/>Auxerre<anchor type="e" n="898" ana="10" xml:id="NidE99167"/> krank lag: <anchor type="b" n="8748" ana="16" xml:id="NidB54866"/>ich erzähle es gern, daß Sie mich damals den Klauen ungeschickter Ärzte, oder was einerlei ist, dem Tode entrissen haben<anchor type="e" n="8748" ana="16" xml:id="NidE54866"/>. Aber ich fand nicht bloß eine Befriedigung des Herzens in Ihrem Wohlwollen, Ihr Umgang gewährte mir den lebhaftesten Genuß, und die Tage, die ich mit Ihnen in <anchor type="b" n="171" ana="10" xml:id="NidB99168"/>Paris<anchor type="e" n="171" ana="10" xml:id="NidE99168"/>, auf dem Lande, in der Schweiz, oder wo es sein mochte, zugebracht, gehören zu meinen angenehmsten Erinnerungen.<lb/>Immer freute ich mich, in Ihnen den witzigen Gesellschafter, den geistreichen Beobachter der Welt, den ideenreichen Forscher wiederzufinden und meinen Geist durch Ihre Mitteilungen anzuregen. Als ich im Jahre 1817 <anchor type="b" n="222" ana="11" xml:id="NidB99170"/>einen unersetzlichen Verlust<anchor type="e" n="222" ana="11" xml:id="NidE99170"/> erlitten hatte, als die Auflösung eines Verhältnisses ohnegleichen durch den Tod mir eine unerwünschte Freiheit wiedergab, habe ich in Ihren Einladungen zur Rückkehr nach Deutschland aufs neue Ihren freundschaftlichen Eifer erkannt. Bei unserem Zusammentreffen in <anchor type="b" n="1591" ana="10" xml:id="NidB99169"/>Koblenz<anchor type="e" n="1591" ana="10" xml:id="NidE99169"/> und in Bonn glaubte ich von Ihrer Seite einige Zurückhaltung [2] zu bemerken und vermied es, diese Grenze zu durchbrechen. Seitdem ist, soviel ich weiß, keine Botschaft von Ihnen zu mir gelangt, sonst wäre sie nicht unerwidert geblieben. Sie kennen meine alte Nachlässigkeit im Briefschreiben: es ist ein Familienfehler, den sogar <anchor type="b" n="8" ana="11" xml:id="NidB99171"/>mein Bruder<anchor type="e" n="8" ana="11" xml:id="NidE99171"/> mir zugute halten muß, so wie ich ihm. Überdies, was hätte ich Ihnen, der Sie in mannigfaltigen und bedeutenden Weltverhältnissen leben, aus meiner wissenschaftlichen Eingezogenheit Unterhaltendes melden können? Dazu kam, daß ich seit meiner Ankunft in Bonn sehr häufig verstimmt war, und zwar durch einen Verdruß der Art, wovon man nicht gern redet. Dies führt mich auf die Verleumdungen, deren Sie erwähnen. Sie können, mein teurer Freund, keine sehr schweren Kämpfe zu bestehen gehabt haben, denn die lügenhafte Abgeschmacktheit dieser Verleumdungen mußte jedem Unbefangenen in die Augen springen. Vergebens habe ich <anchor type="b" n="243" ana="11" xml:id="NidB99173"/><anchor type="b" n="186" ana="11" xml:id="NidB99172"/><anchor type="b" n="2402" ana="11" xml:id="NidB99174"/>die Urheber<anchor type="e" n="2402" ana="11" xml:id="NidE99174"/><anchor type="e" n="186" ana="11" xml:id="NidE99172"/><anchor type="e" n="243" ana="11" xml:id="NidE99173"/> durch die geringschätzigste Zurückweisung ihrer Zumutungen aufgefordert, ans Licht hervorzutreten, um mir alsdann volle Genugtuung zu schaffen. Sie haben sich wohl davor gehütet. Sie hatten mit bleiernen Pfeilen auf eine stählerne Rüstung geschossen. Das flüchtige Aufsehen ist längst in tiefe Vergessenheit begraben, ich genieße aus der Ferne und Nähe der gewohnten Achtung. Übrigens waren in Berlin zwei verehrte Freunde von mir, <anchor type="b" n="2429" ana="11" xml:id="NidB99175"/>der General v. Müffling<anchor type="e" n="2429" ana="11" xml:id="NidE99175"/> und <anchor type="b" n="276" ana="11" xml:id="NidB99176"/>der Staatsrat Hufeland<anchor type="e" n="276" ana="11" xml:id="NidE99176"/>, näher von der Sache unterrichtet und werden [3] wohl gelegentlich das Nötige gesagt haben. Wenn es Sie interessieren kann, will ich Sie ein andermal davon unterhalten: mir ist es nun schon gleichgültig geworden, aber es bleibt immer eine seltsam merkwürdige Geschichte.<lb/>Sie sehen, daß ich das Bedürfnis habe, zu Ihnen im vollen Vertrauen der Freundschaft zu reden. Aber kommen wir nach dieser schon allzu langen Vorrede auf die Hauptsache. Auch hier muß ich zuvörderst einige irrige Annahmen aus dem Wege räumen, die ich in Ihrem Briefe bemerke.<lb/>Ich gebe Ihnen mein Ehrenwort, daß ich den getanen Schritt mit niemandem verabredet, noch viel weniger mich dazu verbindlich gemacht [habe]. Der Entschluß ist ganz aus mir selbst hervorgegangen. Sollte in einer Stelle Ihres Briefes, was ich kaum glauben kann, <anchor type="b" n="2323" ana="11" xml:id="NidB99177"/>unser allgemein geliebter und verehrter, leider ehemaliger Kurator<anchor type="e" n="2323" ana="11" xml:id="NidE99177"/> gemeint sein, so kann ich versichern, daß er, wiewohl es ihn geschmerzt hat, sich für jetzt von <anchor type="b" n="6155" ana="15" xml:id="NidB99178"/>der Universität<anchor type="e" n="6155" ana="15" xml:id="NidE99178"/> zu trennen, den aufrichtigsten Anteil an ihrem fortwährenden Gedeihen nimmt, und daß er, in der Voraussetzung, ich könnte im Sinne haben, mich von dem Lehramte zurückzuziehen, mir die dringendsten Gründe entgegengestellt hat. Ich habe die Sache ganz als meine Privatangelegenheit behandelt, ich habe mich nur wenigen Freunden im engsten Vertrauen [4] eröffnet, ich habe fortgefahren, <anchor type="b" n="2452" ana="12" xml:id="NidB99223"/><anchor type="b" n="3452" ana="12" xml:id="NidB99220"/><anchor type="b" n="4972" ana="12" xml:id="NidB99224"/><anchor type="b" n="2435" ana="12" xml:id="NidB99221"/><anchor type="b" n="3730" ana="12" xml:id="NidB99225"/><anchor type="b" n="4965" ana="12" xml:id="NidB99226"/><anchor type="b" n="3511" ana="12" xml:id="NidB99227"/><anchor type="b" n="2475" ana="12" xml:id="NidB99228"/>meine Vorlesungen<anchor type="e" n="2475" ana="12" xml:id="NidE99228"/><anchor type="e" n="3511" ana="12" xml:id="NidE99227"/><anchor type="e" n="4965" ana="12" xml:id="NidE99226"/><anchor type="e" n="3730" ana="12" xml:id="NidE99225"/><anchor type="e" n="2435" ana="12" xml:id="NidE99221"/><anchor type="e" n="4972" ana="12" xml:id="NidE99224"/><anchor type="e" n="3452" ana="12" xml:id="NidE99220"/><anchor type="e" n="2452" ana="12" xml:id="NidE99223"/> mit dem gewohnten Fleiße zu geben, und das hiesige Publikum hat erst aus dem Berlinischen Zeitungsartikel etwas erfahren. Aber auch jetzt weiche ich den deshalb an mich geschehenden Anfragen durch unbestimmte Äußerungen aus. <lb/>Ferner muß ich erklären, daß der Aufenthalt in Bonn mir keineswegs mißfällt, sondern daß ich vielmehr eine große Neigung dazu gefaßt habe. Die heitere Gegend, das milde Klima, die bequeme Lage zu kleinen und großen Reisen, das freundschaftliche Verhältnis mit meinen Amtsgenossen, die gesellige Ungezwungenheit, selbst Beschränktheit einer kleinen Stadt sagten mir zu. Dazu kommt nun, daß ich meine gelehrten Vorräte nicht ohne Mühe und Kosten um mich her versammelt und mich angenehm eingerichtet habe. Ich hatte es recht eigentlich darauf angelegt, in meinem Hause einen literarischen Zirkel zu bilden. Ich hege keine Abneigung gegen <anchor type="b" n="15" ana="10" xml:id="NidB99179"/>Berlin<anchor type="e" n="15" ana="10" xml:id="NidE99179"/>, das ich ja von alter Zeit kenne. Nur scheute ich das rauhere Klima und die weite Entfernung von meinen Freunden in Frankreich. Auch glaubte ich den geselligen Anforderungen dort nicht ausweichen zu können, und meine Gesundheit sowohl als meine weit aussehenden Forschungen fordern eine von den Zerstreuungen der großen Welt ungestörte Ruhe. <lb/>[5] Ich habe ja selbst um die Verlängerung meines hiesigen Aufenthalts bis zum nächsten Herbst angehalten, und <anchor type="b" n="5440" ana="15" xml:id="NidB99180"/>das Ministerium<anchor type="e" n="5440" ana="15" xml:id="NidE99180"/> hat die Gnade gehabt, mein Gesuch zu bewilligen. Ich hoffte in der Folge, vielleicht mit dem Vorbehalt, eine Reihe von Vorlesungen in Berlin zu geben, meine definitive Bestimmung für Bonn auszuwirken. Hier fand ich eine besonders erfreuliche Sphäre gelehrter Tätigkeit, wo man die Früchte seines Fleißes gleichsam vor seinen Augen wachsen und reifen sehen konnte. Es war ein herrlicher Gedanke, hier am Rheine gründliche deutsche Bildung und Liebe dazu zu verbreiten. Sie haben recht, teuerster Freund, <anchor type="b" n="12214" ana="15" xml:id="NidB99181"/>die kgl. preußische Regierung<anchor type="e" n="12214" ana="15" xml:id="NidE99181"/> hat unendlich viel für Kunst und Wissenschaft getan, und die Stiftung von Bonn war ein echt vaterländisches Ereignis. Die Wahl des Ortes war die glücklichste: die königliche Freigebigkeit <anchor type="b" n="515" ana="11" xml:id="NidB99182"/>des Monarchen<anchor type="e" n="515" ana="11" xml:id="NidE99182"/>, die weise Sorgfalt des Ministeriums können nicht genug gepriesen werden. Ich war stolz darauf, Fremden, die mich besuchten, dem Grafen Montlosier, <anchor type="b" n="2321" ana="11" xml:id="NidB99183"/>dem Herzog von Richelieu<anchor type="e" n="2321" ana="11" xml:id="NidE99183"/>, <anchor type="b" n="1386" ana="11" xml:id="NidB99184"/>dem Grafen Reinhard<anchor type="e" n="1386" ana="11" xml:id="NidE99184"/>, den großen Umfang und die Vortrefflichkeit der neuen Anstalt darlegen zu können. Ich brachte sie zu dem Geständnis, daß es in Frankreich, wenigstens außer Paris, nichts Ähnliches gebe. Ich lege Ihnen einen Brief des Herzogs von Richelieu bei, den er mir kurz nach seinem Besuche schrieb. <lb/>Wenn viel für uns [6] geschehen war, so haben wir uns auch unsererseits wacker gerührt. Vierhundert Studierende, darunter eine große Anzahl schon gebildeter junger Männer aus allen Gegenden Deutschlands, im ersten Jahre nach der Stiftung: das ist in den Annalen der Universitäten unerhört. Ich gebe diesen Winter eine öffentliche Vorlesung vor zweihundert Zuhörern. ‒ Wenn es ungestört so fortgegangen wäre, so hätten wir in einigen Jahren an Frequenz und Ruhm auch im Auslande, mit <anchor type="b" n="6154" ana="15" xml:id="NidB99186"/><anchor type="b" n="2" ana="10" xml:id="NidB99185"/>Göttingen<anchor type="e" n="2" ana="10" xml:id="NidE99185"/><anchor type="e" n="6154" ana="15" xml:id="NidE99186"/> wetteifern mögen. <lb/>Freilich, es ist ein Großes, wenn der Staat Aufwand für wissenschaftliche Anstalten macht, den Gelehrten ihre Existenz reichlich sichert. Aber diese Wohltaten verlieren ihre Kraft, wenn nicht noch eine, die höchste hinzukommt: ehrenvolle Auszeichnungen, aufmunternde Beweise des Wohlwollens von seiten der Regierung. Der akademische Lehrer insbesondere kann das Zutrauen nicht entbehren. Und dieses Zutrauen haben wir nun durch eine unglückliche Konstellation verwirkt, ich weiß nicht wie; wenigstens scheinen mir die Anlässe in gar keinem Verhältnisse mit den Folgen zu stehen. Von einem großen Staatenverein ist das Anathema ausgesprochen worden. Der Widerhall davon ist durch Europa erschollen, und wir mögen nun bald in amerikanischen Zeitungsblättern lesen, daß wir, sämtlich oder großenteils, Verführer der Jugend sind. Doch ich will auf das, was die deutschen Universitäten im allgemeinen seit <anchor type="b" n="19747" ana="12" xml:id="NidB99200"/><anchor type="b" n="3392" ana="12" xml:id="NidB99201"/>der Schrift<anchor type="e" n="3392" ana="12" xml:id="NidE99201"/><anchor type="e" n="19747" ana="12" xml:id="NidE99200"/> von <anchor type="b" n="2427" ana="11" xml:id="NidB99192"/>Stourdza<anchor type="e" n="2427" ana="11" xml:id="NidE99192"/> betroffen hat, nicht eingehen. Mein Brief würde zum Buche [7] werden, Sie würden meiner Ansicht Ihre Gründe entgegenstellen, und am Ende würde vielleicht keiner den anderen überzeugen. Ich beschränke mich auf meine eigene Angelegenheit. Zu dem getanen Schritte hat mich nichts anderes bewogen als die Überzeugung, wovon ich auch jetzt nicht weichen kann, daß das Amt, wozu ich vor anderthalb Jahren so ehrenvoll berufen wurde, nicht mehr dasselbe ist, daß es durch die neuen Einrichtungen seine wesentlichsten Vorrechte, seine Annehmlichkeit und seine Würde verloren hat. <lb/>Sie erlassen mir wohl den Beweis, sonst bin ich erbötig, ihn nachdrücklich zu führen. <lb/>Aber Sie sagen mir, die notwendig befundenen Vorkehrungsmaßregeln seien nicht gegen Gelehrte von meinem Charakter gemeint. Es ist wahr, ich habe nie den Ehrgeiz gehabt, eine politische Rolle zu spielen, weder als Schriftsteller, noch auf andere Art: sonst hätte ich nicht so manche günstige Gelegenheit vorbeigehen lassen. Ein einziges Mal habe ich meinen Namen eingezeichnet, das war in der allgemeinen Sache des Vaterlandes, in dem europäischen Kampfe für die Selbständigkeit der Staaten. Ich bin es seit langen Jahren gewohnt, in der Mitte politischer Gärungen als ruhiger Zuschauer zu stehen, nur eine mäßigende und vermittelnde Stimme hören zu lassen und mit Menschen von allen Parteien in freundlichem Verhältnisse zu bleiben. Noch am Tage meiner Abreise [8] von Paris <ref target="fud://4754">schrieb mir <anchor type="b" n="631" ana="11" xml:id="NidB99202"/>Herr von Chateaubriand<anchor type="e" n="631" ana="11" xml:id="NidE99202"/></ref>, ich sei dazu berufen, die Geschichte Frankreichs im Mittelalter zu schreiben. Allein das in Deutschland erwachte Mißtrauen gegen die Gelehrten und Schriftsteller überhaupt liegt am Tage; und ein solches Mißtrauen ist nicht wie eine gewöhnliche Flamme, welche erlischt, wenn der Nahrungsstoff erschöpft ist: es phosphoresziert nur um so heller in luftleerem Raume. Wenn der Verdacht sich auf Meinungen, auch auf nicht ausgesprochene, richtet, kann ich sicher sein, daß die Meinungen des Verfassers <anchor type="b" n="3369" ana="12" xml:id="NidB99203"/>der Schrift „<hi rend="weight:bold">Sur le système continental</hi>“<anchor type="e" n="3369" ana="12" xml:id="NidE99203"/> und <anchor type="b" n="11635" ana="12" xml:id="NidB99204"/>einiger anderer politischer Schriften<anchor type="e" n="11635" ana="12" xml:id="NidE99204"/> im Jahre 1813, des vieljährigen Freundes <anchor type="b" n="222" ana="11" xml:id="NidB99206"/>der Frau von Staël<anchor type="e" n="222" ana="11" xml:id="NidE99206"/>, des Mitherausgebers <anchor type="b" n="2409" ana="12" xml:id="NidB99208"/>ihres nachgelassenen Werkes<anchor type="e" n="2409" ana="12" xml:id="NidE99208"/> (ich will Sie geflissentlich an alles erinnern), immer unverdächtig scheinen werden? <lb/>Mit dem besten Willen kam ich nach Deutschland. Meine Freunde in Frankreich ließen mich ungern von sich und würden mich mit offenen Armen wieder aufnehmen. Sie wissen, daß ich dort sehr angenehme Verhältnisse habe, und wenn ich bloß meine Neigung befragt hätte, so wäre ich wohl immer da geblieben. Aber es schien mir vielleicht rühmlicher, gewiß verdienstlicher und berufsgemäßer, meine Kräfte zum Nutzen des Vaterlandes zu verwenden. Ich fand alles in scheinbar tiefer Ruhe. Plötzlich ist ein Ungewitter aufgezogen, aus einem Wölkchen, wie das war, welches der Prophet Elias am Horizont erblickte. Mein erster [9] Gedanke war, ein Obdach zu suchen. Glauben Sie mir, ich bilde mir nicht ein, zu irgend etwas notwendig zu sein: meine Entfernung vom öffentlichen Unterricht würde keine merkliche Lücke verursachen. Mein Fach gehört zu den entbehrlichen, für die nur dann Begünstigung zu hoffen ist, wenn bei vollkommen heiterer Stimmung auch an äußere Verzierung gedacht wird. Der Inhalt Ihres Briefes war mir daher etwas ganz Unerwartetes. <lb/>Sie bezeugen mir die unendlich ehrenvolle Hochschätzung <anchor type="b" n="553" ana="11" xml:id="NidB99209"/>des Fürsten Staatskanzlers<anchor type="e" n="553" ana="11" xml:id="NidE99209"/>: ich bitte Sie, den Ausdruck meiner ehrerbietigsten Gesinnungen und meiner Dankbarkeit vor Se. Durchlaucht zu bringen. Wenn ich die schmeichelhafte Überzeugung hegen darf, daß der Staatskanzler, daß <anchor type="b" n="2403" ana="11" xml:id="NidB99210"/>der Minister von Altenstein<anchor type="e" n="2403" ana="11" xml:id="NidE99210"/>, dessen Briefe ich als kostbare Beweise der Anerkennung aufbewahre, auf die Fortsetzung meiner wissenschaftlichen Tätigkeit im Dienste des Staats einigen Wert legen, so wirft das freilich ein bedeutendes Gewicht in die andere Wagschale.<lb/>Lassen Sie uns also miteinander überlegen, ob sich irgendein Ausweg finden läßt. Sie sagen mir, „die getroffenen Maßregeln werden mich auf keine Art unangenehm berühren, mein Leben und Wirken stehe da, vor jeder unfreundlichen Berührung geschützt, wie von einer Ägide, die kein Pfeil durchbohrt.“ Könnten Sie mir darüber eine amtliche Versicherung schaffen? Brief und Siegel? Das wäre ja gewissermaßen<lb/>[10] <anchor type="b" n="19749" ana="12" xml:id="NidB99212"/>„Ein eisern Privilegium,<lb/>Zu hexen frank und frei herum.“<anchor type="e" n="19749" ana="12" xml:id="NidE99212"/><lb/>Aber im Ernst, kann irgendein Einzelner billigerweise verlangen, daß zu seinen Gunsten eine Ausnahme gemacht werde von einer allgemeinen Maßregel, die so viele würdige Männer trifft? Sonst standen zwischen den Professoren und dem Ministerium nur die Kuratoren, Männer von erlauchter Geburt und in hohen Staatsämtern, deren Namen schon den Universitäten zur Zierde gereichte; und ihre Wirksamkeit war durchaus nicht hemmend, sondern eine fördernde und aufmunternde Fürsorge. Von spezieller Aufsicht war gar nicht die Rede; sie schien um so weniger nötig, da die Grundsätze der Lehrer vor ihrer Anstellung meist durch ihre Schriften bekannt waren. In dem unerhörten Fall, daß ein Lehrer sein Amt zu übeln Zwecken gemißbraucht hätte, kam es zunächst dem akademischen Senate zu, für die Ehre und Unbescholtenheit der Universität zu sorgen. Jetzt sind Aufseher in der Nähe hingestellt mit einer unbedingten und bisher beispiellosen Vollmacht. Wie ist einem solchen Verhältnis auszuweichen? Ich sehe nur ein einziges Mittel. Die Maßregel ist nur als transitorisch, das Verhältnis der Universitäten zu den Kuratoren nur als suspendiert angekündigt worden. Es käme also darauf an, einen speziellen wissenschaftlichen Auftrag auszumitteln, dessen Ausführung mich während [11] dieser Zeit hinlänglich beschäftigte, auch wenn ich einstweilen der gewöhnlichen Geschäfte eines akademischen Lehrers überhoben würde.<lb/>Einen solchen Auftrag wüßte ich wohl. Sogleich bei meiner Rückkehr in Deutschland habe ich mein Augenmerk darauf gerichtet; aber ich hegte nicht mehr die Hoffnung, jetzt, da die Bewegungen des Augenblicks die Gemüter ganz in Anspruch nehmen, Begünstigung dafür zu finden. Sie erregen diese Hoffnung von neuem, indem Sie mir sagen, der preußische Staat werde auch jetzt fortfahren, väterlich und liberaler als jeder andre für das Gedeihen der Wissenschaft und Kunst zu sorgen.<lb/>Mein Wunsch wäre nämlich, das Studium des Sanskrit und der indischen Literatur überhaupt in Deutschland auf eine gründliche Art einheimisch zu machen. Das große gelehrte Interesse der Sache brauche ich Ihnen nicht auseinanderzusetzen: Sie sind im Besitz aller darauf bezüglichen Ideen. Ich lege <anchor type="b" n="2555" ana="12" xml:id="NidB99233"/>einen Aufsatz<anchor type="e" n="2555" ana="12" xml:id="NidE99233"/> bei, wodurch ich die Gönner der Wissenschaften in Berlin aufmerksam zu machen gesucht habe, er ist <anchor type="b" n="3471" ana="13" xml:id="NidB99232"/>den Bonnischen Jahrbüchern<anchor type="e" n="3471" ana="13" xml:id="NidE99232"/> eingerückt worden.<lb/>Noch will ich erinnern, daß nicht nur in Paris ein eigner Lehrstuhl für das Sanskrit errichtet ist, sondern daß ein deutscher Gelehrter, <anchor type="b" n="2426" ana="11" xml:id="NidB99214"/>Fr. Bopp<anchor type="e" n="2426" ana="11" xml:id="NidE99214"/>, mit Unterstützung <anchor type="b" n="11752" ana="15" xml:id="NidB99218"/>der bayerischen Regierung<anchor type="e" n="11752" ana="15" xml:id="NidE99218"/>, und, auf meine Empfehlung, insbesondere <anchor type="b" n="634" ana="11" xml:id="NidB99217"/>des Kronprinzen von Bayern<anchor type="e" n="634" ana="11" xml:id="NidE99217"/>, seit einer Anzahl von Jahren in Paris, jetzt in <anchor type="b" n="292" ana="10" xml:id="NidB99215"/>London<anchor type="e" n="292" ana="10" xml:id="NidE99215"/>, einzig zu diesem Zwecke studiert und das Versprechen [12] einer Professur in <anchor type="b" n="230" ana="10" xml:id="NidB99216"/>Würzburg<anchor type="e" n="230" ana="10" xml:id="NidE99216"/> erhalten hat. Er hat jetzt einen indischen Text in London sehr lobenswert herausgegeben, worüber ich nächstens eine Beurteilung drucken lassen werde. In Göttingen ist noch nichts geschehen, doch steht es über kurz oder lang zu erwarten, da die Verhältnisse mit England es dort besonders erleichtern.<lb/>Wenn man also, wie billig, bei keiner Erweiterung der Wissenschaft zurückbleiben will, so wäre es nötig, auf irgendeiner der preußischen Universitäten etwas für das Studium der indischen Literatur zu tun. Ich glaube, es würde für Bonn keine gleichgültige Auszeichnung sein, wenn man hier die Hilfsmittel des Sanskrit, die ich schon großenteils besitze, beisammen fände; wenn man in der Folge auch Elementarbücher und indische Texte drucken könnte. Die Lage ist besonders günstig wegen der Nähe von London und Paris, wo allein indische Manuskripte sind. Einige außerordentliche Unterstützung wäre erforderlich, aber sie würde nicht unerschwinglich sein, keineswegs außer Verhältnis mit dem, was das hohe Ministerium für andre auch nicht ganz notwendige Studien so freigebig bewilligt hat.<lb/>Diesen Lieblingsplan hatte ich nun schon völlig aufgegeben, als ich vor sechs Wochen nach Berlin schrieb. Ich überlasse es Ihnen, mein teuerster Freund, ob Sie den Versuch wagen wollen, der Sache Eingang zu verschaffen. Auf erhaltenen Befehl würde ich sogleich <anchor type="b" n="2403" ana="11" xml:id="NidB99236"/>dem Minister [13] des öffentlichen Unterrichts<anchor type="e" n="2403" ana="11" xml:id="NidE99236"/> einen ins einzelne gehenden Plan vorlegen.<lb/>Ich weiß wohl, daß die Ausführung mir eine Menge mühseliger und trockener Arbeiten auferlegen und daß ich einige Jahre hindurch alle Hände voll zu tun haben würde, statt daß ich, bei individueller Fortsetzung des Studiums, nur die Blüte davon pflücken und sie zu welthistorischen, philosophischen, dichterischen Zwecken benutzen könnte. Aber die Liebe zur Sache würde mir die Schwierigkeiten überwinden helfen. <lb/>Ich hoffe, Sie werden in diesen Äußerungen die Bereitwilligkeit erkennen, den Eröffnungen, die Sie mir von seiten eines erlauchten Gönners gemacht haben, entgegenzukommen. Eine Reise nach Berlin halte ich in dem gegenwärtigen Augenblick durchaus nicht für zweckmäßig.<lb/>Leben Sie recht wohl, mein teurer Freund, und erfreuen Sie mich bald mit einer Antwort. Denn nach dem getanen Schritte bin ich in der Lage jenes alten Ritters in einer spanischen Romanze:<lb/>„Schon den einen Fuß im Bügel.“<lb/>Und um einen neuen Lebensplan auszuführen, müssen doch mancherlei Anstalten getroffen werden.<lb/>[14]<lb/>[15]<lb/>[16]', '36_briefid' => 'Oppeln1928_AWSanKoreff_19011820', '36_absender' => array( (int) 0 => array( [maximum depth reached] ) ), '36_adressat' => array( (int) 0 => array( [maximum depth reached] ) ), '36_datumvon' => '1820-01-19', '36_sortdatum' => '1820-01-19', '36_absenderort' => array( (int) 0 => array( [maximum depth reached] ) ), '36_leitd' => 'Oppeln-Bronikowski, Friedrich von: David Ferdinand Koreff. Berlin u.a. 1928, S. 330‒339.', '36_preasentation' => true, '36_verlag' => 'Gebrüder Paetel', '36_status' => 'Einmal kollationierter Druckvolltext mit Registerauszeichnung', '36_datengeberhand' => 'Dresden, Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitätsbibliothek', '36_anmerkungextern' => 'Abschrift.', '36_sprache' => array( (int) 0 => 'Deutsch' ), '36_purlhand' => 'DE-1a-33958', '36_signaturhand' => 'Mscr.Dresd.e.90,XIX,Bd.13,Nr.45', '36_h1zahl' => '13 S. auf Doppelbl., hs. m. U.', '36_h1format' => '18,4 x 12,1 cm', '36_purlhand_alt' => 'DE-1a-1925072', '36_signaturhand_alt' => 'Mscr.Dresd.e.90,XIX,Bd.13,S.191-206', '36_Link_Hand' => array( (int) 0 => array( [maximum depth reached] ), (int) 1 => array( [maximum depth reached] ), (int) 2 => array( [maximum depth reached] ), (int) 3 => array( [maximum depth reached] ), (int) 4 => array( [maximum depth reached] ), (int) 5 => array( [maximum depth reached] ), (int) 6 => array( [maximum depth reached] ), (int) 7 => array( [maximum depth reached] ), (int) 8 => array( [maximum depth reached] ), (int) 9 => array( [maximum depth reached] ), (int) 10 => array( [maximum depth reached] ), (int) 11 => array( [maximum depth reached] ), (int) 12 => array( [maximum depth reached] ), (int) 13 => array( [maximum depth reached] ), (int) 14 => array( [maximum depth reached] ), (int) 15 => array( [maximum depth reached] ) ), '36_Relationen' => array( (int) 0 => array( [maximum depth reached] ), (int) 1 => array( [maximum depth reached] ) ), '36_Datum' => '1820-01-19', '36_facet_absender' => array( (int) 0 => 'August Wilhelm von Schlegel' ), '36_facet_absender_reverse' => array( (int) 0 => 'Schlegel, August Wilhelm von' ), '36_facet_adressat' => array( (int) 0 => 'Johann Ferdinand Koreff' ), '36_facet_adressat_reverse' => array( (int) 0 => 'Koreff, Johann Ferdinand' ), '36_facet_absenderort' => array( (int) 0 => 'Bonn' ), '36_facet_adressatort' => '', '36_facet_status' => 'Einmal kollationierter Druckvolltext mit Registerauszeichnung', '36_facet_datengeberhand' => 'Dresden, Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitätsbibliothek', '36_facet_sprache' => array( (int) 0 => 'Deutsch' ), '36_facet_korrespondenten' => array( (int) 0 => 'Johann Ferdinand Koreff' ), '_label' => '', '_descr' => '', '_model' => 'Letter', '_model_title' => 'Letter', '_model_titles' => 'Letters', '_url' => '' ), 'doctype_name' => 'Letters', 'captions' => array( '36_dummy' => '', '36_absender' => 'Absender/Verfasser', '36_absverif1' => 'Verfasser Verifikation', '36_absender2' => 'Verfasser 2', '36_absverif2' => 'Verfasser 2 Verifikation', '36_absbrieftyp2' => 'Verfasser 2 Brieftyp', '36_absender3' => 'Verfasser 3', '36_absverif3' => 'Verfasser 3 Verifikation', '36_absbrieftyp3' => 'Verfasser 3 Brieftyp', '36_adressat' => 'Adressat/Empfänger', '36_adrverif1' => 'Empfänger Verifikation', '36_adressat2' => 'Empfänger 2', '36_adrverif2' => 'Empfänger 2 Verifikation', '36_adressat3' => 'Empfänger 3', '36_adrverif3' => 'Empfänger 3 Verifikation', '36_adressatfalsch' => 'Empfänger_falsch', '36_absenderort' => 'Ort Absender/Verfasser', '36_absortverif1' => 'Ort Verfasser Verifikation', '36_absortungenau' => 'Ort Verfasser ungenau', '36_absenderort2' => 'Ort Verfasser 2', '36_absortverif2' => 'Ort Verfasser 2 Verifikation', '36_absenderort3' => 'Ort Verfasser 3', '36_absortverif3' => 'Ort Verfasser 3 Verifikation', '36_adressatort' => 'Ort Adressat/Empfänger', '36_adrortverif' => 'Ort Empfänger Verifikation', '36_datumvon' => 'Datum von', '36_datumbis' => 'Datum bis', '36_altDat' => 'Datum/Datum manuell', '36_datumverif' => 'Datum Verifikation', '36_sortdatum' => 'Datum zum Sortieren', '36_wochentag' => 'Wochentag nicht erzeugen', '36_sortdatum1' => 'Briefsortierung', '36_fremddatierung' => 'Fremddatierung', '36_typ' => 'Brieftyp', '36_briefid' => 'Brief Identifier', '36_purl_web' => 'PURL web', '36_status' => 'Bearbeitungsstatus', '36_anmerkung' => 'Anmerkung (intern)', '36_anmerkungextern' => 'Anmerkung (extern)', '36_datengeber' => 'Datengeber', '36_purl' => 'OAI-Id', '36_leitd' => 'Druck 1:Bibliographische Angabe', '36_druck2' => 'Druck 2:Bibliographische Angabe', '36_druck3' => 'Druck 3:Bibliographische Angabe', '36_internhand' => 'Zugehörige Handschrift', '36_datengeberhand' => 'Datengeber', '36_purlhand' => 'OAI-Id', '36_purlhand_alt' => 'OAI-Id (alternative)', '36_signaturhand' => 'Signatur', '36_signaturhand_alt' => 'Signatur (alternative)', '36_h1prov' => 'Provenienz', '36_h1zahl' => 'Blatt-/Seitenzahl', '36_h1format' => 'Format', '36_h1besonder' => 'Besonderheiten', '36_hueberlieferung' => 'Ãœberlieferung', '36_infoinhalt' => 'Verschollen/erschlossen: Information über den Inhalt', '36_heditor' => 'Editor/in', '36_hredaktion' => 'Redakteur/in', '36_interndruck' => 'Zugehörige Druck', '36_band' => 'KFSA Band', '36_briefnr' => 'KFSA Brief-Nr.', '36_briefseite' => 'KFSA Seite', '36_incipit' => 'Incipit', '36_textgrundlage' => 'Textgrundlage Sigle', '36_uberstatus' => 'Ãœberlieferungsstatus', '36_gattung' => 'Gattung', '36_korrepsondentds' => 'Korrespondent_DS', '36_korrepsondentfs' => 'Korrespondent_FS', '36_ermitteltvon' => 'Ermittelt von', '36_metadatenintern' => 'Metadaten (intern)', '36_beilagen' => 'Beilage(en)', '36_abszusatz' => 'Verfasser Zusatzinfos', '36_adrzusatz' => 'Empfänger Zusatzinfos', '36_absortzusatz' => 'Verfasser Ort Zusatzinfos', '36_adrortzusatz' => 'Empfänger Ort Zusatzinfos', '36_datumzusatz' => 'Datum Zusatzinfos', '36_' => '', '36_KFSA Hand.hueberleiferung' => 'Ãœberlieferungsträger', '36_KFSA Hand.harchiv' => 'Archiv', '36_KFSA Hand.hsignatur' => 'Signatur', '36_KFSA Hand.hprovenienz' => 'Provenienz', '36_KFSA Hand.harchivlalt' => 'Archiv_alt', '36_KFSA Hand.hsignaturalt' => 'Signatur_alt', '36_KFSA Hand.hblattzahl' => 'Blattzahl', '36_KFSA Hand.hseitenzahl' => 'Seitenzahl', '36_KFSA Hand.hformat' => 'Format', '36_KFSA Hand.hadresse' => 'Adresse', '36_KFSA Hand.hvollstaendig' => 'Vollständigkeit', '36_KFSA Hand.hzusatzinfo' => 'H Zusatzinfos', '36_KFSA Druck.drliteratur' => 'Druck in', '36_KFSA Druck.drsigle' => 'Sigle', '36_KFSA Druck.drbandnrseite' => 'Bd./Nr./S.', '36_KFSA Druck.drfaksimile' => 'Faksimile', '36_KFSA Druck.drvollstaendig' => 'Vollständigkeit', '36_KFSA Druck.dzusatzinfo' => 'D Zusatzinfos', '36_KFSA Doku.dokliteratur' => 'Dokumentiert in', '36_KFSA Doku.doksigle' => 'Sigle', '36_KFSA Doku.dokbandnrseite' => 'Bd./Nr./S.', '36_KFSA Doku.dokfaksimile' => 'Faksimile', '36_KFSA Doku.dokvollstaendig' => 'Vollständigkeit', '36_KFSA Doku.dokzusatzinfo' => 'A Zusatzinfos', '36_Link Druck.url_titel_druck' => 'Titel/Bezeichnung', '36_Link Druck.url_image_druck' => 'Link zu Online-Dokument', '36_Link Hand.url_titel_hand' => 'Titel/Bezeichnung', '36_Link Hand.url_image_hand' => 'Link zu Online-Dokument', '36_preasentation' => 'Nicht in die Präsentation', '36_verlag' => 'Verlag', '36_anhang_tite0' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename0' => 'Image', '36_anhang_tite1' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename1' => 'Image', '36_anhang_tite2' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename2' => 'Image', '36_anhang_tite3' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename3' => 'Image', '36_anhang_tite4' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename4' => 'Image', '36_anhang_tite5' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename5' => 'Image', '36_anhang_tite6' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename6' => 'Image', '36_anhang_tite7' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename7' => 'Image', '36_anhang_tite8' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename8' => 'Image', '36_anhang_tite9' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename9' => 'Image', '36_anhang_titea' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcenamea' => 'Image', '36_anhang_titeb' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcenameb' => 'Image', '36_anhang_titec' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcenamec' => 'Image', '36_anhang_tited' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcenamed' => 'Image', '36_anhang_titee' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcenamee' => 'Image', '36_anhang_titeu' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcenameu' => 'Image', '36_anhang_titev' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcenamev' => 'Image', '36_anhang_titew' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcenamew' => 'Image', '36_anhang_titex' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcenamex' => 'Image', '36_anhang_titey' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcenamey' => 'Image', '36_anhang_titez' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcenamez' => 'Image', '36_anhang_tite10' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename10' => 'Image', '36_anhang_tite11' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename11' => 'Image', '36_anhang_tite12' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename12' => 'Image', '36_anhang_tite13' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename13' => 'Image', '36_anhang_tite14' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename14' => 'Image', '36_anhang_tite15' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename15' => 'Image', '36_anhang_tite16' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename16' => 'Image', '36_anhang_tite17' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename17' => 'Image', '36_anhang_tite18' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename18' => 'Image', '36_h_preasentation' => 'Nicht in die Präsentation', '36_anhang_titef' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcenamef' => 'Image', '36_anhang_titeg' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcenameg' => 'Image', '36_anhang_titeh' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcenameh' => 'Image', '36_anhang_titei' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcenamei' => 'Image', '36_anhang_titej' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcenamej' => 'Image', '36_anhang_titek' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcenamek' => 'Image', '36_anhang_titel' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcenamel' => 'Image', '36_anhang_titem' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcenamem' => 'Image', '36_anhang_titen' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcenamen' => 'Image', '36_anhang_titeo' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcenameo' => 'Image', '36_anhang_titep' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcenamep' => 'Image', '36_anhang_titeq' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcenameq' => 'Image', '36_anhang_titer' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcenamer' => 'Image', '36_anhang_tites' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcenames' => 'Image', '36_anhang_titet' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcenamet' => 'Image', '36_anhang_tite19' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename19' => 'Image', '36_anhang_tite20' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename20' => 'Image', '36_anhang_tite21' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename21' => 'Image', '36_anhang_tite22' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename22' => 'Image', '36_anhang_tite23' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename23' => 'Image', '36_anhang_tite24' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename24' => 'Image', '36_anhang_tite25' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename25' => 'Image', '36_anhang_tite26' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename26' => 'Image', '36_anhang_tite27' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename27' => 'Image', '36_anhang_tite28' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename28' => 'Image', '36_anhang_tite29' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename29' => 'Image', '36_anhang_tite30' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename30' => 'Image', '36_anhang_tite31' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename32' => 'Image', '36_anhang_tite33' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename33' => 'Image', '36_anhang_tite34' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename34' => 'Image', '36_Relationen.relation_art' => 'Art', '36_Relationen.relation_link' => 'Interner Link', '36_volltext' => 'Brieftext (Digitalisat Leitdruck oder Transkript Handschrift)', '36_History.hisbearbeiter' => 'Bearbeiter', '36_History.hisschritt' => 'Bearbeitungsschritt', '36_History.hisdatum' => 'Datum', '36_History.hisnotiz' => 'Notiz', '36_personen' => 'Personen', '36_werke' => 'Werke', '36_orte' => 'Orte', '36_themen' => 'Themen', '36_briedfehlt' => 'Fehlt', '36_briefbestellt' => 'Bestellt', '36_intrans' => 'Transkription', '36_intranskorr1' => 'Transkription Korrektur 1', '36_intranskorr2' => 'Transkription Korrektur 2', '36_intranscheck' => 'Transkription Korr. geprüft', '36_intranseintr' => 'Transkription Korr. eingetr', '36_inannotcheck' => 'Auszeichnungen Reg. geprüft', '36_inkollation' => 'Auszeichnungen Kollationierung', '36_inkollcheck' => 'Auszeichnungen Koll. geprüft', '36_himageupload' => 'H/h Digis hochgeladen', '36_dimageupload' => 'D Digis hochgeladen', '36_stand' => 'Bearbeitungsstand (Webseite)', '36_stand_d' => 'Bearbeitungsstand (Druck)', '36_timecreate' => 'Erstellt am', '36_timelastchg' => 'Zuletzt gespeichert am', '36_comment' => 'Kommentar(intern)', '36_accessid' => 'Access ID', '36_accessidalt' => 'Access ID-alt', '36_digifotos' => 'Digitalisat Fotos', '36_imagelink' => 'Imagelink', '36_vermekrbehler' => 'Notizen Behler', '36_vermekrotto' => 'Anmerkungen Otto', '36_vermekraccess' => 'Bearb-Vermerke Access', '36_zeugenbeschreib' => 'Zeugenbeschreibung', '36_sprache' => 'Sprache', '36_accessinfo1' => 'Archiv H (+ Signatur)', '36_korrekturbd36' => 'Korrekturen Bd. 36', '36_druckbd36' => 'Druckrelevant Bd. 36', '36_digitalisath1' => 'Digitalisat_H', '36_digitalisath2' => 'Digitalisat_h', '36_titelhs' => 'Titel_Hs', '36_accessinfo2' => 'Archiv H (+ Signatur)', '36_accessinfo3' => 'Sigle (Dokumentiert in + Bd./Nr./S.)', '36_accessinfo4' => 'Sigle (Druck in + Bd./Nr./S.)', '36_KFSA Hand.hschreibstoff' => 'Schreibstoff', '36_Relationen.relation_anmerkung' => null, '36_anhang_tite35' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename35' => 'Image', '36_anhang_tite36' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename36' => 'Image', '36_anhang_tite37' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename37' => 'Image', '36_anhang_tite38' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename38' => 'Image', '36_anhang_tite39' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename39' => 'Image', '36_anhang_tite40' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename40' => 'Image', '36_anhang_tite41' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename41' => 'Image', '36_anhang_tite42' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename42' => 'Image', '36_anhang_tite43' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename43' => 'Image', '36_anhang_tite44' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename44' => 'Image', '36_anhang_tite45' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename45' => 'Image', '36_anhang_tite46' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename46' => 'Image', '36_anhang_tite47' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename47' => 'Image', '36_anhang_tite48' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename48' => 'Image', '36_anhang_tite49' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename49' => 'Image', '36_anhang_tite50' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename50' => 'Image', '36_anhang_tite51' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename51' => 'Image', '36_anhang_tite52' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename52' => 'Image', '36_anhang_tite53' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename53' => 'Image', '36_anhang_tite54' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename54' => 'Image', '36_KFSA Hand.hbeschreibung' => 'Beschreibung', '36_KFSA Kritanhang.krit_infotyp' => 'Infotyp', '36_KFSA Kritanhang.krit_infotext' => 'Infotext', '36_datumspezif' => 'Datum Spezifikation', 'index_orte_10' => 'Orte', 'index_orte_10.content' => 'Orte', 'index_orte_10.comment' => 'Orte (Kommentar)', 'index_personen_11' => 'Personen', 'index_personen_11.content' => 'Personen', 'index_personen_11.comment' => 'Personen (Kommentar)', 'index_werke_12' => 'Werke', 'index_werke_12.content' => 'Werke', 'index_werke_12.comment' => 'Werke (Kommentar)', 'index_periodika_13' => 'Periodika', 'index_periodika_13.content' => 'Periodika', 'index_periodika_13.comment' => 'Periodika (Kommentar)', 'index_sachen_14' => 'Sachen', 'index_sachen_14.content' => 'Sachen', 'index_sachen_14.comment' => 'Sachen (Kommentar)', 'index_koerperschaften_15' => 'Koerperschaften', 'index_koerperschaften_15.content' => 'Koerperschaften', 'index_koerperschaften_15.comment' => 'Koerperschaften (Kommentar)', 'index_zitate_16' => 'Zitate', 'index_zitate_16.content' => 'Zitate', 'index_zitate_16.comment' => 'Zitate (Kommentar)', 'index_korrespondenzpartner_17' => 'Korrespondenzpartner', 'index_korrespondenzpartner_17.content' => 'Korrespondenzpartner', 'index_korrespondenzpartner_17.comment' => 'Korrespondenzpartner (Kommentar)', 'index_archive_18' => 'Archive', 'index_archive_18.content' => 'Archive', 'index_archive_18.comment' => 'Archive (Kommentar)', 'index_literatur_19' => 'Literatur', 'index_literatur_19.content' => 'Literatur', 'index_literatur_19.comment' => 'Literatur (Kommentar)', 'index_kunstwerke_kfsa_20' => 'Kunstwerke KFSA', 'index_kunstwerke_kfsa_20.content' => 'Kunstwerke KFSA', 'index_kunstwerke_kfsa_20.comment' => 'Kunstwerke KFSA (Kommentar)', 'index_druckwerke_kfsa_21' => 'Druckwerke KFSA', 'index_druckwerke_kfsa_21.content' => 'Druckwerke KFSA', 'index_druckwerke_kfsa_21.comment' => 'Druckwerke KFSA (Kommentar)', '36_fulltext' => 'XML Volltext', '36_html' => 'HTML Volltext', '36_publicHTML' => 'HTML Volltext', '36_plaintext' => 'Volltext', 'transcript.text' => 'Transkripte', 'folders' => 'Mappen', 'notes' => 'Notizen', 'notes.title' => 'Notizen (Titel)', 'notes.content' => 'Notizen', 'notes.category' => 'Notizen (Kategorie)', 'key' => 'FuD Schlüssel' ) ) $html = '[1] [<span class="index-887 tp-99166 ">Bonn</span>,] 19. Januar 1820.<br><span class="doc-3500 ">Ihren Brief vom 8. Januar</span> erhielt ich vor einigen Tagen, mein teurer und hochverehrter Freund, und eile zuvörderst, Ihren freundschaftlichen Vorwürfen zu begegnen. Meine Gesinnungen gegen Sie können sich nie ändern. Ich werde Ihnen zeitlebens dankbar sein für die freundschaftliche Wärme, womit Sie zu meiner Hilfe herbeigeeilt sind, als ich in <span class="index-898 tp-99167 ">Auxerre</span> krank lag: <span class="cite tp-54866 ">ich erzähle es gern, daß Sie mich damals den Klauen ungeschickter Ärzte, oder was einerlei ist, dem Tode entrissen haben</span>. Aber ich fand nicht bloß eine Befriedigung des Herzens in Ihrem Wohlwollen, Ihr Umgang gewährte mir den lebhaftesten Genuß, und die Tage, die ich mit Ihnen in <span class="index-171 tp-99168 ">Paris</span>, auf dem Lande, in der Schweiz, oder wo es sein mochte, zugebracht, gehören zu meinen angenehmsten Erinnerungen.<br>Immer freute ich mich, in Ihnen den witzigen Gesellschafter, den geistreichen Beobachter der Welt, den ideenreichen Forscher wiederzufinden und meinen Geist durch Ihre Mitteilungen anzuregen. Als ich im Jahre 1817 <span class="index-222 tp-99170 ">einen unersetzlichen Verlust</span> erlitten hatte, als die Auflösung eines Verhältnisses ohnegleichen durch den Tod mir eine unerwünschte Freiheit wiedergab, habe ich in Ihren Einladungen zur Rückkehr nach Deutschland aufs neue Ihren freundschaftlichen Eifer erkannt. Bei unserem Zusammentreffen in <span class="index-1591 tp-99169 ">Koblenz</span> und in Bonn glaubte ich von Ihrer Seite einige Zurückhaltung [2] zu bemerken und vermied es, diese Grenze zu durchbrechen. Seitdem ist, soviel ich weiß, keine Botschaft von Ihnen zu mir gelangt, sonst wäre sie nicht unerwidert geblieben. Sie kennen meine alte Nachlässigkeit im Briefschreiben: es ist ein Familienfehler, den sogar <span class="index-8 tp-99171 ">mein Bruder</span> mir zugute halten muß, so wie ich ihm. Überdies, was hätte ich Ihnen, der Sie in mannigfaltigen und bedeutenden Weltverhältnissen leben, aus meiner wissenschaftlichen Eingezogenheit Unterhaltendes melden können? Dazu kam, daß ich seit meiner Ankunft in Bonn sehr häufig verstimmt war, und zwar durch einen Verdruß der Art, wovon man nicht gern redet. Dies führt mich auf die Verleumdungen, deren Sie erwähnen. Sie können, mein teurer Freund, keine sehr schweren Kämpfe zu bestehen gehabt haben, denn die lügenhafte Abgeschmacktheit dieser Verleumdungen mußte jedem Unbefangenen in die Augen springen. Vergebens habe ich <span class="index-243 tp-99173 index-186 tp-99172 index-2402 tp-99174 ">die Urheber</span> durch die geringschätzigste Zurückweisung ihrer Zumutungen aufgefordert, ans Licht hervorzutreten, um mir alsdann volle Genugtuung zu schaffen. Sie haben sich wohl davor gehütet. Sie hatten mit bleiernen Pfeilen auf eine stählerne Rüstung geschossen. Das flüchtige Aufsehen ist längst in tiefe Vergessenheit begraben, ich genieße aus der Ferne und Nähe der gewohnten Achtung. Übrigens waren in Berlin zwei verehrte Freunde von mir, <span class="index-2429 tp-99175 ">der General v. Müffling</span> und <span class="index-276 tp-99176 ">der Staatsrat Hufeland</span>, näher von der Sache unterrichtet und werden [3] wohl gelegentlich das Nötige gesagt haben. Wenn es Sie interessieren kann, will ich Sie ein andermal davon unterhalten: mir ist es nun schon gleichgültig geworden, aber es bleibt immer eine seltsam merkwürdige Geschichte.<br>Sie sehen, daß ich das Bedürfnis habe, zu Ihnen im vollen Vertrauen der Freundschaft zu reden. Aber kommen wir nach dieser schon allzu langen Vorrede auf die Hauptsache. Auch hier muß ich zuvörderst einige irrige Annahmen aus dem Wege räumen, die ich in Ihrem Briefe bemerke.<br>Ich gebe Ihnen mein Ehrenwort, daß ich den getanen Schritt mit niemandem verabredet, noch viel weniger mich dazu verbindlich gemacht [habe]. Der Entschluß ist ganz aus mir selbst hervorgegangen. Sollte in einer Stelle Ihres Briefes, was ich kaum glauben kann, <span class="index-2323 tp-99177 ">unser allgemein geliebter und verehrter, leider ehemaliger Kurator</span> gemeint sein, so kann ich versichern, daß er, wiewohl es ihn geschmerzt hat, sich für jetzt von <span class="index-6155 tp-99178 ">der Universität</span> zu trennen, den aufrichtigsten Anteil an ihrem fortwährenden Gedeihen nimmt, und daß er, in der Voraussetzung, ich könnte im Sinne haben, mich von dem Lehramte zurückzuziehen, mir die dringendsten Gründe entgegengestellt hat. Ich habe die Sache ganz als meine Privatangelegenheit behandelt, ich habe mich nur wenigen Freunden im engsten Vertrauen [4] eröffnet, ich habe fortgefahren, <span class="index-2452 tp-99223 index-3452 tp-99220 index-4972 tp-99224 index-2435 tp-99221 index-3730 tp-99225 index-4965 tp-99226 index-3511 tp-99227 index-2475 tp-99228 ">meine Vorlesungen</span> mit dem gewohnten Fleiße zu geben, und das hiesige Publikum hat erst aus dem Berlinischen Zeitungsartikel etwas erfahren. Aber auch jetzt weiche ich den deshalb an mich geschehenden Anfragen durch unbestimmte Äußerungen aus. <br>Ferner muß ich erklären, daß der Aufenthalt in Bonn mir keineswegs mißfällt, sondern daß ich vielmehr eine große Neigung dazu gefaßt habe. Die heitere Gegend, das milde Klima, die bequeme Lage zu kleinen und großen Reisen, das freundschaftliche Verhältnis mit meinen Amtsgenossen, die gesellige Ungezwungenheit, selbst Beschränktheit einer kleinen Stadt sagten mir zu. Dazu kommt nun, daß ich meine gelehrten Vorräte nicht ohne Mühe und Kosten um mich her versammelt und mich angenehm eingerichtet habe. Ich hatte es recht eigentlich darauf angelegt, in meinem Hause einen literarischen Zirkel zu bilden. Ich hege keine Abneigung gegen <span class="index-15 tp-99179 ">Berlin</span>, das ich ja von alter Zeit kenne. Nur scheute ich das rauhere Klima und die weite Entfernung von meinen Freunden in Frankreich. Auch glaubte ich den geselligen Anforderungen dort nicht ausweichen zu können, und meine Gesundheit sowohl als meine weit aussehenden Forschungen fordern eine von den Zerstreuungen der großen Welt ungestörte Ruhe. <br>[5] Ich habe ja selbst um die Verlängerung meines hiesigen Aufenthalts bis zum nächsten Herbst angehalten, und <span class="index-5440 tp-99180 ">das Ministerium</span> hat die Gnade gehabt, mein Gesuch zu bewilligen. Ich hoffte in der Folge, vielleicht mit dem Vorbehalt, eine Reihe von Vorlesungen in Berlin zu geben, meine definitive Bestimmung für Bonn auszuwirken. Hier fand ich eine besonders erfreuliche Sphäre gelehrter Tätigkeit, wo man die Früchte seines Fleißes gleichsam vor seinen Augen wachsen und reifen sehen konnte. Es war ein herrlicher Gedanke, hier am Rheine gründliche deutsche Bildung und Liebe dazu zu verbreiten. Sie haben recht, teuerster Freund, <span class="index-12214 tp-99181 ">die kgl. preußische Regierung</span> hat unendlich viel für Kunst und Wissenschaft getan, und die Stiftung von Bonn war ein echt vaterländisches Ereignis. Die Wahl des Ortes war die glücklichste: die königliche Freigebigkeit <span class="index-515 tp-99182 ">des Monarchen</span>, die weise Sorgfalt des Ministeriums können nicht genug gepriesen werden. Ich war stolz darauf, Fremden, die mich besuchten, dem Grafen Montlosier, <span class="index-2321 tp-99183 ">dem Herzog von Richelieu</span>, <span class="index-1386 tp-99184 ">dem Grafen Reinhard</span>, den großen Umfang und die Vortrefflichkeit der neuen Anstalt darlegen zu können. Ich brachte sie zu dem Geständnis, daß es in Frankreich, wenigstens außer Paris, nichts Ähnliches gebe. Ich lege Ihnen einen Brief des Herzogs von Richelieu bei, den er mir kurz nach seinem Besuche schrieb. <br>Wenn viel für uns [6] geschehen war, so haben wir uns auch unsererseits wacker gerührt. Vierhundert Studierende, darunter eine große Anzahl schon gebildeter junger Männer aus allen Gegenden Deutschlands, im ersten Jahre nach der Stiftung: das ist in den Annalen der Universitäten unerhört. Ich gebe diesen Winter eine öffentliche Vorlesung vor zweihundert Zuhörern. ‒ Wenn es ungestört so fortgegangen wäre, so hätten wir in einigen Jahren an Frequenz und Ruhm auch im Auslande, mit <span class="index-6154 tp-99186 index-2 tp-99185 ">Göttingen</span> wetteifern mögen. <br>Freilich, es ist ein Großes, wenn der Staat Aufwand für wissenschaftliche Anstalten macht, den Gelehrten ihre Existenz reichlich sichert. Aber diese Wohltaten verlieren ihre Kraft, wenn nicht noch eine, die höchste hinzukommt: ehrenvolle Auszeichnungen, aufmunternde Beweise des Wohlwollens von seiten der Regierung. Der akademische Lehrer insbesondere kann das Zutrauen nicht entbehren. Und dieses Zutrauen haben wir nun durch eine unglückliche Konstellation verwirkt, ich weiß nicht wie; wenigstens scheinen mir die Anlässe in gar keinem Verhältnisse mit den Folgen zu stehen. Von einem großen Staatenverein ist das Anathema ausgesprochen worden. Der Widerhall davon ist durch Europa erschollen, und wir mögen nun bald in amerikanischen Zeitungsblättern lesen, daß wir, sämtlich oder großenteils, Verführer der Jugend sind. Doch ich will auf das, was die deutschen Universitäten im allgemeinen seit <span class="index-19747 tp-99200 index-3392 tp-99201 ">der Schrift</span> von <span class="index-2427 tp-99192 ">Stourdza</span> betroffen hat, nicht eingehen. Mein Brief würde zum Buche [7] werden, Sie würden meiner Ansicht Ihre Gründe entgegenstellen, und am Ende würde vielleicht keiner den anderen überzeugen. Ich beschränke mich auf meine eigene Angelegenheit. Zu dem getanen Schritte hat mich nichts anderes bewogen als die Überzeugung, wovon ich auch jetzt nicht weichen kann, daß das Amt, wozu ich vor anderthalb Jahren so ehrenvoll berufen wurde, nicht mehr dasselbe ist, daß es durch die neuen Einrichtungen seine wesentlichsten Vorrechte, seine Annehmlichkeit und seine Würde verloren hat. <br>Sie erlassen mir wohl den Beweis, sonst bin ich erbötig, ihn nachdrücklich zu führen. <br>Aber Sie sagen mir, die notwendig befundenen Vorkehrungsmaßregeln seien nicht gegen Gelehrte von meinem Charakter gemeint. Es ist wahr, ich habe nie den Ehrgeiz gehabt, eine politische Rolle zu spielen, weder als Schriftsteller, noch auf andere Art: sonst hätte ich nicht so manche günstige Gelegenheit vorbeigehen lassen. Ein einziges Mal habe ich meinen Namen eingezeichnet, das war in der allgemeinen Sache des Vaterlandes, in dem europäischen Kampfe für die Selbständigkeit der Staaten. Ich bin es seit langen Jahren gewohnt, in der Mitte politischer Gärungen als ruhiger Zuschauer zu stehen, nur eine mäßigende und vermittelnde Stimme hören zu lassen und mit Menschen von allen Parteien in freundlichem Verhältnisse zu bleiben. Noch am Tage meiner Abreise [8] von Paris <span class="doc-4754 ">schrieb mir </span><span class="doc-4754 index-631 tp-99202 ">Herr von Chateaubriand</span>, ich sei dazu berufen, die Geschichte Frankreichs im Mittelalter zu schreiben. Allein das in Deutschland erwachte Mißtrauen gegen die Gelehrten und Schriftsteller überhaupt liegt am Tage; und ein solches Mißtrauen ist nicht wie eine gewöhnliche Flamme, welche erlischt, wenn der Nahrungsstoff erschöpft ist: es phosphoresziert nur um so heller in luftleerem Raume. Wenn der Verdacht sich auf Meinungen, auch auf nicht ausgesprochene, richtet, kann ich sicher sein, daß die Meinungen des Verfassers <span class="index-3369 tp-99203 ">der Schrift „</span><span class="index-3369 tp-99203 weight-bold ">Sur le système continental</span><span class="index-3369 tp-99203 ">“</span> und <span class="index-11635 tp-99204 ">einiger anderer politischer Schriften</span> im Jahre 1813, des vieljährigen Freundes <span class="index-222 tp-99206 ">der Frau von Staël</span>, des Mitherausgebers <span class="index-2409 tp-99208 ">ihres nachgelassenen Werkes</span> (ich will Sie geflissentlich an alles erinnern), immer unverdächtig scheinen werden? <br>Mit dem besten Willen kam ich nach Deutschland. Meine Freunde in Frankreich ließen mich ungern von sich und würden mich mit offenen Armen wieder aufnehmen. Sie wissen, daß ich dort sehr angenehme Verhältnisse habe, und wenn ich bloß meine Neigung befragt hätte, so wäre ich wohl immer da geblieben. Aber es schien mir vielleicht rühmlicher, gewiß verdienstlicher und berufsgemäßer, meine Kräfte zum Nutzen des Vaterlandes zu verwenden. Ich fand alles in scheinbar tiefer Ruhe. Plötzlich ist ein Ungewitter aufgezogen, aus einem Wölkchen, wie das war, welches der Prophet Elias am Horizont erblickte. Mein erster [9] Gedanke war, ein Obdach zu suchen. Glauben Sie mir, ich bilde mir nicht ein, zu irgend etwas notwendig zu sein: meine Entfernung vom öffentlichen Unterricht würde keine merkliche Lücke verursachen. Mein Fach gehört zu den entbehrlichen, für die nur dann Begünstigung zu hoffen ist, wenn bei vollkommen heiterer Stimmung auch an äußere Verzierung gedacht wird. Der Inhalt Ihres Briefes war mir daher etwas ganz Unerwartetes. <br>Sie bezeugen mir die unendlich ehrenvolle Hochschätzung <span class="index-553 tp-99209 ">des Fürsten Staatskanzlers</span>: ich bitte Sie, den Ausdruck meiner ehrerbietigsten Gesinnungen und meiner Dankbarkeit vor Se. Durchlaucht zu bringen. Wenn ich die schmeichelhafte Überzeugung hegen darf, daß der Staatskanzler, daß <span class="index-2403 tp-99210 ">der Minister von Altenstein</span>, dessen Briefe ich als kostbare Beweise der Anerkennung aufbewahre, auf die Fortsetzung meiner wissenschaftlichen Tätigkeit im Dienste des Staats einigen Wert legen, so wirft das freilich ein bedeutendes Gewicht in die andere Wagschale.<br>Lassen Sie uns also miteinander überlegen, ob sich irgendein Ausweg finden läßt. Sie sagen mir, „die getroffenen Maßregeln werden mich auf keine Art unangenehm berühren, mein Leben und Wirken stehe da, vor jeder unfreundlichen Berührung geschützt, wie von einer Ägide, die kein Pfeil durchbohrt.“ Könnten Sie mir darüber eine amtliche Versicherung schaffen? Brief und Siegel? Das wäre ja gewissermaßen<br>[10] <span class="index-19749 tp-99212 ">„Ein eisern Privilegium,<br>Zu hexen frank und frei herum.“</span><br>Aber im Ernst, kann irgendein Einzelner billigerweise verlangen, daß zu seinen Gunsten eine Ausnahme gemacht werde von einer allgemeinen Maßregel, die so viele würdige Männer trifft? Sonst standen zwischen den Professoren und dem Ministerium nur die Kuratoren, Männer von erlauchter Geburt und in hohen Staatsämtern, deren Namen schon den Universitäten zur Zierde gereichte; und ihre Wirksamkeit war durchaus nicht hemmend, sondern eine fördernde und aufmunternde Fürsorge. Von spezieller Aufsicht war gar nicht die Rede; sie schien um so weniger nötig, da die Grundsätze der Lehrer vor ihrer Anstellung meist durch ihre Schriften bekannt waren. In dem unerhörten Fall, daß ein Lehrer sein Amt zu übeln Zwecken gemißbraucht hätte, kam es zunächst dem akademischen Senate zu, für die Ehre und Unbescholtenheit der Universität zu sorgen. Jetzt sind Aufseher in der Nähe hingestellt mit einer unbedingten und bisher beispiellosen Vollmacht. Wie ist einem solchen Verhältnis auszuweichen? Ich sehe nur ein einziges Mittel. Die Maßregel ist nur als transitorisch, das Verhältnis der Universitäten zu den Kuratoren nur als suspendiert angekündigt worden. Es käme also darauf an, einen speziellen wissenschaftlichen Auftrag auszumitteln, dessen Ausführung mich während [11] dieser Zeit hinlänglich beschäftigte, auch wenn ich einstweilen der gewöhnlichen Geschäfte eines akademischen Lehrers überhoben würde.<br>Einen solchen Auftrag wüßte ich wohl. Sogleich bei meiner Rückkehr in Deutschland habe ich mein Augenmerk darauf gerichtet; aber ich hegte nicht mehr die Hoffnung, jetzt, da die Bewegungen des Augenblicks die Gemüter ganz in Anspruch nehmen, Begünstigung dafür zu finden. Sie erregen diese Hoffnung von neuem, indem Sie mir sagen, der preußische Staat werde auch jetzt fortfahren, väterlich und liberaler als jeder andre für das Gedeihen der Wissenschaft und Kunst zu sorgen.<br>Mein Wunsch wäre nämlich, das Studium des Sanskrit und der indischen Literatur überhaupt in Deutschland auf eine gründliche Art einheimisch zu machen. Das große gelehrte Interesse der Sache brauche ich Ihnen nicht auseinanderzusetzen: Sie sind im Besitz aller darauf bezüglichen Ideen. Ich lege <span class="index-2555 tp-99233 ">einen Aufsatz</span> bei, wodurch ich die Gönner der Wissenschaften in Berlin aufmerksam zu machen gesucht habe, er ist <span class="index-3471 tp-99232 ">den Bonnischen Jahrbüchern</span> eingerückt worden.<br>Noch will ich erinnern, daß nicht nur in Paris ein eigner Lehrstuhl für das Sanskrit errichtet ist, sondern daß ein deutscher Gelehrter, <span class="index-2426 tp-99214 ">Fr. Bopp</span>, mit Unterstützung <span class="index-11752 tp-99218 ">der bayerischen Regierung</span>, und, auf meine Empfehlung, insbesondere <span class="index-634 tp-99217 ">des Kronprinzen von Bayern</span>, seit einer Anzahl von Jahren in Paris, jetzt in <span class="index-292 tp-99215 ">London</span>, einzig zu diesem Zwecke studiert und das Versprechen [12] einer Professur in <span class="index-230 tp-99216 ">Würzburg</span> erhalten hat. Er hat jetzt einen indischen Text in London sehr lobenswert herausgegeben, worüber ich nächstens eine Beurteilung drucken lassen werde. In Göttingen ist noch nichts geschehen, doch steht es über kurz oder lang zu erwarten, da die Verhältnisse mit England es dort besonders erleichtern.<br>Wenn man also, wie billig, bei keiner Erweiterung der Wissenschaft zurückbleiben will, so wäre es nötig, auf irgendeiner der preußischen Universitäten etwas für das Studium der indischen Literatur zu tun. Ich glaube, es würde für Bonn keine gleichgültige Auszeichnung sein, wenn man hier die Hilfsmittel des Sanskrit, die ich schon großenteils besitze, beisammen fände; wenn man in der Folge auch Elementarbücher und indische Texte drucken könnte. Die Lage ist besonders günstig wegen der Nähe von London und Paris, wo allein indische Manuskripte sind. Einige außerordentliche Unterstützung wäre erforderlich, aber sie würde nicht unerschwinglich sein, keineswegs außer Verhältnis mit dem, was das hohe Ministerium für andre auch nicht ganz notwendige Studien so freigebig bewilligt hat.<br>Diesen Lieblingsplan hatte ich nun schon völlig aufgegeben, als ich vor sechs Wochen nach Berlin schrieb. Ich überlasse es Ihnen, mein teuerster Freund, ob Sie den Versuch wagen wollen, der Sache Eingang zu verschaffen. Auf erhaltenen Befehl würde ich sogleich <span class="index-2403 tp-99236 ">dem Minister [13] des öffentlichen Unterrichts</span> einen ins einzelne gehenden Plan vorlegen.<br>Ich weiß wohl, daß die Ausführung mir eine Menge mühseliger und trockener Arbeiten auferlegen und daß ich einige Jahre hindurch alle Hände voll zu tun haben würde, statt daß ich, bei individueller Fortsetzung des Studiums, nur die Blüte davon pflücken und sie zu welthistorischen, philosophischen, dichterischen Zwecken benutzen könnte. Aber die Liebe zur Sache würde mir die Schwierigkeiten überwinden helfen. <br>Ich hoffe, Sie werden in diesen Äußerungen die Bereitwilligkeit erkennen, den Eröffnungen, die Sie mir von seiten eines erlauchten Gönners gemacht haben, entgegenzukommen. Eine Reise nach Berlin halte ich in dem gegenwärtigen Augenblick durchaus nicht für zweckmäßig.<br>Leben Sie recht wohl, mein teurer Freund, und erfreuen Sie mich bald mit einer Antwort. Denn nach dem getanen Schritte bin ich in der Lage jenes alten Ritters in einer spanischen Romanze:<br>„Schon den einen Fuß im Bügel.“<br>Und um einen neuen Lebensplan auszuführen, müssen doch mancherlei Anstalten getroffen werden.<br>[14]<br>[15]<br>[16]' $isaprint = true $isnewtranslation = false $statemsg = 'betamsg13' $cittitle = '' $description = 'August Wilhelm von Schlegel an Johann Ferdinand Koreff am 19.01.1820, Bonn' $adressatort = 'Unknown' $absendeort = 'Bonn <a class="gndmetadata" target="_blank" href="http://d-nb.info/gnd/1001909-1">GND</a>' $date = '19.01.1820' $adressat = array( (int) 3113 => array( 'ID' => '3113', 'project' => '1', 'timecreate' => '2013-11-05 16:09:39', 'timelastchg' => '2017-12-20 18:27:53', 'key' => 'AWS-ap-00bu', 'docTyp' => array( 'name' => 'Person', 'id' => '39' ), '39_gebdatum' => '1783-02-01', '39_toddatum' => '1851-05-15', '39_name' => 'Koreff, Johann Ferdinand', '39_geschlecht' => 'm', '39_lebenwirken' => 'Geheimrat, Arzt, Schriftsteller Johann Ferdinand Korreff absolvierte ein Studium der Medizin in Halle und Berlin. 1803 kam Korreff zur klinischen Ausbildung nach Berlin, wo er bald Anschluss an den frühromantischen Kreis um Karl August Varnhagen von Ense fand. Anschließend war er als niedergelassener Arzt in Paris tätig, bis er 1811 Marquise Delphine de Custine als deren Leibarzt auf ihren Reisen nach Italien und in die Schweiz begleitete. Dort lernte er Karl August von Hardenberg kennen, als dessen Leibarzt er nach Berlin kam. 1816 wurde er dort Professor der Medizin und Chirurgie an der Berliner Universität und zwei Jahre später zum Regierungsrat ernannt. Korreff befasste sich mit der Theorie des Magnetismus. Als Mitglied der Akademie der Naturforschung Leopoldina veröffentlichte er neben naturphilosophischen auch literarische Schriften. Seine jüdische Herkunft und die Tatsache, dass er in der Gunst des Kanzlers Hardenberg stand, ließen ihn zum Opfer einer Intrige werden. Er ging nach Paris, wo er insbesondere die Rezeption der Werke E.T.A. Hoffmanns anstieß und sich erneut als Arzt zu etablieren versuchte.', '39_dbid' => '118777831 ', '39_pdb' => 'GND', '39_geburtsort' => array( 'ID' => '1018', 'content' => 'Breslau', 'bemerkung' => 'GND:2005949-8', 'LmAdd' => array([maximum depth reached]) ), '39_sterbeort' => array( 'ID' => '171', 'content' => 'Paris', 'bemerkung' => 'GND:4044660-8', 'LmAdd' => array([maximum depth reached]) ), '39_quellen' => 'NDB@https://www.deutsche-biographie.de/gnd118777831.html#ndbcontent@ WBIS@http://db.saur.de/WBIS/basicSearch.jsf@D437-122-X@ extern@Roger Paulin: August Wilhelm Schlegel. Cosmopolitan of Art and Poetry. Cambridge 2016, S. 581.@ Wikipedia@https://de.wikipedia.org/wiki/David_Ferdinand_Koreff@', '39_beziehung' => 'Koreff behandelte August Wilhelm Schlegel als Arzt. Später beförderte er maßgeblich die Gründung der Bonner Universität und setzte sich persönlich für die Berufung Schlegels ein.', '39_namevar' => 'Koreff, Johann David Ferdinand Koreff, David Johann Koreff, David Ferdinand (M) Koreff, David Koreff, F.', '39_status_person' => 'Vollständig', '39_sourcename0' => 'AWS-ap-00bu-0.jpg', 'folders' => array( (int) 0 => 'Personen', (int) 1 => 'Personen' ), '_label' => '', '_descr' => '', '_model' => 'Person', '_model_title' => 'Person', '_model_titles' => 'People', '_url' => '' ) ) $adrCitation = 'Johann Ferdinand Koreff' $absender = array() $absCitation = 'August Wilhelm von Schlegel' $percount = (int) 2 $notabs = false $tabs = array( 'text' => array( 'content' => 'Volltext Handschrift', 'exists' => '1' ), 'manuscript' => array( 'exists' => '1', 'content' => 'Digitalisat Handschrift' ), 'related' => array( 'data' => array( (int) 7488 => array( [maximum depth reached] ), (int) 7507 => array( [maximum depth reached] ) ), 'exists' => '1', 'content' => 'Zugehörige Dokumente' ) ) $parallelview = array( (int) 0 => '1', (int) 1 => '1', (int) 2 => '1' ) $dzi_imagesHand = array( (int) 0 => '/cake_fud/files/temp/images/dzi/b5b763a2cd8dcda28a9301bc32bf5b06.jpg.xml', (int) 1 => '/cake_fud/files/temp/images/dzi/a57d539f54870867fc4efd8a20bccea9.jpg.xml', (int) 2 => '/cake_fud/files/temp/images/dzi/c97e2b58fdbda94bc0df5159b94edd33.jpg.xml', (int) 3 => '/cake_fud/files/temp/images/dzi/c5bdd4a915da1ee380931aeb4848ddef.jpg.xml', (int) 4 => '/cake_fud/files/temp/images/dzi/8f25e541d1045f425a282d928f86ba92.jpg.xml', (int) 5 => '/cake_fud/files/temp/images/dzi/86e9174dee01b392cb5205b0059c828e.jpg.xml', (int) 6 => '/cake_fud/files/temp/images/dzi/5d1247ba92f742214fe91bfa26b63cdd.jpg.xml', (int) 7 => '/cake_fud/files/temp/images/dzi/ac3357b5a7129617dca211071626d3ce.jpg.xml', (int) 8 => '/cake_fud/files/temp/images/dzi/0efd948a1d65e91f390490c0be2a3fa4.jpg.xml', (int) 9 => '/cake_fud/files/temp/images/dzi/1c1e2b7e45904bb0a071b4c6895a7c32.jpg.xml', (int) 10 => '/cake_fud/files/temp/images/dzi/4c7fbb3568f0415a0fbcd0be23a9cf0e.jpg.xml', (int) 11 => '/cake_fud/files/temp/images/dzi/c20ffe87f86372becd87d88dbc89a1a7.jpg.xml', (int) 12 => '/cake_fud/files/temp/images/dzi/bb91f61e61b1aaa719b5ad5385958c4d.jpg.xml', (int) 13 => '/cake_fud/files/temp/images/dzi/a414f3897afba53a995cb160e3411284.jpg.xml', (int) 14 => '/cake_fud/files/temp/images/dzi/f40028f1906e530ba66c753826864d51.jpg.xml', (int) 15 => '/cake_fud/files/temp/images/dzi/76fc9363be063aad87c6ebd7da78948b.jpg.xml' ) $dzi_imagesDruck = array() $indexesintext = array( 'Namen' => array( (int) 0 => array( 'ID' => '2426', 'indexID' => '11', 'indexContent' => 'Personen', 'content' => 'Bopp, Franz', 'comment' => array( [maximum depth reached] ), 'parentID' => '0', 'altBegriff' => '', 'LmAdd' => array( [maximum depth reached] ), 'textpassagen' => array([maximum depth reached]) ), (int) 1 => array( 'ID' => '631', 'indexID' => '11', 'indexContent' => 'Personen', 'content' => 'Chateaubriand, François-René de ', 'comment' => array( [maximum depth reached] ), 'parentID' => '0', 'altBegriff' => '', 'LmAdd' => array( [maximum depth reached] ), 'textpassagen' => array([maximum depth reached]) ), (int) 2 => array( 'ID' => '515', 'indexID' => '11', 'indexContent' => 'Personen', 'content' => 'Friedrich Wilhelm III., Preußen, König', 'comment' => array( [maximum depth reached] ), 'parentID' => '0', 'altBegriff' => '', 'LmAdd' => array( [maximum depth reached] ), 'textpassagen' => array([maximum depth reached]) ), (int) 3 => array( 'ID' => '553', 'indexID' => '11', 'indexContent' => 'Personen', 'content' => 'Hardenberg, Karl August von', 'comment' => array( [maximum depth reached] ), 'parentID' => '0', 'altBegriff' => '', 'LmAdd' => array( [maximum depth reached] ), 'textpassagen' => array([maximum depth reached]) ), (int) 4 => array( 'ID' => '276', 'indexID' => '11', 'indexContent' => 'Personen', 'content' => 'Hufeland, Christoph Wilhelm von', 'comment' => array( [maximum depth reached] ), 'parentID' => '0', 'altBegriff' => '', 'LmAdd' => array([maximum depth reached]), 'textpassagen' => array([maximum depth reached]) ), (int) 5 => array( 'ID' => '634', 'indexID' => '11', 'indexContent' => 'Personen', 'content' => 'Ludwig I., Bayern, König', 'comment' => array( [maximum depth reached] ), 'parentID' => '0', 'altBegriff' => '', 'LmAdd' => array( [maximum depth reached] ), 'textpassagen' => array([maximum depth reached]) ), (int) 6 => array( 'ID' => '2429', 'indexID' => '11', 'indexContent' => 'Personen', 'content' => 'Müffling, Friedrich Carl Ferdinand von', 'comment' => array( [maximum depth reached] ), 'parentID' => '0', 'altBegriff' => '', 'LmAdd' => array([maximum depth reached]), 'textpassagen' => array([maximum depth reached]) ), (int) 7 => array( 'ID' => '243', 'indexID' => '11', 'indexContent' => 'Personen', 'content' => 'Paulus, Caroline', 'comment' => array( [maximum depth reached] ), 'parentID' => '0', 'altBegriff' => '', 'LmAdd' => array( [maximum depth reached] ), 'textpassagen' => array([maximum depth reached]) ), (int) 8 => array( 'ID' => '186', 'indexID' => '11', 'indexContent' => 'Personen', 'content' => 'Paulus, Heinrich Eberhard Gottlob ', 'comment' => array( [maximum depth reached] ), 'parentID' => '0', 'altBegriff' => '', 'LmAdd' => array( [maximum depth reached] ), 'textpassagen' => array([maximum depth reached]) ), (int) 9 => array( 'ID' => '1386', 'indexID' => '11', 'indexContent' => 'Personen', 'content' => 'Reinhard, Karl Friedrich', 'comment' => array( [maximum depth reached] ), 'parentID' => '0', 'altBegriff' => '', 'LmAdd' => array( [maximum depth reached] ), 'textpassagen' => array([maximum depth reached]) ), (int) 10 => array( 'ID' => '2321', 'indexID' => '11', 'indexContent' => 'Personen', 'content' => 'Richelieu, Armand Emmanuel DuPlessis de ', 'comment' => array( [maximum depth reached] ), 'parentID' => '0', 'altBegriff' => '', 'LmAdd' => array([maximum depth reached]), 'textpassagen' => array([maximum depth reached]) ), (int) 11 => array( 'ID' => '8', 'indexID' => '11', 'indexContent' => 'Personen', 'content' => 'Schlegel, Friedrich von', 'comment' => array( [maximum depth reached] ), 'parentID' => '0', 'altBegriff' => '', 'LmAdd' => array( [maximum depth reached] ), 'textpassagen' => array([maximum depth reached]) ), (int) 12 => array( 'ID' => '2402', 'indexID' => '11', 'indexContent' => 'Personen', 'content' => 'Schlegel, Sophie von', 'comment' => array( [maximum depth reached] ), 'parentID' => '0', 'altBegriff' => '', 'LmAdd' => array( [maximum depth reached] ), 'textpassagen' => array([maximum depth reached]) ), (int) 13 => array( 'ID' => '2323', 'indexID' => '11', 'indexContent' => 'Personen', 'content' => 'Solms-Laubach, Friedrich Ludwig Christian zu ', 'comment' => array( [maximum depth reached] ), 'parentID' => '0', 'altBegriff' => '', 'LmAdd' => array( [maximum depth reached] ), 'textpassagen' => array([maximum depth reached]) ), (int) 14 => array( 'ID' => '222', 'indexID' => '11', 'indexContent' => 'Personen', 'content' => 'Staël-Holstein, Anne Louise Germaine de', 'comment' => array( [maximum depth reached] ), 'parentID' => '0', 'altBegriff' => '', 'LmAdd' => array( [maximum depth reached] ), 'textpassagen' => array([maximum depth reached]) ), (int) 15 => array( 'ID' => '2427', 'indexID' => '11', 'indexContent' => 'Personen', 'content' => 'Sturdza, Aleksandr S.', 'comment' => array( [maximum depth reached] ), 'parentID' => '0', 'altBegriff' => '', 'LmAdd' => array([maximum depth reached]), 'textpassagen' => array([maximum depth reached]) ), (int) 16 => array( 'ID' => '2403', 'indexID' => '11', 'indexContent' => 'Personen', 'content' => 'Vom Stein Zum Altenstein, Karl ', 'comment' => array( [maximum depth reached] ), 'parentID' => '0', 'altBegriff' => '', 'LmAdd' => array( [maximum depth reached] ), 'textpassagen' => array([maximum depth reached]) ) ), 'Körperschaften' => array( (int) 0 => array( 'ID' => '11752', 'indexID' => '15', 'indexContent' => 'Koerperschaften', 'content' => 'Bayern. Bayerische Staatsregierung', 'comment' => array( [maximum depth reached] ), 'parentID' => '0', 'altBegriff' => '', 'LmAdd' => array([maximum depth reached]), 'textpassagen' => array([maximum depth reached]) ), (int) 1 => array( 'ID' => '6154', 'indexID' => '15', 'indexContent' => 'Koerperschaften', 'content' => 'Georg-August-Universität Göttingen', 'comment' => array( [maximum depth reached] ), 'parentID' => '0', 'altBegriff' => '', 'LmAdd' => array([maximum depth reached]), 'textpassagen' => array([maximum depth reached]) ), (int) 2 => array( 'ID' => '5440', 'indexID' => '15', 'indexContent' => 'Koerperschaften', 'content' => 'Preußen. Ministerium der Geistlichen, Unterrichts- und Medizinalangelegenheiten ', 'comment' => array( [maximum depth reached] ), 'parentID' => '0', 'altBegriff' => '', 'LmAdd' => array([maximum depth reached]), 'textpassagen' => array([maximum depth reached]) ), (int) 3 => array( 'ID' => '12214', 'indexID' => '15', 'indexContent' => 'Koerperschaften', 'content' => 'Preußen. Preußische Armee', 'comment' => array( [maximum depth reached] ), 'parentID' => '0', 'altBegriff' => '', 'LmAdd' => array([maximum depth reached]), 'textpassagen' => array([maximum depth reached]) ), (int) 4 => array( 'ID' => '6155', 'indexID' => '15', 'indexContent' => 'Koerperschaften', 'content' => 'Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn', 'comment' => array( [maximum depth reached] ), 'parentID' => '0', 'altBegriff' => '', 'LmAdd' => array([maximum depth reached]), 'textpassagen' => array([maximum depth reached]) ) ), 'Orte' => array( (int) 0 => array( 'ID' => '898', 'indexID' => '10', 'indexContent' => 'Orte', 'content' => 'Auxerre', 'comment' => array( [maximum depth reached] ), 'parentID' => '0', 'altBegriff' => '', 'LmAdd' => array([maximum depth reached]), 'textpassagen' => array([maximum depth reached]) ), (int) 1 => array( 'ID' => '15', 'indexID' => '10', 'indexContent' => 'Orte', 'content' => 'Berlin', 'comment' => array( [maximum depth reached] ), 'parentID' => '0', 'altBegriff' => '', 'LmAdd' => array([maximum depth reached]), 'textpassagen' => array([maximum depth reached]) ), (int) 2 => array( 'ID' => '887', 'indexID' => '10', 'indexContent' => 'Orte', 'content' => 'Bonn', 'comment' => array( [maximum depth reached] ), 'parentID' => '0', 'altBegriff' => '', 'LmAdd' => array([maximum depth reached]), 'textpassagen' => array([maximum depth reached]) ), (int) 3 => array( 'ID' => '2', 'indexID' => '10', 'indexContent' => 'Orte', 'content' => 'Göttingen', 'comment' => array( [maximum depth reached] ), 'parentID' => '0', 'altBegriff' => '', 'LmAdd' => array([maximum depth reached]), 'textpassagen' => array([maximum depth reached]) ), (int) 4 => array( 'ID' => '1591', 'indexID' => '10', 'indexContent' => 'Orte', 'content' => 'Koblenz', 'comment' => array( [maximum depth reached] ), 'parentID' => '0', 'altBegriff' => '', 'LmAdd' => array([maximum depth reached]), 'textpassagen' => array([maximum depth reached]) ), (int) 5 => array( 'ID' => '292', 'indexID' => '10', 'indexContent' => 'Orte', 'content' => 'London', 'comment' => array( [maximum depth reached] ), 'parentID' => '0', 'altBegriff' => '', 'LmAdd' => array([maximum depth reached]), 'textpassagen' => array([maximum depth reached]) ), (int) 6 => array( 'ID' => '171', 'indexID' => '10', 'indexContent' => 'Orte', 'content' => 'Paris', 'comment' => array( [maximum depth reached] ), 'parentID' => '0', 'altBegriff' => '', 'LmAdd' => array([maximum depth reached]), 'textpassagen' => array([maximum depth reached]) ), (int) 7 => array( 'ID' => '230', 'indexID' => '10', 'indexContent' => 'Orte', 'content' => 'Würzburg', 'comment' => array( [maximum depth reached] ), 'parentID' => '0', 'altBegriff' => '', 'LmAdd' => array([maximum depth reached]), 'textpassagen' => array([maximum depth reached]) ) ), 'Werke' => array( (int) 0 => array( 'ID' => '19749', 'indexID' => '12', 'indexContent' => 'Werke', 'content' => 'Bürger, Gottfried August: Der Raubgraf', 'comment' => array( [maximum depth reached] ), 'parentID' => '0', 'altBegriff' => '', 'LmAdd' => array([maximum depth reached]), 'textpassagen' => array([maximum depth reached]) ), (int) 1 => array( 'ID' => '2452', 'indexID' => '12', 'indexContent' => 'Werke', 'content' => 'Schlegel, August Wilhelm von: Crisis antiquissimae Romanorum historiae (Bonn WS 1818/19)', 'comment' => array( [maximum depth reached] ), 'parentID' => '0', 'altBegriff' => '', 'LmAdd' => array([maximum depth reached]), 'textpassagen' => array([maximum depth reached]) ), (int) 2 => array( 'ID' => '11635', 'indexID' => '12', 'indexContent' => 'Werke', 'content' => 'Schlegel, August Wilhelm von: Du système continental. In: Essais littéraires et historiques', 'comment' => array( [maximum depth reached] ), 'parentID' => '0', 'altBegriff' => '', 'LmAdd' => array([maximum depth reached]), 'textpassagen' => array([maximum depth reached]) ), (int) 3 => array( 'ID' => '3452', 'indexID' => '12', 'indexContent' => 'Werke', 'content' => 'Schlegel, August Wilhelm von: Geschichte der deutschen Sprache und Poesie (Bonn WS 1818/19)', 'comment' => array( [maximum depth reached] ), 'parentID' => '0', 'altBegriff' => '', 'LmAdd' => array([maximum depth reached]), 'textpassagen' => array([maximum depth reached]) ), (int) 4 => array( 'ID' => '4972', 'indexID' => '12', 'indexContent' => 'Werke', 'content' => 'Schlegel, August Wilhelm von: Geschichte der schönen Litteratur in Italien, Spanien Frankreich und England, vom Mittelalter bis auf die heutige Zeit (Bonn SS 1819)', 'comment' => array( [maximum depth reached] ), 'parentID' => '0', 'altBegriff' => '', 'LmAdd' => array([maximum depth reached]), 'textpassagen' => array([maximum depth reached]) ), (int) 5 => array( 'ID' => '2435', 'indexID' => '12', 'indexContent' => 'Werke', 'content' => 'Schlegel, August Wilhelm von: Geschichte der schönen Litteratur in Italien, Spanien Frankreich und England, vom Mittelalter bis auf die heutige Zeit (Bonn WS 1818/19)', 'comment' => array( [maximum depth reached] ), 'parentID' => '0', 'altBegriff' => '', 'LmAdd' => array([maximum depth reached]), 'textpassagen' => array([maximum depth reached]) ), (int) 6 => array( 'ID' => '3730', 'indexID' => '12', 'indexContent' => 'Werke', 'content' => 'Schlegel, August Wilhelm von: Römische Geschichte (Bonn SS 1819)', 'comment' => array( [maximum depth reached] ), 'parentID' => '0', 'altBegriff' => '', 'LmAdd' => array([maximum depth reached]), 'textpassagen' => array([maximum depth reached]) ), (int) 7 => array( 'ID' => '3369', 'indexID' => '12', 'indexContent' => 'Werke', 'content' => 'Schlegel, August Wilhelm von: Sur le système continental et sur ses rapports avec la Suède', 'comment' => array( [maximum depth reached] ), 'parentID' => '0', 'altBegriff' => '', 'LmAdd' => array([maximum depth reached]), 'textpassagen' => array([maximum depth reached]) ), (int) 8 => array( 'ID' => '4965', 'indexID' => '12', 'indexContent' => 'Werke', 'content' => 'Schlegel, August Wilhelm von: Theorie der bildenden Künste (Bonn WS 1819/20)', 'comment' => array( [maximum depth reached] ), 'parentID' => '0', 'altBegriff' => '', 'LmAdd' => array([maximum depth reached]), 'textpassagen' => array([maximum depth reached]) ), (int) 9 => array( 'ID' => '3511', 'indexID' => '12', 'indexContent' => 'Werke', 'content' => 'Schlegel, August Wilhelm von: Theorie und allgemeine Geschichte der bildenden Künste (Bonn SS 1819)', 'comment' => array( [maximum depth reached] ), 'parentID' => '0', 'altBegriff' => '', 'LmAdd' => array([maximum depth reached]), 'textpassagen' => array([maximum depth reached]) ), (int) 10 => array( 'ID' => '2475', 'indexID' => '12', 'indexContent' => 'Werke', 'content' => 'Schlegel, August Wilhelm von: Vorlesungen über das akademische Studium (Bonn WS 1819/20)', 'comment' => array( [maximum depth reached] ), 'parentID' => '0', 'altBegriff' => '', 'LmAdd' => array([maximum depth reached]), 'textpassagen' => array([maximum depth reached]) ), (int) 11 => array( 'ID' => '2555', 'indexID' => '12', 'indexContent' => 'Werke', 'content' => 'Schlegel, August Wilhelm von: Über den gegenwärtigen Zustand der Indischen Philologie', 'comment' => array( [maximum depth reached] ), 'parentID' => '0', 'altBegriff' => '', 'LmAdd' => array([maximum depth reached]), 'textpassagen' => array([maximum depth reached]) ), (int) 12 => array( 'ID' => '2409', 'indexID' => '12', 'indexContent' => 'Werke', 'content' => 'Staël-Holstein, Anne Louise Germaine de: Œuvres complètes', 'comment' => array( [maximum depth reached] ), 'parentID' => '0', 'altBegriff' => '', 'LmAdd' => array([maximum depth reached]), 'textpassagen' => array([maximum depth reached]) ), (int) 13 => array( 'ID' => '19747', 'indexID' => '12', 'indexContent' => 'Werke', 'content' => 'Sturdza, Aleksandr S.: Coup dʻoeil sur les universites de lʻAllemagne', 'comment' => array( [maximum depth reached] ), 'parentID' => '0', 'altBegriff' => '', 'LmAdd' => array([maximum depth reached]), 'textpassagen' => array([maximum depth reached]) ), (int) 14 => array( 'ID' => '3392', 'indexID' => '12', 'indexContent' => 'Werke', 'content' => 'Sturdza, Aleksandr S.: Mémoire sur lʼétat actuel de lʼAllemagne (1818)', 'comment' => array( [maximum depth reached] ), 'parentID' => '0', 'altBegriff' => '', 'LmAdd' => array([maximum depth reached]), 'textpassagen' => array([maximum depth reached]) ) ), 'Periodika' => array( (int) 0 => array( 'ID' => '3471', 'indexID' => '13', 'indexContent' => 'Periodika', 'content' => 'Jahrbuch der Preußischen Rhein-Universität', 'comment' => array( [maximum depth reached] ), 'parentID' => '0', 'altBegriff' => '', 'LmAdd' => array([maximum depth reached]), 'textpassagen' => array([maximum depth reached]) ) ) ) $right = '' $left = 'manuscript' $handschrift = array( 'Datengeber' => 'Dresden, Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitätsbibliothek', 'OAI Id' => 'DE-1a-33958', 'Signatur' => 'Mscr.Dresd.e.90,XIX,Bd.13,Nr.45', 'Blatt-/Seitenzahl' => '13 S. auf Doppelbl., hs. m. U.', 'Format' => '18,4 x 12,1 cm' ) $druck = array( 'Bibliographische Angabe' => 'Oppeln-Bronikowski, Friedrich von: David Ferdinand Koreff. Berlin u.a. 1928, S. 330‒339.', 'Verlag' => 'Gebrüder Paetel', 'Incipit' => '„[1] [Bonn,] 19. Januar 1820.<br>Ihren Brief vom 8. Januar erhielt ich vor einigen Tagen, mein teurer und hochverehrter Freund, und eile [...]“' ) $docmain = array( 'ID' => '3494', 'project' => '1', 'timecreate' => '2013-12-18 13:48:43', 'timelastchg' => '2020-01-30 16:38:39', 'key' => 'AWS-aw-02av', 'docTyp' => array( 'name' => 'Brief', 'id' => '36' ), 'index_orte_10' => array( (int) 0 => array( 'ID' => '898', 'indexID' => '10', 'indexContent' => 'Orte', 'content' => 'Auxerre', 'comment' => 'GND:1027687-7', 'parentID' => '0', 'altBegriff' => '', 'LmAdd' => array([maximum depth reached]), 'textpassagen' => array([maximum depth reached]) ), (int) 1 => array( 'ID' => '15', 'indexID' => '10', 'indexContent' => 'Orte', 'content' => 'Berlin', 'comment' => 'GND:2004272-3', 'parentID' => '0', 'altBegriff' => '', 'LmAdd' => array([maximum depth reached]), 'textpassagen' => array([maximum depth reached]) ), (int) 2 => array( 'ID' => '887', 'indexID' => '10', 'indexContent' => 'Orte', 'content' => 'Bonn', 'comment' => 'GND:1001909-1', 'parentID' => '0', 'altBegriff' => '', 'LmAdd' => array([maximum depth reached]), 'textpassagen' => array([maximum depth reached]) ), (int) 3 => array( 'ID' => '2', 'indexID' => '10', 'indexContent' => 'Orte', 'content' => 'Göttingen', 'comment' => 'GND:4021477-1', 'parentID' => '0', 'altBegriff' => '', 'LmAdd' => array([maximum depth reached]), 'textpassagen' => array([maximum depth reached]) ), (int) 4 => array( 'ID' => '1591', 'indexID' => '10', 'indexContent' => 'Orte', 'content' => 'Koblenz', 'comment' => 'GND:4031410-8', 'parentID' => '0', 'altBegriff' => '', 'LmAdd' => array([maximum depth reached]), 'textpassagen' => array([maximum depth reached]) ), (int) 5 => array( 'ID' => '292', 'indexID' => '10', 'indexContent' => 'Orte', 'content' => 'London', 'comment' => 'GND:4074335-4', 'parentID' => '0', 'altBegriff' => '', 'LmAdd' => array([maximum depth reached]), 'textpassagen' => array([maximum depth reached]) ), (int) 6 => array( 'ID' => '171', 'indexID' => '10', 'indexContent' => 'Orte', 'content' => 'Paris', 'comment' => 'GND:4044660-8', 'parentID' => '0', 'altBegriff' => '', 'LmAdd' => array([maximum depth reached]), 'textpassagen' => array([maximum depth reached]) ), (int) 7 => array( 'ID' => '230', 'indexID' => '10', 'indexContent' => 'Orte', 'content' => 'Würzburg', 'comment' => 'GND:4067037-5', 'parentID' => '0', 'altBegriff' => '', 'LmAdd' => array([maximum depth reached]), 'textpassagen' => array([maximum depth reached]) ) ), 'index_koerperschaften_15' => array( (int) 0 => array( 'ID' => '11752', 'indexID' => '15', 'indexContent' => 'Koerperschaften', 'content' => 'Bayern. Bayerische Staatsregierung', 'comment' => 'GND:2028481-0', 'parentID' => '0', 'altBegriff' => '', 'LmAdd' => array([maximum depth reached]), 'textpassagen' => array([maximum depth reached]) ), (int) 1 => array( 'ID' => '6154', 'indexID' => '15', 'indexContent' => 'Koerperschaften', 'content' => 'Georg-August-Universität Göttingen', 'comment' => 'GND:2024315-7', 'parentID' => '0', 'altBegriff' => '', 'LmAdd' => array([maximum depth reached]), 'textpassagen' => array([maximum depth reached]) ), (int) 2 => array( 'ID' => '5440', 'indexID' => '15', 'indexContent' => 'Koerperschaften', 'content' => 'Preußen. Ministerium der Geistlichen, Unterrichts- und Medizinalangelegenheiten ', 'comment' => 'GND:35254-8', 'parentID' => '0', 'altBegriff' => '', 'LmAdd' => array([maximum depth reached]), 'textpassagen' => array([maximum depth reached]) ), (int) 3 => array( 'ID' => '12214', 'indexID' => '15', 'indexContent' => 'Koerperschaften', 'content' => 'Preußen. Preußische Armee', 'comment' => 'GND:2033828-4', 'parentID' => '0', 'altBegriff' => '', 'LmAdd' => array([maximum depth reached]), 'textpassagen' => array([maximum depth reached]) ), (int) 4 => array( 'ID' => '6155', 'indexID' => '15', 'indexContent' => 'Koerperschaften', 'content' => 'Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn', 'comment' => 'GND:36150-1', 'parentID' => '0', 'altBegriff' => '', 'LmAdd' => array([maximum depth reached]), 'textpassagen' => array([maximum depth reached]) ) ), 'index_personen_11' => array( (int) 0 => array( 'ID' => '2426', 'indexID' => '11', 'indexContent' => 'Personen', 'content' => 'Bopp, Franz', 'comment' => 'GND:118659332', 'parentID' => '0', 'altBegriff' => '', 'LmAdd' => array( [maximum depth reached] ), 'textpassagen' => array([maximum depth reached]) ), (int) 1 => array( 'ID' => '631', 'indexID' => '11', 'indexContent' => 'Personen', 'content' => 'Chateaubriand, François-René de ', 'comment' => 'GND:118520237', 'parentID' => '0', 'altBegriff' => '', 'LmAdd' => array( [maximum depth reached] ), 'textpassagen' => array([maximum depth reached]) ), (int) 2 => array( 'ID' => '515', 'indexID' => '11', 'indexContent' => 'Personen', 'content' => 'Friedrich Wilhelm III., Preußen, König', 'comment' => 'GND:118535986', 'parentID' => '0', 'altBegriff' => '', 'LmAdd' => array( [maximum depth reached] ), 'textpassagen' => array([maximum depth reached]) ), (int) 3 => array( 'ID' => '553', 'indexID' => '11', 'indexContent' => 'Personen', 'content' => 'Hardenberg, Karl August von', 'comment' => 'GND:118545906', 'parentID' => '0', 'altBegriff' => '', 'LmAdd' => array( [maximum depth reached] ), 'textpassagen' => array([maximum depth reached]) ), (int) 4 => array( 'ID' => '276', 'indexID' => '11', 'indexContent' => 'Personen', 'content' => 'Hufeland, Christoph Wilhelm von', 'comment' => 'GND:118554514', 'parentID' => '0', 'altBegriff' => '', 'LmAdd' => array([maximum depth reached]), 'textpassagen' => array([maximum depth reached]) ), (int) 5 => array( 'ID' => '634', 'indexID' => '11', 'indexContent' => 'Personen', 'content' => 'Ludwig I., Bayern, König', 'comment' => 'GND:118574884', 'parentID' => '0', 'altBegriff' => '', 'LmAdd' => array( [maximum depth reached] ), 'textpassagen' => array([maximum depth reached]) ), (int) 6 => array( 'ID' => '2429', 'indexID' => '11', 'indexContent' => 'Personen', 'content' => 'Müffling, Friedrich Carl Ferdinand von', 'comment' => 'GND:118584693', 'parentID' => '0', 'altBegriff' => '', 'LmAdd' => array([maximum depth reached]), 'textpassagen' => array([maximum depth reached]) ), (int) 7 => array( 'ID' => '243', 'indexID' => '11', 'indexContent' => 'Personen', 'content' => 'Paulus, Caroline', 'comment' => 'GND:116066563', 'parentID' => '0', 'altBegriff' => '', 'LmAdd' => array( [maximum depth reached] ), 'textpassagen' => array([maximum depth reached]) ), (int) 8 => array( 'ID' => '186', 'indexID' => '11', 'indexContent' => 'Personen', 'content' => 'Paulus, Heinrich Eberhard Gottlob ', 'comment' => 'GND:115368361', 'parentID' => '0', 'altBegriff' => '', 'LmAdd' => array( [maximum depth reached] ), 'textpassagen' => array([maximum depth reached]) ), (int) 9 => array( 'ID' => '1386', 'indexID' => '11', 'indexContent' => 'Personen', 'content' => 'Reinhard, Karl Friedrich', 'comment' => 'GND:118744224', 'parentID' => '0', 'altBegriff' => '', 'LmAdd' => array( [maximum depth reached] ), 'textpassagen' => array([maximum depth reached]) ), (int) 10 => array( 'ID' => '2321', 'indexID' => '11', 'indexContent' => 'Personen', 'content' => 'Richelieu, Armand Emmanuel DuPlessis de ', 'comment' => 'GND:119006200', 'parentID' => '0', 'altBegriff' => '', 'LmAdd' => array([maximum depth reached]), 'textpassagen' => array([maximum depth reached]) ), (int) 11 => array( 'ID' => '8', 'indexID' => '11', 'indexContent' => 'Personen', 'content' => 'Schlegel, Friedrich von', 'comment' => 'GND:118607987', 'parentID' => '0', 'altBegriff' => '', 'LmAdd' => array( [maximum depth reached] ), 'textpassagen' => array([maximum depth reached]) ), (int) 12 => array( 'ID' => '2402', 'indexID' => '11', 'indexContent' => 'Personen', 'content' => 'Schlegel, Sophie von', 'comment' => 'GND:117321435', 'parentID' => '0', 'altBegriff' => '', 'LmAdd' => array( [maximum depth reached] ), 'textpassagen' => array([maximum depth reached]) ), (int) 13 => array( 'ID' => '2323', 'indexID' => '11', 'indexContent' => 'Personen', 'content' => 'Solms-Laubach, Friedrich Ludwig Christian zu ', 'comment' => 'GND:117462241', 'parentID' => '0', 'altBegriff' => '', 'LmAdd' => array( [maximum depth reached] ), 'textpassagen' => array([maximum depth reached]) ), (int) 14 => array( 'ID' => '222', 'indexID' => '11', 'indexContent' => 'Personen', 'content' => 'Staël-Holstein, Anne Louise Germaine de', 'comment' => 'GND:118616617', 'parentID' => '0', 'altBegriff' => '', 'LmAdd' => array( [maximum depth reached] ), 'textpassagen' => array([maximum depth reached]) ), (int) 15 => array( 'ID' => '2427', 'indexID' => '11', 'indexContent' => 'Personen', 'content' => 'Sturdza, Aleksandr S.', 'comment' => 'GND:104186852', 'parentID' => '0', 'altBegriff' => '', 'LmAdd' => array([maximum depth reached]), 'textpassagen' => array([maximum depth reached]) ), (int) 16 => array( 'ID' => '2403', 'indexID' => '11', 'indexContent' => 'Personen', 'content' => 'Vom Stein Zum Altenstein, Karl ', 'comment' => 'GND:11862783X', 'parentID' => '0', 'altBegriff' => '', 'LmAdd' => array( [maximum depth reached] ), 'textpassagen' => array([maximum depth reached]) ) ), 'index_werke_12' => array( (int) 0 => array( 'ID' => '19749', 'indexID' => '12', 'indexContent' => 'Werke', 'content' => 'Bürger, Gottfried August: Der Raubgraf', 'comment' => '', 'parentID' => '0', 'altBegriff' => '', 'LmAdd' => array([maximum depth reached]), 'textpassagen' => array([maximum depth reached]) ), (int) 1 => array( 'ID' => '2452', 'indexID' => '12', 'indexContent' => 'Werke', 'content' => 'Schlegel, August Wilhelm von: Crisis antiquissimae Romanorum historiae (Bonn WS 1818/19)', 'comment' => '', 'parentID' => '0', 'altBegriff' => '', 'LmAdd' => array([maximum depth reached]), 'textpassagen' => array([maximum depth reached]) ), (int) 2 => array( 'ID' => '11635', 'indexID' => '12', 'indexContent' => 'Werke', 'content' => 'Schlegel, August Wilhelm von: Du système continental. In: Essais littéraires et historiques', 'comment' => '', 'parentID' => '0', 'altBegriff' => '', 'LmAdd' => array([maximum depth reached]), 'textpassagen' => array([maximum depth reached]) ), (int) 3 => array( 'ID' => '3452', 'indexID' => '12', 'indexContent' => 'Werke', 'content' => 'Schlegel, August Wilhelm von: Geschichte der deutschen Sprache und Poesie (Bonn WS 1818/19)', 'comment' => '', 'parentID' => '0', 'altBegriff' => '', 'LmAdd' => array([maximum depth reached]), 'textpassagen' => array([maximum depth reached]) ), (int) 4 => array( 'ID' => '4972', 'indexID' => '12', 'indexContent' => 'Werke', 'content' => 'Schlegel, August Wilhelm von: Geschichte der schönen Litteratur in Italien, Spanien Frankreich und England, vom Mittelalter bis auf die heutige Zeit (Bonn SS 1819)', 'comment' => '', 'parentID' => '0', 'altBegriff' => '', 'LmAdd' => array([maximum depth reached]), 'textpassagen' => array([maximum depth reached]) ), (int) 5 => array( 'ID' => '2435', 'indexID' => '12', 'indexContent' => 'Werke', 'content' => 'Schlegel, August Wilhelm von: Geschichte der schönen Litteratur in Italien, Spanien Frankreich und England, vom Mittelalter bis auf die heutige Zeit (Bonn WS 1818/19)', 'comment' => '', 'parentID' => '0', 'altBegriff' => '', 'LmAdd' => array([maximum depth reached]), 'textpassagen' => array([maximum depth reached]) ), (int) 6 => array( 'ID' => '3730', 'indexID' => '12', 'indexContent' => 'Werke', 'content' => 'Schlegel, August Wilhelm von: Römische Geschichte (Bonn SS 1819)', 'comment' => '', 'parentID' => '0', 'altBegriff' => '', 'LmAdd' => array([maximum depth reached]), 'textpassagen' => array([maximum depth reached]) ), (int) 7 => array( 'ID' => '3369', 'indexID' => '12', 'indexContent' => 'Werke', 'content' => 'Schlegel, August Wilhelm von: Sur le système continental et sur ses rapports avec la Suède', 'comment' => '', 'parentID' => '0', 'altBegriff' => '', 'LmAdd' => array([maximum depth reached]), 'textpassagen' => array([maximum depth reached]) ), (int) 8 => array( 'ID' => '4965', 'indexID' => '12', 'indexContent' => 'Werke', 'content' => 'Schlegel, August Wilhelm von: Theorie der bildenden Künste (Bonn WS 1819/20)', 'comment' => '', 'parentID' => '0', 'altBegriff' => '', 'LmAdd' => array([maximum depth reached]), 'textpassagen' => array([maximum depth reached]) ), (int) 9 => array( 'ID' => '3511', 'indexID' => '12', 'indexContent' => 'Werke', 'content' => 'Schlegel, August Wilhelm von: Theorie und allgemeine Geschichte der bildenden Künste (Bonn SS 1819)', 'comment' => '', 'parentID' => '0', 'altBegriff' => '', 'LmAdd' => array([maximum depth reached]), 'textpassagen' => array([maximum depth reached]) ), (int) 10 => array( 'ID' => '2475', 'indexID' => '12', 'indexContent' => 'Werke', 'content' => 'Schlegel, August Wilhelm von: Vorlesungen über das akademische Studium (Bonn WS 1819/20)', 'comment' => '', 'parentID' => '0', 'altBegriff' => '', 'LmAdd' => array([maximum depth reached]), 'textpassagen' => array([maximum depth reached]) ), (int) 11 => array( 'ID' => '2555', 'indexID' => '12', 'indexContent' => 'Werke', 'content' => 'Schlegel, August Wilhelm von: Über den gegenwärtigen Zustand der Indischen Philologie', 'comment' => '', 'parentID' => '0', 'altBegriff' => '', 'LmAdd' => array([maximum depth reached]), 'textpassagen' => array([maximum depth reached]) ), (int) 12 => array( 'ID' => '2409', 'indexID' => '12', 'indexContent' => 'Werke', 'content' => 'Staël-Holstein, Anne Louise Germaine de: Œuvres complètes', 'comment' => '', 'parentID' => '0', 'altBegriff' => '', 'LmAdd' => array([maximum depth reached]), 'textpassagen' => array([maximum depth reached]) ), (int) 13 => array( 'ID' => '19747', 'indexID' => '12', 'indexContent' => 'Werke', 'content' => 'Sturdza, Aleksandr S.: Coup dʻoeil sur les universites de lʻAllemagne', 'comment' => '', 'parentID' => '0', 'altBegriff' => '', 'LmAdd' => array([maximum depth reached]), 'textpassagen' => array([maximum depth reached]) ), (int) 14 => array( 'ID' => '3392', 'indexID' => '12', 'indexContent' => 'Werke', 'content' => 'Sturdza, Aleksandr S.: Mémoire sur lʼétat actuel de lʼAllemagne (1818)', 'comment' => '', 'parentID' => '0', 'altBegriff' => '', 'LmAdd' => array([maximum depth reached]), 'textpassagen' => array([maximum depth reached]) ) ), 'index_periodika_13' => array( (int) 0 => array( 'ID' => '3471', 'indexID' => '13', 'indexContent' => 'Periodika', 'content' => 'Jahrbuch der Preußischen Rhein-Universität', 'comment' => '', 'parentID' => '0', 'altBegriff' => '', 'LmAdd' => array([maximum depth reached]), 'textpassagen' => array([maximum depth reached]) ) ), '36_html' => '[1] [<span class="index-887 tp-99166 ">Bonn</span>,] 19. Januar 1820.<br><span class="doc-3500 ">Ihren Brief vom 8. Januar</span> erhielt ich vor einigen Tagen, mein teurer und hochverehrter Freund, und eile zuvörderst, Ihren freundschaftlichen Vorwürfen zu begegnen. Meine Gesinnungen gegen Sie können sich nie ändern. Ich werde Ihnen zeitlebens dankbar sein für die freundschaftliche Wärme, womit Sie zu meiner Hilfe herbeigeeilt sind, als ich in <span class="index-898 tp-99167 ">Auxerre</span> krank lag: <span class="cite tp-54866 ">ich erzähle es gern, daß Sie mich damals den Klauen ungeschickter Ärzte, oder was einerlei ist, dem Tode entrissen haben</span>. Aber ich fand nicht bloß eine Befriedigung des Herzens in Ihrem Wohlwollen, Ihr Umgang gewährte mir den lebhaftesten Genuß, und die Tage, die ich mit Ihnen in <span class="index-171 tp-99168 ">Paris</span>, auf dem Lande, in der Schweiz, oder wo es sein mochte, zugebracht, gehören zu meinen angenehmsten Erinnerungen.<br>Immer freute ich mich, in Ihnen den witzigen Gesellschafter, den geistreichen Beobachter der Welt, den ideenreichen Forscher wiederzufinden und meinen Geist durch Ihre Mitteilungen anzuregen. Als ich im Jahre 1817 <span class="index-222 tp-99170 ">einen unersetzlichen Verlust</span> erlitten hatte, als die Auflösung eines Verhältnisses ohnegleichen durch den Tod mir eine unerwünschte Freiheit wiedergab, habe ich in Ihren Einladungen zur Rückkehr nach Deutschland aufs neue Ihren freundschaftlichen Eifer erkannt. Bei unserem Zusammentreffen in <span class="index-1591 tp-99169 ">Koblenz</span> und in Bonn glaubte ich von Ihrer Seite einige Zurückhaltung [2] zu bemerken und vermied es, diese Grenze zu durchbrechen. Seitdem ist, soviel ich weiß, keine Botschaft von Ihnen zu mir gelangt, sonst wäre sie nicht unerwidert geblieben. Sie kennen meine alte Nachlässigkeit im Briefschreiben: es ist ein Familienfehler, den sogar <span class="index-8 tp-99171 ">mein Bruder</span> mir zugute halten muß, so wie ich ihm. Überdies, was hätte ich Ihnen, der Sie in mannigfaltigen und bedeutenden Weltverhältnissen leben, aus meiner wissenschaftlichen Eingezogenheit Unterhaltendes melden können? Dazu kam, daß ich seit meiner Ankunft in Bonn sehr häufig verstimmt war, und zwar durch einen Verdruß der Art, wovon man nicht gern redet. Dies führt mich auf die Verleumdungen, deren Sie erwähnen. Sie können, mein teurer Freund, keine sehr schweren Kämpfe zu bestehen gehabt haben, denn die lügenhafte Abgeschmacktheit dieser Verleumdungen mußte jedem Unbefangenen in die Augen springen. Vergebens habe ich <span class="index-243 tp-99173 index-186 tp-99172 index-2402 tp-99174 ">die Urheber</span> durch die geringschätzigste Zurückweisung ihrer Zumutungen aufgefordert, ans Licht hervorzutreten, um mir alsdann volle Genugtuung zu schaffen. Sie haben sich wohl davor gehütet. Sie hatten mit bleiernen Pfeilen auf eine stählerne Rüstung geschossen. Das flüchtige Aufsehen ist längst in tiefe Vergessenheit begraben, ich genieße aus der Ferne und Nähe der gewohnten Achtung. Übrigens waren in Berlin zwei verehrte Freunde von mir, <span class="index-2429 tp-99175 ">der General v. Müffling</span> und <span class="index-276 tp-99176 ">der Staatsrat Hufeland</span>, näher von der Sache unterrichtet und werden [3] wohl gelegentlich das Nötige gesagt haben. Wenn es Sie interessieren kann, will ich Sie ein andermal davon unterhalten: mir ist es nun schon gleichgültig geworden, aber es bleibt immer eine seltsam merkwürdige Geschichte.<br>Sie sehen, daß ich das Bedürfnis habe, zu Ihnen im vollen Vertrauen der Freundschaft zu reden. Aber kommen wir nach dieser schon allzu langen Vorrede auf die Hauptsache. Auch hier muß ich zuvörderst einige irrige Annahmen aus dem Wege räumen, die ich in Ihrem Briefe bemerke.<br>Ich gebe Ihnen mein Ehrenwort, daß ich den getanen Schritt mit niemandem verabredet, noch viel weniger mich dazu verbindlich gemacht [habe]. Der Entschluß ist ganz aus mir selbst hervorgegangen. Sollte in einer Stelle Ihres Briefes, was ich kaum glauben kann, <span class="index-2323 tp-99177 ">unser allgemein geliebter und verehrter, leider ehemaliger Kurator</span> gemeint sein, so kann ich versichern, daß er, wiewohl es ihn geschmerzt hat, sich für jetzt von <span class="index-6155 tp-99178 ">der Universität</span> zu trennen, den aufrichtigsten Anteil an ihrem fortwährenden Gedeihen nimmt, und daß er, in der Voraussetzung, ich könnte im Sinne haben, mich von dem Lehramte zurückzuziehen, mir die dringendsten Gründe entgegengestellt hat. Ich habe die Sache ganz als meine Privatangelegenheit behandelt, ich habe mich nur wenigen Freunden im engsten Vertrauen [4] eröffnet, ich habe fortgefahren, <span class="index-2452 tp-99223 index-3452 tp-99220 index-4972 tp-99224 index-2435 tp-99221 index-3730 tp-99225 index-4965 tp-99226 index-3511 tp-99227 index-2475 tp-99228 ">meine Vorlesungen</span> mit dem gewohnten Fleiße zu geben, und das hiesige Publikum hat erst aus dem Berlinischen Zeitungsartikel etwas erfahren. Aber auch jetzt weiche ich den deshalb an mich geschehenden Anfragen durch unbestimmte Äußerungen aus. <br>Ferner muß ich erklären, daß der Aufenthalt in Bonn mir keineswegs mißfällt, sondern daß ich vielmehr eine große Neigung dazu gefaßt habe. Die heitere Gegend, das milde Klima, die bequeme Lage zu kleinen und großen Reisen, das freundschaftliche Verhältnis mit meinen Amtsgenossen, die gesellige Ungezwungenheit, selbst Beschränktheit einer kleinen Stadt sagten mir zu. Dazu kommt nun, daß ich meine gelehrten Vorräte nicht ohne Mühe und Kosten um mich her versammelt und mich angenehm eingerichtet habe. Ich hatte es recht eigentlich darauf angelegt, in meinem Hause einen literarischen Zirkel zu bilden. Ich hege keine Abneigung gegen <span class="index-15 tp-99179 ">Berlin</span>, das ich ja von alter Zeit kenne. Nur scheute ich das rauhere Klima und die weite Entfernung von meinen Freunden in Frankreich. Auch glaubte ich den geselligen Anforderungen dort nicht ausweichen zu können, und meine Gesundheit sowohl als meine weit aussehenden Forschungen fordern eine von den Zerstreuungen der großen Welt ungestörte Ruhe. <br>[5] Ich habe ja selbst um die Verlängerung meines hiesigen Aufenthalts bis zum nächsten Herbst angehalten, und <span class="index-5440 tp-99180 ">das Ministerium</span> hat die Gnade gehabt, mein Gesuch zu bewilligen. Ich hoffte in der Folge, vielleicht mit dem Vorbehalt, eine Reihe von Vorlesungen in Berlin zu geben, meine definitive Bestimmung für Bonn auszuwirken. Hier fand ich eine besonders erfreuliche Sphäre gelehrter Tätigkeit, wo man die Früchte seines Fleißes gleichsam vor seinen Augen wachsen und reifen sehen konnte. Es war ein herrlicher Gedanke, hier am Rheine gründliche deutsche Bildung und Liebe dazu zu verbreiten. Sie haben recht, teuerster Freund, <span class="index-12214 tp-99181 ">die kgl. preußische Regierung</span> hat unendlich viel für Kunst und Wissenschaft getan, und die Stiftung von Bonn war ein echt vaterländisches Ereignis. Die Wahl des Ortes war die glücklichste: die königliche Freigebigkeit <span class="index-515 tp-99182 ">des Monarchen</span>, die weise Sorgfalt des Ministeriums können nicht genug gepriesen werden. Ich war stolz darauf, Fremden, die mich besuchten, dem Grafen Montlosier, <span class="index-2321 tp-99183 ">dem Herzog von Richelieu</span>, <span class="index-1386 tp-99184 ">dem Grafen Reinhard</span>, den großen Umfang und die Vortrefflichkeit der neuen Anstalt darlegen zu können. Ich brachte sie zu dem Geständnis, daß es in Frankreich, wenigstens außer Paris, nichts Ähnliches gebe. Ich lege Ihnen einen Brief des Herzogs von Richelieu bei, den er mir kurz nach seinem Besuche schrieb. <br>Wenn viel für uns [6] geschehen war, so haben wir uns auch unsererseits wacker gerührt. Vierhundert Studierende, darunter eine große Anzahl schon gebildeter junger Männer aus allen Gegenden Deutschlands, im ersten Jahre nach der Stiftung: das ist in den Annalen der Universitäten unerhört. Ich gebe diesen Winter eine öffentliche Vorlesung vor zweihundert Zuhörern. ‒ Wenn es ungestört so fortgegangen wäre, so hätten wir in einigen Jahren an Frequenz und Ruhm auch im Auslande, mit <span class="index-6154 tp-99186 index-2 tp-99185 ">Göttingen</span> wetteifern mögen. <br>Freilich, es ist ein Großes, wenn der Staat Aufwand für wissenschaftliche Anstalten macht, den Gelehrten ihre Existenz reichlich sichert. Aber diese Wohltaten verlieren ihre Kraft, wenn nicht noch eine, die höchste hinzukommt: ehrenvolle Auszeichnungen, aufmunternde Beweise des Wohlwollens von seiten der Regierung. Der akademische Lehrer insbesondere kann das Zutrauen nicht entbehren. Und dieses Zutrauen haben wir nun durch eine unglückliche Konstellation verwirkt, ich weiß nicht wie; wenigstens scheinen mir die Anlässe in gar keinem Verhältnisse mit den Folgen zu stehen. Von einem großen Staatenverein ist das Anathema ausgesprochen worden. Der Widerhall davon ist durch Europa erschollen, und wir mögen nun bald in amerikanischen Zeitungsblättern lesen, daß wir, sämtlich oder großenteils, Verführer der Jugend sind. Doch ich will auf das, was die deutschen Universitäten im allgemeinen seit <span class="index-19747 tp-99200 index-3392 tp-99201 ">der Schrift</span> von <span class="index-2427 tp-99192 ">Stourdza</span> betroffen hat, nicht eingehen. Mein Brief würde zum Buche [7] werden, Sie würden meiner Ansicht Ihre Gründe entgegenstellen, und am Ende würde vielleicht keiner den anderen überzeugen. Ich beschränke mich auf meine eigene Angelegenheit. Zu dem getanen Schritte hat mich nichts anderes bewogen als die Überzeugung, wovon ich auch jetzt nicht weichen kann, daß das Amt, wozu ich vor anderthalb Jahren so ehrenvoll berufen wurde, nicht mehr dasselbe ist, daß es durch die neuen Einrichtungen seine wesentlichsten Vorrechte, seine Annehmlichkeit und seine Würde verloren hat. <br>Sie erlassen mir wohl den Beweis, sonst bin ich erbötig, ihn nachdrücklich zu führen. <br>Aber Sie sagen mir, die notwendig befundenen Vorkehrungsmaßregeln seien nicht gegen Gelehrte von meinem Charakter gemeint. Es ist wahr, ich habe nie den Ehrgeiz gehabt, eine politische Rolle zu spielen, weder als Schriftsteller, noch auf andere Art: sonst hätte ich nicht so manche günstige Gelegenheit vorbeigehen lassen. Ein einziges Mal habe ich meinen Namen eingezeichnet, das war in der allgemeinen Sache des Vaterlandes, in dem europäischen Kampfe für die Selbständigkeit der Staaten. Ich bin es seit langen Jahren gewohnt, in der Mitte politischer Gärungen als ruhiger Zuschauer zu stehen, nur eine mäßigende und vermittelnde Stimme hören zu lassen und mit Menschen von allen Parteien in freundlichem Verhältnisse zu bleiben. Noch am Tage meiner Abreise [8] von Paris <span class="doc-4754 ">schrieb mir </span><span class="doc-4754 index-631 tp-99202 ">Herr von Chateaubriand</span>, ich sei dazu berufen, die Geschichte Frankreichs im Mittelalter zu schreiben. Allein das in Deutschland erwachte Mißtrauen gegen die Gelehrten und Schriftsteller überhaupt liegt am Tage; und ein solches Mißtrauen ist nicht wie eine gewöhnliche Flamme, welche erlischt, wenn der Nahrungsstoff erschöpft ist: es phosphoresziert nur um so heller in luftleerem Raume. Wenn der Verdacht sich auf Meinungen, auch auf nicht ausgesprochene, richtet, kann ich sicher sein, daß die Meinungen des Verfassers <span class="index-3369 tp-99203 ">der Schrift „</span><span class="index-3369 tp-99203 weight-bold ">Sur le système continental</span><span class="index-3369 tp-99203 ">“</span> und <span class="index-11635 tp-99204 ">einiger anderer politischer Schriften</span> im Jahre 1813, des vieljährigen Freundes <span class="index-222 tp-99206 ">der Frau von Staël</span>, des Mitherausgebers <span class="index-2409 tp-99208 ">ihres nachgelassenen Werkes</span> (ich will Sie geflissentlich an alles erinnern), immer unverdächtig scheinen werden? <br>Mit dem besten Willen kam ich nach Deutschland. Meine Freunde in Frankreich ließen mich ungern von sich und würden mich mit offenen Armen wieder aufnehmen. Sie wissen, daß ich dort sehr angenehme Verhältnisse habe, und wenn ich bloß meine Neigung befragt hätte, so wäre ich wohl immer da geblieben. Aber es schien mir vielleicht rühmlicher, gewiß verdienstlicher und berufsgemäßer, meine Kräfte zum Nutzen des Vaterlandes zu verwenden. Ich fand alles in scheinbar tiefer Ruhe. Plötzlich ist ein Ungewitter aufgezogen, aus einem Wölkchen, wie das war, welches der Prophet Elias am Horizont erblickte. Mein erster [9] Gedanke war, ein Obdach zu suchen. Glauben Sie mir, ich bilde mir nicht ein, zu irgend etwas notwendig zu sein: meine Entfernung vom öffentlichen Unterricht würde keine merkliche Lücke verursachen. Mein Fach gehört zu den entbehrlichen, für die nur dann Begünstigung zu hoffen ist, wenn bei vollkommen heiterer Stimmung auch an äußere Verzierung gedacht wird. Der Inhalt Ihres Briefes war mir daher etwas ganz Unerwartetes. <br>Sie bezeugen mir die unendlich ehrenvolle Hochschätzung <span class="index-553 tp-99209 ">des Fürsten Staatskanzlers</span>: ich bitte Sie, den Ausdruck meiner ehrerbietigsten Gesinnungen und meiner Dankbarkeit vor Se. Durchlaucht zu bringen. Wenn ich die schmeichelhafte Überzeugung hegen darf, daß der Staatskanzler, daß <span class="index-2403 tp-99210 ">der Minister von Altenstein</span>, dessen Briefe ich als kostbare Beweise der Anerkennung aufbewahre, auf die Fortsetzung meiner wissenschaftlichen Tätigkeit im Dienste des Staats einigen Wert legen, so wirft das freilich ein bedeutendes Gewicht in die andere Wagschale.<br>Lassen Sie uns also miteinander überlegen, ob sich irgendein Ausweg finden läßt. Sie sagen mir, „die getroffenen Maßregeln werden mich auf keine Art unangenehm berühren, mein Leben und Wirken stehe da, vor jeder unfreundlichen Berührung geschützt, wie von einer Ägide, die kein Pfeil durchbohrt.“ Könnten Sie mir darüber eine amtliche Versicherung schaffen? Brief und Siegel? Das wäre ja gewissermaßen<br>[10] <span class="index-19749 tp-99212 ">„Ein eisern Privilegium,<br>Zu hexen frank und frei herum.“</span><br>Aber im Ernst, kann irgendein Einzelner billigerweise verlangen, daß zu seinen Gunsten eine Ausnahme gemacht werde von einer allgemeinen Maßregel, die so viele würdige Männer trifft? Sonst standen zwischen den Professoren und dem Ministerium nur die Kuratoren, Männer von erlauchter Geburt und in hohen Staatsämtern, deren Namen schon den Universitäten zur Zierde gereichte; und ihre Wirksamkeit war durchaus nicht hemmend, sondern eine fördernde und aufmunternde Fürsorge. Von spezieller Aufsicht war gar nicht die Rede; sie schien um so weniger nötig, da die Grundsätze der Lehrer vor ihrer Anstellung meist durch ihre Schriften bekannt waren. In dem unerhörten Fall, daß ein Lehrer sein Amt zu übeln Zwecken gemißbraucht hätte, kam es zunächst dem akademischen Senate zu, für die Ehre und Unbescholtenheit der Universität zu sorgen. Jetzt sind Aufseher in der Nähe hingestellt mit einer unbedingten und bisher beispiellosen Vollmacht. Wie ist einem solchen Verhältnis auszuweichen? Ich sehe nur ein einziges Mittel. Die Maßregel ist nur als transitorisch, das Verhältnis der Universitäten zu den Kuratoren nur als suspendiert angekündigt worden. Es käme also darauf an, einen speziellen wissenschaftlichen Auftrag auszumitteln, dessen Ausführung mich während [11] dieser Zeit hinlänglich beschäftigte, auch wenn ich einstweilen der gewöhnlichen Geschäfte eines akademischen Lehrers überhoben würde.<br>Einen solchen Auftrag wüßte ich wohl. Sogleich bei meiner Rückkehr in Deutschland habe ich mein Augenmerk darauf gerichtet; aber ich hegte nicht mehr die Hoffnung, jetzt, da die Bewegungen des Augenblicks die Gemüter ganz in Anspruch nehmen, Begünstigung dafür zu finden. Sie erregen diese Hoffnung von neuem, indem Sie mir sagen, der preußische Staat werde auch jetzt fortfahren, väterlich und liberaler als jeder andre für das Gedeihen der Wissenschaft und Kunst zu sorgen.<br>Mein Wunsch wäre nämlich, das Studium des Sanskrit und der indischen Literatur überhaupt in Deutschland auf eine gründliche Art einheimisch zu machen. Das große gelehrte Interesse der Sache brauche ich Ihnen nicht auseinanderzusetzen: Sie sind im Besitz aller darauf bezüglichen Ideen. Ich lege <span class="index-2555 tp-99233 ">einen Aufsatz</span> bei, wodurch ich die Gönner der Wissenschaften in Berlin aufmerksam zu machen gesucht habe, er ist <span class="index-3471 tp-99232 ">den Bonnischen Jahrbüchern</span> eingerückt worden.<br>Noch will ich erinnern, daß nicht nur in Paris ein eigner Lehrstuhl für das Sanskrit errichtet ist, sondern daß ein deutscher Gelehrter, <span class="index-2426 tp-99214 ">Fr. Bopp</span>, mit Unterstützung <span class="index-11752 tp-99218 ">der bayerischen Regierung</span>, und, auf meine Empfehlung, insbesondere <span class="index-634 tp-99217 ">des Kronprinzen von Bayern</span>, seit einer Anzahl von Jahren in Paris, jetzt in <span class="index-292 tp-99215 ">London</span>, einzig zu diesem Zwecke studiert und das Versprechen [12] einer Professur in <span class="index-230 tp-99216 ">Würzburg</span> erhalten hat. Er hat jetzt einen indischen Text in London sehr lobenswert herausgegeben, worüber ich nächstens eine Beurteilung drucken lassen werde. In Göttingen ist noch nichts geschehen, doch steht es über kurz oder lang zu erwarten, da die Verhältnisse mit England es dort besonders erleichtern.<br>Wenn man also, wie billig, bei keiner Erweiterung der Wissenschaft zurückbleiben will, so wäre es nötig, auf irgendeiner der preußischen Universitäten etwas für das Studium der indischen Literatur zu tun. Ich glaube, es würde für Bonn keine gleichgültige Auszeichnung sein, wenn man hier die Hilfsmittel des Sanskrit, die ich schon großenteils besitze, beisammen fände; wenn man in der Folge auch Elementarbücher und indische Texte drucken könnte. Die Lage ist besonders günstig wegen der Nähe von London und Paris, wo allein indische Manuskripte sind. Einige außerordentliche Unterstützung wäre erforderlich, aber sie würde nicht unerschwinglich sein, keineswegs außer Verhältnis mit dem, was das hohe Ministerium für andre auch nicht ganz notwendige Studien so freigebig bewilligt hat.<br>Diesen Lieblingsplan hatte ich nun schon völlig aufgegeben, als ich vor sechs Wochen nach Berlin schrieb. Ich überlasse es Ihnen, mein teuerster Freund, ob Sie den Versuch wagen wollen, der Sache Eingang zu verschaffen. Auf erhaltenen Befehl würde ich sogleich <span class="index-2403 tp-99236 ">dem Minister [13] des öffentlichen Unterrichts</span> einen ins einzelne gehenden Plan vorlegen.<br>Ich weiß wohl, daß die Ausführung mir eine Menge mühseliger und trockener Arbeiten auferlegen und daß ich einige Jahre hindurch alle Hände voll zu tun haben würde, statt daß ich, bei individueller Fortsetzung des Studiums, nur die Blüte davon pflücken und sie zu welthistorischen, philosophischen, dichterischen Zwecken benutzen könnte. Aber die Liebe zur Sache würde mir die Schwierigkeiten überwinden helfen. <br>Ich hoffe, Sie werden in diesen Äußerungen die Bereitwilligkeit erkennen, den Eröffnungen, die Sie mir von seiten eines erlauchten Gönners gemacht haben, entgegenzukommen. Eine Reise nach Berlin halte ich in dem gegenwärtigen Augenblick durchaus nicht für zweckmäßig.<br>Leben Sie recht wohl, mein teurer Freund, und erfreuen Sie mich bald mit einer Antwort. Denn nach dem getanen Schritte bin ich in der Lage jenes alten Ritters in einer spanischen Romanze:<br>„Schon den einen Fuß im Bügel.“<br>Und um einen neuen Lebensplan auszuführen, müssen doch mancherlei Anstalten getroffen werden.<br>[14]<br>[15]<br>[16]', '36_xml' => '<p>[1] [<placeName key="887">Bonn</placeName>,] 19. Januar 1820.<lb/><ref target="fud://3500">Ihren Brief vom 8. Januar</ref> erhielt ich vor einigen Tagen, mein teurer und hochverehrter Freund, und eile zuvörderst, Ihren freundschaftlichen Vorwürfen zu begegnen. Meine Gesinnungen gegen Sie können sich nie ändern. Ich werde Ihnen zeitlebens dankbar sein für die freundschaftliche Wärme, womit Sie zu meiner Hilfe herbeigeeilt sind, als ich in <placeName key="898">Auxerre</placeName> krank lag: ich erzähle es gern, daß Sie mich damals den Klauen ungeschickter Ärzte, oder was einerlei ist, dem Tode entrissen haben. Aber ich fand nicht bloß eine Befriedigung des Herzens in Ihrem Wohlwollen, Ihr Umgang gewährte mir den lebhaftesten Genuß, und die Tage, die ich mit Ihnen in <placeName key="171">Paris</placeName>, auf dem Lande, in der Schweiz, oder wo es sein mochte, zugebracht, gehören zu meinen angenehmsten Erinnerungen.<lb/>Immer freute ich mich, in Ihnen den witzigen Gesellschafter, den geistreichen Beobachter der Welt, den ideenreichen Forscher wiederzufinden und meinen Geist durch Ihre Mitteilungen anzuregen. Als ich im Jahre 1817 <persName key="222">einen unersetzlichen Verlust</persName> erlitten hatte, als die Auflösung eines Verhältnisses ohnegleichen durch den Tod mir eine unerwünschte Freiheit wiedergab, habe ich in Ihren Einladungen zur Rückkehr nach Deutschland aufs neue Ihren freundschaftlichen Eifer erkannt. Bei unserem Zusammentreffen in <placeName key="1591">Koblenz</placeName> und in Bonn glaubte ich von Ihrer Seite einige Zurückhaltung [2] zu bemerken und vermied es, diese Grenze zu durchbrechen. Seitdem ist, soviel ich weiß, keine Botschaft von Ihnen zu mir gelangt, sonst wäre sie nicht unerwidert geblieben. Sie kennen meine alte Nachlässigkeit im Briefschreiben: es ist ein Familienfehler, den sogar <persName key="8">mein Bruder</persName> mir zugute halten muß, so wie ich ihm. Überdies, was hätte ich Ihnen, der Sie in mannigfaltigen und bedeutenden Weltverhältnissen leben, aus meiner wissenschaftlichen Eingezogenheit Unterhaltendes melden können? Dazu kam, daß ich seit meiner Ankunft in Bonn sehr häufig verstimmt war, und zwar durch einen Verdruß der Art, wovon man nicht gern redet. Dies führt mich auf die Verleumdungen, deren Sie erwähnen. Sie können, mein teurer Freund, keine sehr schweren Kämpfe zu bestehen gehabt haben, denn die lügenhafte Abgeschmacktheit dieser Verleumdungen mußte jedem Unbefangenen in die Augen springen. Vergebens habe ich <persName key="243"><persName key="186"><persName key="2402">die Urheber</persName></persName></persName> durch die geringschätzigste Zurückweisung ihrer Zumutungen aufgefordert, ans Licht hervorzutreten, um mir alsdann volle Genugtuung zu schaffen. Sie haben sich wohl davor gehütet. Sie hatten mit bleiernen Pfeilen auf eine stählerne Rüstung geschossen. Das flüchtige Aufsehen ist längst in tiefe Vergessenheit begraben, ich genieße aus der Ferne und Nähe der gewohnten Achtung. Übrigens waren in Berlin zwei verehrte Freunde von mir, <persName key="2429">der General v. Müffling</persName> und <persName key="276">der Staatsrat Hufeland</persName>, näher von der Sache unterrichtet und werden [3] wohl gelegentlich das Nötige gesagt haben. Wenn es Sie interessieren kann, will ich Sie ein andermal davon unterhalten: mir ist es nun schon gleichgültig geworden, aber es bleibt immer eine seltsam merkwürdige Geschichte.<lb/>Sie sehen, daß ich das Bedürfnis habe, zu Ihnen im vollen Vertrauen der Freundschaft zu reden. Aber kommen wir nach dieser schon allzu langen Vorrede auf die Hauptsache. Auch hier muß ich zuvörderst einige irrige Annahmen aus dem Wege räumen, die ich in Ihrem Briefe bemerke.<lb/>Ich gebe Ihnen mein Ehrenwort, daß ich den getanen Schritt mit niemandem verabredet, noch viel weniger mich dazu verbindlich gemacht [habe]. Der Entschluß ist ganz aus mir selbst hervorgegangen. Sollte in einer Stelle Ihres Briefes, was ich kaum glauben kann, <persName key="2323">unser allgemein geliebter und verehrter, leider ehemaliger Kurator</persName> gemeint sein, so kann ich versichern, daß er, wiewohl es ihn geschmerzt hat, sich für jetzt von <orgName key="6155">der Universität</orgName> zu trennen, den aufrichtigsten Anteil an ihrem fortwährenden Gedeihen nimmt, und daß er, in der Voraussetzung, ich könnte im Sinne haben, mich von dem Lehramte zurückzuziehen, mir die dringendsten Gründe entgegengestellt hat. Ich habe die Sache ganz als meine Privatangelegenheit behandelt, ich habe mich nur wenigen Freunden im engsten Vertrauen [4] eröffnet, ich habe fortgefahren, <name key="2452" type="work"><name key="3452" type="work"><name key="4972" type="work"><name key="2435" type="work"><name key="3730" type="work"><name key="4965" type="work"><name key="3511" type="work"><name key="2475" type="work">meine Vorlesungen</name></name></name></name></name></name></name></name> mit dem gewohnten Fleiße zu geben, und das hiesige Publikum hat erst aus dem Berlinischen Zeitungsartikel etwas erfahren. Aber auch jetzt weiche ich den deshalb an mich geschehenden Anfragen durch unbestimmte Äußerungen aus. <lb/>Ferner muß ich erklären, daß der Aufenthalt in Bonn mir keineswegs mißfällt, sondern daß ich vielmehr eine große Neigung dazu gefaßt habe. Die heitere Gegend, das milde Klima, die bequeme Lage zu kleinen und großen Reisen, das freundschaftliche Verhältnis mit meinen Amtsgenossen, die gesellige Ungezwungenheit, selbst Beschränktheit einer kleinen Stadt sagten mir zu. Dazu kommt nun, daß ich meine gelehrten Vorräte nicht ohne Mühe und Kosten um mich her versammelt und mich angenehm eingerichtet habe. Ich hatte es recht eigentlich darauf angelegt, in meinem Hause einen literarischen Zirkel zu bilden. Ich hege keine Abneigung gegen <placeName key="15">Berlin</placeName>, das ich ja von alter Zeit kenne. Nur scheute ich das rauhere Klima und die weite Entfernung von meinen Freunden in Frankreich. Auch glaubte ich den geselligen Anforderungen dort nicht ausweichen zu können, und meine Gesundheit sowohl als meine weit aussehenden Forschungen fordern eine von den Zerstreuungen der großen Welt ungestörte Ruhe. <lb/>[5] Ich habe ja selbst um die Verlängerung meines hiesigen Aufenthalts bis zum nächsten Herbst angehalten, und <orgName key="5440">das Ministerium</orgName> hat die Gnade gehabt, mein Gesuch zu bewilligen. Ich hoffte in der Folge, vielleicht mit dem Vorbehalt, eine Reihe von Vorlesungen in Berlin zu geben, meine definitive Bestimmung für Bonn auszuwirken. Hier fand ich eine besonders erfreuliche Sphäre gelehrter Tätigkeit, wo man die Früchte seines Fleißes gleichsam vor seinen Augen wachsen und reifen sehen konnte. Es war ein herrlicher Gedanke, hier am Rheine gründliche deutsche Bildung und Liebe dazu zu verbreiten. Sie haben recht, teuerster Freund, <orgName key="12214">die kgl. preußische Regierung</orgName> hat unendlich viel für Kunst und Wissenschaft getan, und die Stiftung von Bonn war ein echt vaterländisches Ereignis. Die Wahl des Ortes war die glücklichste: die königliche Freigebigkeit <persName key="515">des Monarchen</persName>, die weise Sorgfalt des Ministeriums können nicht genug gepriesen werden. Ich war stolz darauf, Fremden, die mich besuchten, dem Grafen Montlosier, <persName key="2321">dem Herzog von Richelieu</persName>, <persName key="1386">dem Grafen Reinhard</persName>, den großen Umfang und die Vortrefflichkeit der neuen Anstalt darlegen zu können. Ich brachte sie zu dem Geständnis, daß es in Frankreich, wenigstens außer Paris, nichts Ähnliches gebe. Ich lege Ihnen einen Brief des Herzogs von Richelieu bei, den er mir kurz nach seinem Besuche schrieb. <lb/>Wenn viel für uns [6] geschehen war, so haben wir uns auch unsererseits wacker gerührt. Vierhundert Studierende, darunter eine große Anzahl schon gebildeter junger Männer aus allen Gegenden Deutschlands, im ersten Jahre nach der Stiftung: das ist in den Annalen der Universitäten unerhört. Ich gebe diesen Winter eine öffentliche Vorlesung vor zweihundert Zuhörern. ‒ Wenn es ungestört so fortgegangen wäre, so hätten wir in einigen Jahren an Frequenz und Ruhm auch im Auslande, mit <orgName key="6154"><placeName key="2">Göttingen</placeName></orgName> wetteifern mögen. <lb/>Freilich, es ist ein Großes, wenn der Staat Aufwand für wissenschaftliche Anstalten macht, den Gelehrten ihre Existenz reichlich sichert. Aber diese Wohltaten verlieren ihre Kraft, wenn nicht noch eine, die höchste hinzukommt: ehrenvolle Auszeichnungen, aufmunternde Beweise des Wohlwollens von seiten der Regierung. Der akademische Lehrer insbesondere kann das Zutrauen nicht entbehren. Und dieses Zutrauen haben wir nun durch eine unglückliche Konstellation verwirkt, ich weiß nicht wie; wenigstens scheinen mir die Anlässe in gar keinem Verhältnisse mit den Folgen zu stehen. Von einem großen Staatenverein ist das Anathema ausgesprochen worden. Der Widerhall davon ist durch Europa erschollen, und wir mögen nun bald in amerikanischen Zeitungsblättern lesen, daß wir, sämtlich oder großenteils, Verführer der Jugend sind. Doch ich will auf das, was die deutschen Universitäten im allgemeinen seit <name key="19747" type="work"><name key="3392" type="work">der Schrift</name></name> von <persName key="2427">Stourdza</persName> betroffen hat, nicht eingehen. Mein Brief würde zum Buche [7] werden, Sie würden meiner Ansicht Ihre Gründe entgegenstellen, und am Ende würde vielleicht keiner den anderen überzeugen. Ich beschränke mich auf meine eigene Angelegenheit. Zu dem getanen Schritte hat mich nichts anderes bewogen als die Überzeugung, wovon ich auch jetzt nicht weichen kann, daß das Amt, wozu ich vor anderthalb Jahren so ehrenvoll berufen wurde, nicht mehr dasselbe ist, daß es durch die neuen Einrichtungen seine wesentlichsten Vorrechte, seine Annehmlichkeit und seine Würde verloren hat. <lb/>Sie erlassen mir wohl den Beweis, sonst bin ich erbötig, ihn nachdrücklich zu führen. <lb/>Aber Sie sagen mir, die notwendig befundenen Vorkehrungsmaßregeln seien nicht gegen Gelehrte von meinem Charakter gemeint. Es ist wahr, ich habe nie den Ehrgeiz gehabt, eine politische Rolle zu spielen, weder als Schriftsteller, noch auf andere Art: sonst hätte ich nicht so manche günstige Gelegenheit vorbeigehen lassen. Ein einziges Mal habe ich meinen Namen eingezeichnet, das war in der allgemeinen Sache des Vaterlandes, in dem europäischen Kampfe für die Selbständigkeit der Staaten. Ich bin es seit langen Jahren gewohnt, in der Mitte politischer Gärungen als ruhiger Zuschauer zu stehen, nur eine mäßigende und vermittelnde Stimme hören zu lassen und mit Menschen von allen Parteien in freundlichem Verhältnisse zu bleiben. Noch am Tage meiner Abreise [8] von Paris <ref target="fud://4754">schrieb mir <persName key="631">Herr von Chateaubriand</persName></ref>, ich sei dazu berufen, die Geschichte Frankreichs im Mittelalter zu schreiben. Allein das in Deutschland erwachte Mißtrauen gegen die Gelehrten und Schriftsteller überhaupt liegt am Tage; und ein solches Mißtrauen ist nicht wie eine gewöhnliche Flamme, welche erlischt, wenn der Nahrungsstoff erschöpft ist: es phosphoresziert nur um so heller in luftleerem Raume. Wenn der Verdacht sich auf Meinungen, auch auf nicht ausgesprochene, richtet, kann ich sicher sein, daß die Meinungen des Verfassers <name key="3369" type="work">der Schrift „<hi rend="weight:bold">Sur le système continental</hi>“</name> und <name key="11635" type="work">einiger anderer politischer Schriften</name> im Jahre 1813, des vieljährigen Freundes <persName key="222">der Frau von Staël</persName>, des Mitherausgebers <name key="2409" type="work">ihres nachgelassenen Werkes</name> (ich will Sie geflissentlich an alles erinnern), immer unverdächtig scheinen werden? <lb/>Mit dem besten Willen kam ich nach Deutschland. Meine Freunde in Frankreich ließen mich ungern von sich und würden mich mit offenen Armen wieder aufnehmen. Sie wissen, daß ich dort sehr angenehme Verhältnisse habe, und wenn ich bloß meine Neigung befragt hätte, so wäre ich wohl immer da geblieben. Aber es schien mir vielleicht rühmlicher, gewiß verdienstlicher und berufsgemäßer, meine Kräfte zum Nutzen des Vaterlandes zu verwenden. Ich fand alles in scheinbar tiefer Ruhe. Plötzlich ist ein Ungewitter aufgezogen, aus einem Wölkchen, wie das war, welches der Prophet Elias am Horizont erblickte. Mein erster [9] Gedanke war, ein Obdach zu suchen. Glauben Sie mir, ich bilde mir nicht ein, zu irgend etwas notwendig zu sein: meine Entfernung vom öffentlichen Unterricht würde keine merkliche Lücke verursachen. Mein Fach gehört zu den entbehrlichen, für die nur dann Begünstigung zu hoffen ist, wenn bei vollkommen heiterer Stimmung auch an äußere Verzierung gedacht wird. Der Inhalt Ihres Briefes war mir daher etwas ganz Unerwartetes. <lb/>Sie bezeugen mir die unendlich ehrenvolle Hochschätzung <persName key="553">des Fürsten Staatskanzlers</persName>: ich bitte Sie, den Ausdruck meiner ehrerbietigsten Gesinnungen und meiner Dankbarkeit vor Se. Durchlaucht zu bringen. Wenn ich die schmeichelhafte Überzeugung hegen darf, daß der Staatskanzler, daß <persName key="2403">der Minister von Altenstein</persName>, dessen Briefe ich als kostbare Beweise der Anerkennung aufbewahre, auf die Fortsetzung meiner wissenschaftlichen Tätigkeit im Dienste des Staats einigen Wert legen, so wirft das freilich ein bedeutendes Gewicht in die andere Wagschale.<lb/>Lassen Sie uns also miteinander überlegen, ob sich irgendein Ausweg finden läßt. Sie sagen mir, „die getroffenen Maßregeln werden mich auf keine Art unangenehm berühren, mein Leben und Wirken stehe da, vor jeder unfreundlichen Berührung geschützt, wie von einer Ägide, die kein Pfeil durchbohrt.“ Könnten Sie mir darüber eine amtliche Versicherung schaffen? Brief und Siegel? Das wäre ja gewissermaßen<lb/>[10] <name key="19749" type="work">„Ein eisern Privilegium,<lb/>Zu hexen frank und frei herum.“</name><lb/>Aber im Ernst, kann irgendein Einzelner billigerweise verlangen, daß zu seinen Gunsten eine Ausnahme gemacht werde von einer allgemeinen Maßregel, die so viele würdige Männer trifft? Sonst standen zwischen den Professoren und dem Ministerium nur die Kuratoren, Männer von erlauchter Geburt und in hohen Staatsämtern, deren Namen schon den Universitäten zur Zierde gereichte; und ihre Wirksamkeit war durchaus nicht hemmend, sondern eine fördernde und aufmunternde Fürsorge. Von spezieller Aufsicht war gar nicht die Rede; sie schien um so weniger nötig, da die Grundsätze der Lehrer vor ihrer Anstellung meist durch ihre Schriften bekannt waren. In dem unerhörten Fall, daß ein Lehrer sein Amt zu übeln Zwecken gemißbraucht hätte, kam es zunächst dem akademischen Senate zu, für die Ehre und Unbescholtenheit der Universität zu sorgen. Jetzt sind Aufseher in der Nähe hingestellt mit einer unbedingten und bisher beispiellosen Vollmacht. Wie ist einem solchen Verhältnis auszuweichen? Ich sehe nur ein einziges Mittel. Die Maßregel ist nur als transitorisch, das Verhältnis der Universitäten zu den Kuratoren nur als suspendiert angekündigt worden. Es käme also darauf an, einen speziellen wissenschaftlichen Auftrag auszumitteln, dessen Ausführung mich während [11] dieser Zeit hinlänglich beschäftigte, auch wenn ich einstweilen der gewöhnlichen Geschäfte eines akademischen Lehrers überhoben würde.<lb/>Einen solchen Auftrag wüßte ich wohl. Sogleich bei meiner Rückkehr in Deutschland habe ich mein Augenmerk darauf gerichtet; aber ich hegte nicht mehr die Hoffnung, jetzt, da die Bewegungen des Augenblicks die Gemüter ganz in Anspruch nehmen, Begünstigung dafür zu finden. Sie erregen diese Hoffnung von neuem, indem Sie mir sagen, der preußische Staat werde auch jetzt fortfahren, väterlich und liberaler als jeder andre für das Gedeihen der Wissenschaft und Kunst zu sorgen.<lb/>Mein Wunsch wäre nämlich, das Studium des Sanskrit und der indischen Literatur überhaupt in Deutschland auf eine gründliche Art einheimisch zu machen. Das große gelehrte Interesse der Sache brauche ich Ihnen nicht auseinanderzusetzen: Sie sind im Besitz aller darauf bezüglichen Ideen. Ich lege <name key="2555" type="work">einen Aufsatz</name> bei, wodurch ich die Gönner der Wissenschaften in Berlin aufmerksam zu machen gesucht habe, er ist <name key="3471" type="periodical">den Bonnischen Jahrbüchern</name> eingerückt worden.<lb/>Noch will ich erinnern, daß nicht nur in Paris ein eigner Lehrstuhl für das Sanskrit errichtet ist, sondern daß ein deutscher Gelehrter, <persName key="2426">Fr. Bopp</persName>, mit Unterstützung <orgName key="11752">der bayerischen Regierung</orgName>, und, auf meine Empfehlung, insbesondere <persName key="634">des Kronprinzen von Bayern</persName>, seit einer Anzahl von Jahren in Paris, jetzt in <placeName key="292">London</placeName>, einzig zu diesem Zwecke studiert und das Versprechen [12] einer Professur in <placeName key="230">Würzburg</placeName> erhalten hat. Er hat jetzt einen indischen Text in London sehr lobenswert herausgegeben, worüber ich nächstens eine Beurteilung drucken lassen werde. In Göttingen ist noch nichts geschehen, doch steht es über kurz oder lang zu erwarten, da die Verhältnisse mit England es dort besonders erleichtern.<lb/>Wenn man also, wie billig, bei keiner Erweiterung der Wissenschaft zurückbleiben will, so wäre es nötig, auf irgendeiner der preußischen Universitäten etwas für das Studium der indischen Literatur zu tun. Ich glaube, es würde für Bonn keine gleichgültige Auszeichnung sein, wenn man hier die Hilfsmittel des Sanskrit, die ich schon großenteils besitze, beisammen fände; wenn man in der Folge auch Elementarbücher und indische Texte drucken könnte. Die Lage ist besonders günstig wegen der Nähe von London und Paris, wo allein indische Manuskripte sind. Einige außerordentliche Unterstützung wäre erforderlich, aber sie würde nicht unerschwinglich sein, keineswegs außer Verhältnis mit dem, was das hohe Ministerium für andre auch nicht ganz notwendige Studien so freigebig bewilligt hat.<lb/>Diesen Lieblingsplan hatte ich nun schon völlig aufgegeben, als ich vor sechs Wochen nach Berlin schrieb. Ich überlasse es Ihnen, mein teuerster Freund, ob Sie den Versuch wagen wollen, der Sache Eingang zu verschaffen. Auf erhaltenen Befehl würde ich sogleich <persName key="2403">dem Minister [13] des öffentlichen Unterrichts</persName> einen ins einzelne gehenden Plan vorlegen.<lb/>Ich weiß wohl, daß die Ausführung mir eine Menge mühseliger und trockener Arbeiten auferlegen und daß ich einige Jahre hindurch alle Hände voll zu tun haben würde, statt daß ich, bei individueller Fortsetzung des Studiums, nur die Blüte davon pflücken und sie zu welthistorischen, philosophischen, dichterischen Zwecken benutzen könnte. Aber die Liebe zur Sache würde mir die Schwierigkeiten überwinden helfen. <lb/>Ich hoffe, Sie werden in diesen Äußerungen die Bereitwilligkeit erkennen, den Eröffnungen, die Sie mir von seiten eines erlauchten Gönners gemacht haben, entgegenzukommen. Eine Reise nach Berlin halte ich in dem gegenwärtigen Augenblick durchaus nicht für zweckmäßig.<lb/>Leben Sie recht wohl, mein teurer Freund, und erfreuen Sie mich bald mit einer Antwort. Denn nach dem getanen Schritte bin ich in der Lage jenes alten Ritters in einer spanischen Romanze:<lb/>„Schon den einen Fuß im Bügel.“<lb/>Und um einen neuen Lebensplan auszuführen, müssen doch mancherlei Anstalten getroffen werden.<lb/>[14]<lb/>[15]<lb/>[16]</p>', '36_xml_standoff' => '[1] [<anchor type="b" n="887" ana="10" xml:id="NidB99166"/>Bonn<anchor type="e" n="887" ana="10" xml:id="NidE99166"/>,] 19. Januar 1820.<lb/><ref target="fud://3500">Ihren Brief vom 8. Januar</ref> erhielt ich vor einigen Tagen, mein teurer und hochverehrter Freund, und eile zuvörderst, Ihren freundschaftlichen Vorwürfen zu begegnen. Meine Gesinnungen gegen Sie können sich nie ändern. Ich werde Ihnen zeitlebens dankbar sein für die freundschaftliche Wärme, womit Sie zu meiner Hilfe herbeigeeilt sind, als ich in <anchor type="b" n="898" ana="10" xml:id="NidB99167"/>Auxerre<anchor type="e" n="898" ana="10" xml:id="NidE99167"/> krank lag: <anchor type="b" n="8748" ana="16" xml:id="NidB54866"/>ich erzähle es gern, daß Sie mich damals den Klauen ungeschickter Ärzte, oder was einerlei ist, dem Tode entrissen haben<anchor type="e" n="8748" ana="16" xml:id="NidE54866"/>. Aber ich fand nicht bloß eine Befriedigung des Herzens in Ihrem Wohlwollen, Ihr Umgang gewährte mir den lebhaftesten Genuß, und die Tage, die ich mit Ihnen in <anchor type="b" n="171" ana="10" xml:id="NidB99168"/>Paris<anchor type="e" n="171" ana="10" xml:id="NidE99168"/>, auf dem Lande, in der Schweiz, oder wo es sein mochte, zugebracht, gehören zu meinen angenehmsten Erinnerungen.<lb/>Immer freute ich mich, in Ihnen den witzigen Gesellschafter, den geistreichen Beobachter der Welt, den ideenreichen Forscher wiederzufinden und meinen Geist durch Ihre Mitteilungen anzuregen. Als ich im Jahre 1817 <anchor type="b" n="222" ana="11" xml:id="NidB99170"/>einen unersetzlichen Verlust<anchor type="e" n="222" ana="11" xml:id="NidE99170"/> erlitten hatte, als die Auflösung eines Verhältnisses ohnegleichen durch den Tod mir eine unerwünschte Freiheit wiedergab, habe ich in Ihren Einladungen zur Rückkehr nach Deutschland aufs neue Ihren freundschaftlichen Eifer erkannt. Bei unserem Zusammentreffen in <anchor type="b" n="1591" ana="10" xml:id="NidB99169"/>Koblenz<anchor type="e" n="1591" ana="10" xml:id="NidE99169"/> und in Bonn glaubte ich von Ihrer Seite einige Zurückhaltung [2] zu bemerken und vermied es, diese Grenze zu durchbrechen. Seitdem ist, soviel ich weiß, keine Botschaft von Ihnen zu mir gelangt, sonst wäre sie nicht unerwidert geblieben. Sie kennen meine alte Nachlässigkeit im Briefschreiben: es ist ein Familienfehler, den sogar <anchor type="b" n="8" ana="11" xml:id="NidB99171"/>mein Bruder<anchor type="e" n="8" ana="11" xml:id="NidE99171"/> mir zugute halten muß, so wie ich ihm. Überdies, was hätte ich Ihnen, der Sie in mannigfaltigen und bedeutenden Weltverhältnissen leben, aus meiner wissenschaftlichen Eingezogenheit Unterhaltendes melden können? Dazu kam, daß ich seit meiner Ankunft in Bonn sehr häufig verstimmt war, und zwar durch einen Verdruß der Art, wovon man nicht gern redet. Dies führt mich auf die Verleumdungen, deren Sie erwähnen. Sie können, mein teurer Freund, keine sehr schweren Kämpfe zu bestehen gehabt haben, denn die lügenhafte Abgeschmacktheit dieser Verleumdungen mußte jedem Unbefangenen in die Augen springen. Vergebens habe ich <anchor type="b" n="243" ana="11" xml:id="NidB99173"/><anchor type="b" n="186" ana="11" xml:id="NidB99172"/><anchor type="b" n="2402" ana="11" xml:id="NidB99174"/>die Urheber<anchor type="e" n="2402" ana="11" xml:id="NidE99174"/><anchor type="e" n="186" ana="11" xml:id="NidE99172"/><anchor type="e" n="243" ana="11" xml:id="NidE99173"/> durch die geringschätzigste Zurückweisung ihrer Zumutungen aufgefordert, ans Licht hervorzutreten, um mir alsdann volle Genugtuung zu schaffen. Sie haben sich wohl davor gehütet. Sie hatten mit bleiernen Pfeilen auf eine stählerne Rüstung geschossen. Das flüchtige Aufsehen ist längst in tiefe Vergessenheit begraben, ich genieße aus der Ferne und Nähe der gewohnten Achtung. Übrigens waren in Berlin zwei verehrte Freunde von mir, <anchor type="b" n="2429" ana="11" xml:id="NidB99175"/>der General v. Müffling<anchor type="e" n="2429" ana="11" xml:id="NidE99175"/> und <anchor type="b" n="276" ana="11" xml:id="NidB99176"/>der Staatsrat Hufeland<anchor type="e" n="276" ana="11" xml:id="NidE99176"/>, näher von der Sache unterrichtet und werden [3] wohl gelegentlich das Nötige gesagt haben. Wenn es Sie interessieren kann, will ich Sie ein andermal davon unterhalten: mir ist es nun schon gleichgültig geworden, aber es bleibt immer eine seltsam merkwürdige Geschichte.<lb/>Sie sehen, daß ich das Bedürfnis habe, zu Ihnen im vollen Vertrauen der Freundschaft zu reden. Aber kommen wir nach dieser schon allzu langen Vorrede auf die Hauptsache. Auch hier muß ich zuvörderst einige irrige Annahmen aus dem Wege räumen, die ich in Ihrem Briefe bemerke.<lb/>Ich gebe Ihnen mein Ehrenwort, daß ich den getanen Schritt mit niemandem verabredet, noch viel weniger mich dazu verbindlich gemacht [habe]. Der Entschluß ist ganz aus mir selbst hervorgegangen. Sollte in einer Stelle Ihres Briefes, was ich kaum glauben kann, <anchor type="b" n="2323" ana="11" xml:id="NidB99177"/>unser allgemein geliebter und verehrter, leider ehemaliger Kurator<anchor type="e" n="2323" ana="11" xml:id="NidE99177"/> gemeint sein, so kann ich versichern, daß er, wiewohl es ihn geschmerzt hat, sich für jetzt von <anchor type="b" n="6155" ana="15" xml:id="NidB99178"/>der Universität<anchor type="e" n="6155" ana="15" xml:id="NidE99178"/> zu trennen, den aufrichtigsten Anteil an ihrem fortwährenden Gedeihen nimmt, und daß er, in der Voraussetzung, ich könnte im Sinne haben, mich von dem Lehramte zurückzuziehen, mir die dringendsten Gründe entgegengestellt hat. Ich habe die Sache ganz als meine Privatangelegenheit behandelt, ich habe mich nur wenigen Freunden im engsten Vertrauen [4] eröffnet, ich habe fortgefahren, <anchor type="b" n="2452" ana="12" xml:id="NidB99223"/><anchor type="b" n="3452" ana="12" xml:id="NidB99220"/><anchor type="b" n="4972" ana="12" xml:id="NidB99224"/><anchor type="b" n="2435" ana="12" xml:id="NidB99221"/><anchor type="b" n="3730" ana="12" xml:id="NidB99225"/><anchor type="b" n="4965" ana="12" xml:id="NidB99226"/><anchor type="b" n="3511" ana="12" xml:id="NidB99227"/><anchor type="b" n="2475" ana="12" xml:id="NidB99228"/>meine Vorlesungen<anchor type="e" n="2475" ana="12" xml:id="NidE99228"/><anchor type="e" n="3511" ana="12" xml:id="NidE99227"/><anchor type="e" n="4965" ana="12" xml:id="NidE99226"/><anchor type="e" n="3730" ana="12" xml:id="NidE99225"/><anchor type="e" n="2435" ana="12" xml:id="NidE99221"/><anchor type="e" n="4972" ana="12" xml:id="NidE99224"/><anchor type="e" n="3452" ana="12" xml:id="NidE99220"/><anchor type="e" n="2452" ana="12" xml:id="NidE99223"/> mit dem gewohnten Fleiße zu geben, und das hiesige Publikum hat erst aus dem Berlinischen Zeitungsartikel etwas erfahren. Aber auch jetzt weiche ich den deshalb an mich geschehenden Anfragen durch unbestimmte Äußerungen aus. <lb/>Ferner muß ich erklären, daß der Aufenthalt in Bonn mir keineswegs mißfällt, sondern daß ich vielmehr eine große Neigung dazu gefaßt habe. Die heitere Gegend, das milde Klima, die bequeme Lage zu kleinen und großen Reisen, das freundschaftliche Verhältnis mit meinen Amtsgenossen, die gesellige Ungezwungenheit, selbst Beschränktheit einer kleinen Stadt sagten mir zu. Dazu kommt nun, daß ich meine gelehrten Vorräte nicht ohne Mühe und Kosten um mich her versammelt und mich angenehm eingerichtet habe. Ich hatte es recht eigentlich darauf angelegt, in meinem Hause einen literarischen Zirkel zu bilden. Ich hege keine Abneigung gegen <anchor type="b" n="15" ana="10" xml:id="NidB99179"/>Berlin<anchor type="e" n="15" ana="10" xml:id="NidE99179"/>, das ich ja von alter Zeit kenne. Nur scheute ich das rauhere Klima und die weite Entfernung von meinen Freunden in Frankreich. Auch glaubte ich den geselligen Anforderungen dort nicht ausweichen zu können, und meine Gesundheit sowohl als meine weit aussehenden Forschungen fordern eine von den Zerstreuungen der großen Welt ungestörte Ruhe. <lb/>[5] Ich habe ja selbst um die Verlängerung meines hiesigen Aufenthalts bis zum nächsten Herbst angehalten, und <anchor type="b" n="5440" ana="15" xml:id="NidB99180"/>das Ministerium<anchor type="e" n="5440" ana="15" xml:id="NidE99180"/> hat die Gnade gehabt, mein Gesuch zu bewilligen. Ich hoffte in der Folge, vielleicht mit dem Vorbehalt, eine Reihe von Vorlesungen in Berlin zu geben, meine definitive Bestimmung für Bonn auszuwirken. Hier fand ich eine besonders erfreuliche Sphäre gelehrter Tätigkeit, wo man die Früchte seines Fleißes gleichsam vor seinen Augen wachsen und reifen sehen konnte. Es war ein herrlicher Gedanke, hier am Rheine gründliche deutsche Bildung und Liebe dazu zu verbreiten. Sie haben recht, teuerster Freund, <anchor type="b" n="12214" ana="15" xml:id="NidB99181"/>die kgl. preußische Regierung<anchor type="e" n="12214" ana="15" xml:id="NidE99181"/> hat unendlich viel für Kunst und Wissenschaft getan, und die Stiftung von Bonn war ein echt vaterländisches Ereignis. Die Wahl des Ortes war die glücklichste: die königliche Freigebigkeit <anchor type="b" n="515" ana="11" xml:id="NidB99182"/>des Monarchen<anchor type="e" n="515" ana="11" xml:id="NidE99182"/>, die weise Sorgfalt des Ministeriums können nicht genug gepriesen werden. Ich war stolz darauf, Fremden, die mich besuchten, dem Grafen Montlosier, <anchor type="b" n="2321" ana="11" xml:id="NidB99183"/>dem Herzog von Richelieu<anchor type="e" n="2321" ana="11" xml:id="NidE99183"/>, <anchor type="b" n="1386" ana="11" xml:id="NidB99184"/>dem Grafen Reinhard<anchor type="e" n="1386" ana="11" xml:id="NidE99184"/>, den großen Umfang und die Vortrefflichkeit der neuen Anstalt darlegen zu können. Ich brachte sie zu dem Geständnis, daß es in Frankreich, wenigstens außer Paris, nichts Ähnliches gebe. Ich lege Ihnen einen Brief des Herzogs von Richelieu bei, den er mir kurz nach seinem Besuche schrieb. <lb/>Wenn viel für uns [6] geschehen war, so haben wir uns auch unsererseits wacker gerührt. Vierhundert Studierende, darunter eine große Anzahl schon gebildeter junger Männer aus allen Gegenden Deutschlands, im ersten Jahre nach der Stiftung: das ist in den Annalen der Universitäten unerhört. Ich gebe diesen Winter eine öffentliche Vorlesung vor zweihundert Zuhörern. ‒ Wenn es ungestört so fortgegangen wäre, so hätten wir in einigen Jahren an Frequenz und Ruhm auch im Auslande, mit <anchor type="b" n="6154" ana="15" xml:id="NidB99186"/><anchor type="b" n="2" ana="10" xml:id="NidB99185"/>Göttingen<anchor type="e" n="2" ana="10" xml:id="NidE99185"/><anchor type="e" n="6154" ana="15" xml:id="NidE99186"/> wetteifern mögen. <lb/>Freilich, es ist ein Großes, wenn der Staat Aufwand für wissenschaftliche Anstalten macht, den Gelehrten ihre Existenz reichlich sichert. Aber diese Wohltaten verlieren ihre Kraft, wenn nicht noch eine, die höchste hinzukommt: ehrenvolle Auszeichnungen, aufmunternde Beweise des Wohlwollens von seiten der Regierung. Der akademische Lehrer insbesondere kann das Zutrauen nicht entbehren. Und dieses Zutrauen haben wir nun durch eine unglückliche Konstellation verwirkt, ich weiß nicht wie; wenigstens scheinen mir die Anlässe in gar keinem Verhältnisse mit den Folgen zu stehen. Von einem großen Staatenverein ist das Anathema ausgesprochen worden. Der Widerhall davon ist durch Europa erschollen, und wir mögen nun bald in amerikanischen Zeitungsblättern lesen, daß wir, sämtlich oder großenteils, Verführer der Jugend sind. Doch ich will auf das, was die deutschen Universitäten im allgemeinen seit <anchor type="b" n="19747" ana="12" xml:id="NidB99200"/><anchor type="b" n="3392" ana="12" xml:id="NidB99201"/>der Schrift<anchor type="e" n="3392" ana="12" xml:id="NidE99201"/><anchor type="e" n="19747" ana="12" xml:id="NidE99200"/> von <anchor type="b" n="2427" ana="11" xml:id="NidB99192"/>Stourdza<anchor type="e" n="2427" ana="11" xml:id="NidE99192"/> betroffen hat, nicht eingehen. Mein Brief würde zum Buche [7] werden, Sie würden meiner Ansicht Ihre Gründe entgegenstellen, und am Ende würde vielleicht keiner den anderen überzeugen. Ich beschränke mich auf meine eigene Angelegenheit. Zu dem getanen Schritte hat mich nichts anderes bewogen als die Überzeugung, wovon ich auch jetzt nicht weichen kann, daß das Amt, wozu ich vor anderthalb Jahren so ehrenvoll berufen wurde, nicht mehr dasselbe ist, daß es durch die neuen Einrichtungen seine wesentlichsten Vorrechte, seine Annehmlichkeit und seine Würde verloren hat. <lb/>Sie erlassen mir wohl den Beweis, sonst bin ich erbötig, ihn nachdrücklich zu führen. <lb/>Aber Sie sagen mir, die notwendig befundenen Vorkehrungsmaßregeln seien nicht gegen Gelehrte von meinem Charakter gemeint. Es ist wahr, ich habe nie den Ehrgeiz gehabt, eine politische Rolle zu spielen, weder als Schriftsteller, noch auf andere Art: sonst hätte ich nicht so manche günstige Gelegenheit vorbeigehen lassen. Ein einziges Mal habe ich meinen Namen eingezeichnet, das war in der allgemeinen Sache des Vaterlandes, in dem europäischen Kampfe für die Selbständigkeit der Staaten. Ich bin es seit langen Jahren gewohnt, in der Mitte politischer Gärungen als ruhiger Zuschauer zu stehen, nur eine mäßigende und vermittelnde Stimme hören zu lassen und mit Menschen von allen Parteien in freundlichem Verhältnisse zu bleiben. Noch am Tage meiner Abreise [8] von Paris <ref target="fud://4754">schrieb mir <anchor type="b" n="631" ana="11" xml:id="NidB99202"/>Herr von Chateaubriand<anchor type="e" n="631" ana="11" xml:id="NidE99202"/></ref>, ich sei dazu berufen, die Geschichte Frankreichs im Mittelalter zu schreiben. Allein das in Deutschland erwachte Mißtrauen gegen die Gelehrten und Schriftsteller überhaupt liegt am Tage; und ein solches Mißtrauen ist nicht wie eine gewöhnliche Flamme, welche erlischt, wenn der Nahrungsstoff erschöpft ist: es phosphoresziert nur um so heller in luftleerem Raume. Wenn der Verdacht sich auf Meinungen, auch auf nicht ausgesprochene, richtet, kann ich sicher sein, daß die Meinungen des Verfassers <anchor type="b" n="3369" ana="12" xml:id="NidB99203"/>der Schrift „<hi rend="weight:bold">Sur le système continental</hi>“<anchor type="e" n="3369" ana="12" xml:id="NidE99203"/> und <anchor type="b" n="11635" ana="12" xml:id="NidB99204"/>einiger anderer politischer Schriften<anchor type="e" n="11635" ana="12" xml:id="NidE99204"/> im Jahre 1813, des vieljährigen Freundes <anchor type="b" n="222" ana="11" xml:id="NidB99206"/>der Frau von Staël<anchor type="e" n="222" ana="11" xml:id="NidE99206"/>, des Mitherausgebers <anchor type="b" n="2409" ana="12" xml:id="NidB99208"/>ihres nachgelassenen Werkes<anchor type="e" n="2409" ana="12" xml:id="NidE99208"/> (ich will Sie geflissentlich an alles erinnern), immer unverdächtig scheinen werden? <lb/>Mit dem besten Willen kam ich nach Deutschland. Meine Freunde in Frankreich ließen mich ungern von sich und würden mich mit offenen Armen wieder aufnehmen. Sie wissen, daß ich dort sehr angenehme Verhältnisse habe, und wenn ich bloß meine Neigung befragt hätte, so wäre ich wohl immer da geblieben. Aber es schien mir vielleicht rühmlicher, gewiß verdienstlicher und berufsgemäßer, meine Kräfte zum Nutzen des Vaterlandes zu verwenden. Ich fand alles in scheinbar tiefer Ruhe. Plötzlich ist ein Ungewitter aufgezogen, aus einem Wölkchen, wie das war, welches der Prophet Elias am Horizont erblickte. Mein erster [9] Gedanke war, ein Obdach zu suchen. Glauben Sie mir, ich bilde mir nicht ein, zu irgend etwas notwendig zu sein: meine Entfernung vom öffentlichen Unterricht würde keine merkliche Lücke verursachen. Mein Fach gehört zu den entbehrlichen, für die nur dann Begünstigung zu hoffen ist, wenn bei vollkommen heiterer Stimmung auch an äußere Verzierung gedacht wird. Der Inhalt Ihres Briefes war mir daher etwas ganz Unerwartetes. <lb/>Sie bezeugen mir die unendlich ehrenvolle Hochschätzung <anchor type="b" n="553" ana="11" xml:id="NidB99209"/>des Fürsten Staatskanzlers<anchor type="e" n="553" ana="11" xml:id="NidE99209"/>: ich bitte Sie, den Ausdruck meiner ehrerbietigsten Gesinnungen und meiner Dankbarkeit vor Se. Durchlaucht zu bringen. Wenn ich die schmeichelhafte Überzeugung hegen darf, daß der Staatskanzler, daß <anchor type="b" n="2403" ana="11" xml:id="NidB99210"/>der Minister von Altenstein<anchor type="e" n="2403" ana="11" xml:id="NidE99210"/>, dessen Briefe ich als kostbare Beweise der Anerkennung aufbewahre, auf die Fortsetzung meiner wissenschaftlichen Tätigkeit im Dienste des Staats einigen Wert legen, so wirft das freilich ein bedeutendes Gewicht in die andere Wagschale.<lb/>Lassen Sie uns also miteinander überlegen, ob sich irgendein Ausweg finden läßt. Sie sagen mir, „die getroffenen Maßregeln werden mich auf keine Art unangenehm berühren, mein Leben und Wirken stehe da, vor jeder unfreundlichen Berührung geschützt, wie von einer Ägide, die kein Pfeil durchbohrt.“ Könnten Sie mir darüber eine amtliche Versicherung schaffen? Brief und Siegel? Das wäre ja gewissermaßen<lb/>[10] <anchor type="b" n="19749" ana="12" xml:id="NidB99212"/>„Ein eisern Privilegium,<lb/>Zu hexen frank und frei herum.“<anchor type="e" n="19749" ana="12" xml:id="NidE99212"/><lb/>Aber im Ernst, kann irgendein Einzelner billigerweise verlangen, daß zu seinen Gunsten eine Ausnahme gemacht werde von einer allgemeinen Maßregel, die so viele würdige Männer trifft? Sonst standen zwischen den Professoren und dem Ministerium nur die Kuratoren, Männer von erlauchter Geburt und in hohen Staatsämtern, deren Namen schon den Universitäten zur Zierde gereichte; und ihre Wirksamkeit war durchaus nicht hemmend, sondern eine fördernde und aufmunternde Fürsorge. Von spezieller Aufsicht war gar nicht die Rede; sie schien um so weniger nötig, da die Grundsätze der Lehrer vor ihrer Anstellung meist durch ihre Schriften bekannt waren. In dem unerhörten Fall, daß ein Lehrer sein Amt zu übeln Zwecken gemißbraucht hätte, kam es zunächst dem akademischen Senate zu, für die Ehre und Unbescholtenheit der Universität zu sorgen. Jetzt sind Aufseher in der Nähe hingestellt mit einer unbedingten und bisher beispiellosen Vollmacht. Wie ist einem solchen Verhältnis auszuweichen? Ich sehe nur ein einziges Mittel. Die Maßregel ist nur als transitorisch, das Verhältnis der Universitäten zu den Kuratoren nur als suspendiert angekündigt worden. Es käme also darauf an, einen speziellen wissenschaftlichen Auftrag auszumitteln, dessen Ausführung mich während [11] dieser Zeit hinlänglich beschäftigte, auch wenn ich einstweilen der gewöhnlichen Geschäfte eines akademischen Lehrers überhoben würde.<lb/>Einen solchen Auftrag wüßte ich wohl. Sogleich bei meiner Rückkehr in Deutschland habe ich mein Augenmerk darauf gerichtet; aber ich hegte nicht mehr die Hoffnung, jetzt, da die Bewegungen des Augenblicks die Gemüter ganz in Anspruch nehmen, Begünstigung dafür zu finden. Sie erregen diese Hoffnung von neuem, indem Sie mir sagen, der preußische Staat werde auch jetzt fortfahren, väterlich und liberaler als jeder andre für das Gedeihen der Wissenschaft und Kunst zu sorgen.<lb/>Mein Wunsch wäre nämlich, das Studium des Sanskrit und der indischen Literatur überhaupt in Deutschland auf eine gründliche Art einheimisch zu machen. Das große gelehrte Interesse der Sache brauche ich Ihnen nicht auseinanderzusetzen: Sie sind im Besitz aller darauf bezüglichen Ideen. Ich lege <anchor type="b" n="2555" ana="12" xml:id="NidB99233"/>einen Aufsatz<anchor type="e" n="2555" ana="12" xml:id="NidE99233"/> bei, wodurch ich die Gönner der Wissenschaften in Berlin aufmerksam zu machen gesucht habe, er ist <anchor type="b" n="3471" ana="13" xml:id="NidB99232"/>den Bonnischen Jahrbüchern<anchor type="e" n="3471" ana="13" xml:id="NidE99232"/> eingerückt worden.<lb/>Noch will ich erinnern, daß nicht nur in Paris ein eigner Lehrstuhl für das Sanskrit errichtet ist, sondern daß ein deutscher Gelehrter, <anchor type="b" n="2426" ana="11" xml:id="NidB99214"/>Fr. Bopp<anchor type="e" n="2426" ana="11" xml:id="NidE99214"/>, mit Unterstützung <anchor type="b" n="11752" ana="15" xml:id="NidB99218"/>der bayerischen Regierung<anchor type="e" n="11752" ana="15" xml:id="NidE99218"/>, und, auf meine Empfehlung, insbesondere <anchor type="b" n="634" ana="11" xml:id="NidB99217"/>des Kronprinzen von Bayern<anchor type="e" n="634" ana="11" xml:id="NidE99217"/>, seit einer Anzahl von Jahren in Paris, jetzt in <anchor type="b" n="292" ana="10" xml:id="NidB99215"/>London<anchor type="e" n="292" ana="10" xml:id="NidE99215"/>, einzig zu diesem Zwecke studiert und das Versprechen [12] einer Professur in <anchor type="b" n="230" ana="10" xml:id="NidB99216"/>Würzburg<anchor type="e" n="230" ana="10" xml:id="NidE99216"/> erhalten hat. Er hat jetzt einen indischen Text in London sehr lobenswert herausgegeben, worüber ich nächstens eine Beurteilung drucken lassen werde. In Göttingen ist noch nichts geschehen, doch steht es über kurz oder lang zu erwarten, da die Verhältnisse mit England es dort besonders erleichtern.<lb/>Wenn man also, wie billig, bei keiner Erweiterung der Wissenschaft zurückbleiben will, so wäre es nötig, auf irgendeiner der preußischen Universitäten etwas für das Studium der indischen Literatur zu tun. Ich glaube, es würde für Bonn keine gleichgültige Auszeichnung sein, wenn man hier die Hilfsmittel des Sanskrit, die ich schon großenteils besitze, beisammen fände; wenn man in der Folge auch Elementarbücher und indische Texte drucken könnte. Die Lage ist besonders günstig wegen der Nähe von London und Paris, wo allein indische Manuskripte sind. Einige außerordentliche Unterstützung wäre erforderlich, aber sie würde nicht unerschwinglich sein, keineswegs außer Verhältnis mit dem, was das hohe Ministerium für andre auch nicht ganz notwendige Studien so freigebig bewilligt hat.<lb/>Diesen Lieblingsplan hatte ich nun schon völlig aufgegeben, als ich vor sechs Wochen nach Berlin schrieb. Ich überlasse es Ihnen, mein teuerster Freund, ob Sie den Versuch wagen wollen, der Sache Eingang zu verschaffen. Auf erhaltenen Befehl würde ich sogleich <anchor type="b" n="2403" ana="11" xml:id="NidB99236"/>dem Minister [13] des öffentlichen Unterrichts<anchor type="e" n="2403" ana="11" xml:id="NidE99236"/> einen ins einzelne gehenden Plan vorlegen.<lb/>Ich weiß wohl, daß die Ausführung mir eine Menge mühseliger und trockener Arbeiten auferlegen und daß ich einige Jahre hindurch alle Hände voll zu tun haben würde, statt daß ich, bei individueller Fortsetzung des Studiums, nur die Blüte davon pflücken und sie zu welthistorischen, philosophischen, dichterischen Zwecken benutzen könnte. Aber die Liebe zur Sache würde mir die Schwierigkeiten überwinden helfen. <lb/>Ich hoffe, Sie werden in diesen Äußerungen die Bereitwilligkeit erkennen, den Eröffnungen, die Sie mir von seiten eines erlauchten Gönners gemacht haben, entgegenzukommen. Eine Reise nach Berlin halte ich in dem gegenwärtigen Augenblick durchaus nicht für zweckmäßig.<lb/>Leben Sie recht wohl, mein teurer Freund, und erfreuen Sie mich bald mit einer Antwort. Denn nach dem getanen Schritte bin ich in der Lage jenes alten Ritters in einer spanischen Romanze:<lb/>„Schon den einen Fuß im Bügel.“<lb/>Und um einen neuen Lebensplan auszuführen, müssen doch mancherlei Anstalten getroffen werden.<lb/>[14]<lb/>[15]<lb/>[16]', '36_briefid' => 'Oppeln1928_AWSanKoreff_19011820', '36_absender' => array( (int) 0 => array( 'ID' => '7125', 'content' => 'August Wilhelm von Schlegel', 'bemerkung' => '', 'altBegriff' => 'Schlegel, August Wilhelm von', 'LmAdd' => array( [maximum depth reached] ) ) ), '36_adressat' => array( (int) 0 => array( 'ID' => '7327', 'content' => 'Johann Ferdinand Koreff', 'bemerkung' => '', 'altBegriff' => 'Koreff, Johann Ferdinand', 'LmAdd' => array( [maximum depth reached] ) ) ), '36_datumvon' => '1820-01-19', '36_sortdatum' => '1820-01-19', '36_absenderort' => array( (int) 0 => array( 'ID' => '887', 'content' => 'Bonn', 'bemerkung' => 'GND:1001909-1', 'altBegriff' => '', 'LmAdd' => array([maximum depth reached]) ) ), '36_leitd' => 'Oppeln-Bronikowski, Friedrich von: David Ferdinand Koreff. Berlin u.a. 1928, S. 330‒339.', '36_preasentation' => true, '36_verlag' => 'Gebrüder Paetel', '36_status' => 'Einmal kollationierter Druckvolltext mit Registerauszeichnung', '36_datengeberhand' => 'Dresden, Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitätsbibliothek', '36_anmerkungextern' => 'Abschrift.', '36_sprache' => array( (int) 0 => 'Deutsch' ), '36_purlhand' => 'DE-1a-33958', '36_signaturhand' => 'Mscr.Dresd.e.90,XIX,Bd.13,Nr.45', '36_h1zahl' => '13 S. auf Doppelbl., hs. m. U.', '36_h1format' => '18,4 x 12,1 cm', '36_purlhand_alt' => 'DE-1a-1925072', '36_signaturhand_alt' => 'Mscr.Dresd.e.90,XIX,Bd.13,S.191-206', '36_Link_Hand' => array( (int) 0 => array( 'url_image_hand' => 'https://digital.slub-dresden.de/data/kitodo/AWvS_DE-1a-33958_Bd.13/AWvS_DE-1a-33958_Bd.13_tif/jpegs/00000191.tif.original.jpg', 'subID' => '144' ), (int) 1 => array( 'url_image_hand' => 'https://digital.slub-dresden.de/data/kitodo/AWvS_DE-1a-33958_Bd.13/AWvS_DE-1a-33958_Bd.13_tif/jpegs/00000192.tif.original.jpg', 'subID' => '144' ), (int) 2 => array( 'url_image_hand' => 'https://digital.slub-dresden.de/data/kitodo/AWvS_DE-1a-33958_Bd.13/AWvS_DE-1a-33958_Bd.13_tif/jpegs/00000193.tif.original.jpg', 'subID' => '144' ), (int) 3 => array( 'url_image_hand' => 'https://digital.slub-dresden.de/data/kitodo/AWvS_DE-1a-33958_Bd.13/AWvS_DE-1a-33958_Bd.13_tif/jpegs/00000194.tif.original.jpg', 'subID' => '144' ), (int) 4 => array( 'url_image_hand' => 'https://digital.slub-dresden.de/data/kitodo/AWvS_DE-1a-33958_Bd.13/AWvS_DE-1a-33958_Bd.13_tif/jpegs/00000195.tif.original.jpg', 'subID' => '144' ), (int) 5 => array( 'url_image_hand' => 'https://digital.slub-dresden.de/data/kitodo/AWvS_DE-1a-33958_Bd.13/AWvS_DE-1a-33958_Bd.13_tif/jpegs/00000196.tif.original.jpg', 'subID' => '144' ), (int) 6 => array( 'url_image_hand' => 'https://digital.slub-dresden.de/data/kitodo/AWvS_DE-1a-33958_Bd.13/AWvS_DE-1a-33958_Bd.13_tif/jpegs/00000197.tif.original.jpg', 'subID' => '144' ), (int) 7 => array( 'url_image_hand' => 'https://digital.slub-dresden.de/data/kitodo/AWvS_DE-1a-33958_Bd.13/AWvS_DE-1a-33958_Bd.13_tif/jpegs/00000198.tif.original.jpg', 'subID' => '144' ), (int) 8 => array( 'url_image_hand' => 'https://digital.slub-dresden.de/data/kitodo/AWvS_DE-1a-33958_Bd.13/AWvS_DE-1a-33958_Bd.13_tif/jpegs/00000199.tif.original.jpg', 'subID' => '144' ), (int) 9 => array( 'url_image_hand' => 'https://digital.slub-dresden.de/data/kitodo/AWvS_DE-1a-33958_Bd.13/AWvS_DE-1a-33958_Bd.13_tif/jpegs/00000200.tif.original.jpg', 'subID' => '144' ), (int) 10 => array( 'url_image_hand' => 'https://digital.slub-dresden.de/data/kitodo/AWvS_DE-1a-33958_Bd.13/AWvS_DE-1a-33958_Bd.13_tif/jpegs/00000201.tif.original.jpg', 'subID' => '144' ), (int) 11 => array( 'url_image_hand' => 'https://digital.slub-dresden.de/data/kitodo/AWvS_DE-1a-33958_Bd.13/AWvS_DE-1a-33958_Bd.13_tif/jpegs/00000202.tif.original.jpg', 'subID' => '144' ), (int) 12 => array( 'url_image_hand' => 'https://digital.slub-dresden.de/data/kitodo/AWvS_DE-1a-33958_Bd.13/AWvS_DE-1a-33958_Bd.13_tif/jpegs/00000203.tif.original.jpg', 'subID' => '144' ), (int) 13 => array( 'url_image_hand' => 'https://digital.slub-dresden.de/data/kitodo/AWvS_DE-1a-33958_Bd.13/AWvS_DE-1a-33958_Bd.13_tif/jpegs/00000204.tif.original.jpg', 'subID' => '144' ), (int) 14 => array( 'url_image_hand' => 'https://digital.slub-dresden.de/data/kitodo/AWvS_DE-1a-33958_Bd.13/AWvS_DE-1a-33958_Bd.13_tif/jpegs/00000205.tif.original.jpg', 'subID' => '144' ), (int) 15 => array( 'url_image_hand' => 'https://digital.slub-dresden.de/data/kitodo/AWvS_DE-1a-33958_Bd.13/AWvS_DE-1a-33958_Bd.13_tif/jpegs/00000206.tif.original.jpg', 'subID' => '144' ) ), '36_Relationen' => array( (int) 0 => array( 'relation_art' => 'Abschrift', 'relation_link' => '7488', 'subID' => '270' ), (int) 1 => array( 'relation_art' => 'Original', 'relation_link' => '7507', 'subID' => '270' ) ), '36_Datum' => '1820-01-19', '36_facet_absender' => array( (int) 0 => 'August Wilhelm von Schlegel' ), '36_facet_absender_reverse' => array( (int) 0 => 'Schlegel, August Wilhelm von' ), '36_facet_adressat' => array( (int) 0 => 'Johann Ferdinand Koreff' ), '36_facet_adressat_reverse' => array( (int) 0 => 'Koreff, Johann Ferdinand' ), '36_facet_absenderort' => array( (int) 0 => 'Bonn' ), '36_facet_adressatort' => '', '36_facet_status' => 'Einmal kollationierter Druckvolltext mit Registerauszeichnung', '36_facet_datengeberhand' => 'Dresden, Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitätsbibliothek', '36_facet_sprache' => array( (int) 0 => 'Deutsch' ), '36_facet_korrespondenten' => array( (int) 0 => 'Johann Ferdinand Koreff' ), '_label' => '', '_descr' => '', '_model' => 'Letter', '_model_title' => 'Letter', '_model_titles' => 'Letters', '_url' => '' ) $doctype_name = 'Letters' $captions = array( '36_dummy' => '', '36_absender' => 'Absender/Verfasser', '36_absverif1' => 'Verfasser Verifikation', '36_absender2' => 'Verfasser 2', '36_absverif2' => 'Verfasser 2 Verifikation', '36_absbrieftyp2' => 'Verfasser 2 Brieftyp', '36_absender3' => 'Verfasser 3', '36_absverif3' => 'Verfasser 3 Verifikation', '36_absbrieftyp3' => 'Verfasser 3 Brieftyp', '36_adressat' => 'Adressat/Empfänger', '36_adrverif1' => 'Empfänger Verifikation', '36_adressat2' => 'Empfänger 2', '36_adrverif2' => 'Empfänger 2 Verifikation', '36_adressat3' => 'Empfänger 3', '36_adrverif3' => 'Empfänger 3 Verifikation', '36_adressatfalsch' => 'Empfänger_falsch', '36_absenderort' => 'Ort Absender/Verfasser', '36_absortverif1' => 'Ort Verfasser Verifikation', '36_absortungenau' => 'Ort Verfasser ungenau', '36_absenderort2' => 'Ort Verfasser 2', '36_absortverif2' => 'Ort Verfasser 2 Verifikation', '36_absenderort3' => 'Ort Verfasser 3', '36_absortverif3' => 'Ort Verfasser 3 Verifikation', '36_adressatort' => 'Ort Adressat/Empfänger', '36_adrortverif' => 'Ort Empfänger Verifikation', '36_datumvon' => 'Datum von', '36_datumbis' => 'Datum bis', '36_altDat' => 'Datum/Datum manuell', '36_datumverif' => 'Datum Verifikation', '36_sortdatum' => 'Datum zum Sortieren', '36_wochentag' => 'Wochentag nicht erzeugen', '36_sortdatum1' => 'Briefsortierung', '36_fremddatierung' => 'Fremddatierung', '36_typ' => 'Brieftyp', '36_briefid' => 'Brief Identifier', '36_purl_web' => 'PURL web', '36_status' => 'Bearbeitungsstatus', '36_anmerkung' => 'Anmerkung (intern)', '36_anmerkungextern' => 'Anmerkung (extern)', '36_datengeber' => 'Datengeber', '36_purl' => 'OAI-Id', '36_leitd' => 'Druck 1:Bibliographische Angabe', '36_druck2' => 'Druck 2:Bibliographische Angabe', '36_druck3' => 'Druck 3:Bibliographische Angabe', '36_internhand' => 'Zugehörige Handschrift', '36_datengeberhand' => 'Datengeber', '36_purlhand' => 'OAI-Id', '36_purlhand_alt' => 'OAI-Id (alternative)', '36_signaturhand' => 'Signatur', '36_signaturhand_alt' => 'Signatur (alternative)', '36_h1prov' => 'Provenienz', '36_h1zahl' => 'Blatt-/Seitenzahl', '36_h1format' => 'Format', '36_h1besonder' => 'Besonderheiten', '36_hueberlieferung' => 'Ãœberlieferung', '36_infoinhalt' => 'Verschollen/erschlossen: Information über den Inhalt', '36_heditor' => 'Editor/in', '36_hredaktion' => 'Redakteur/in', '36_interndruck' => 'Zugehörige Druck', '36_band' => 'KFSA Band', '36_briefnr' => 'KFSA Brief-Nr.', '36_briefseite' => 'KFSA Seite', '36_incipit' => 'Incipit', '36_textgrundlage' => 'Textgrundlage Sigle', '36_uberstatus' => 'Ãœberlieferungsstatus', '36_gattung' => 'Gattung', '36_korrepsondentds' => 'Korrespondent_DS', '36_korrepsondentfs' => 'Korrespondent_FS', '36_ermitteltvon' => 'Ermittelt von', '36_metadatenintern' => 'Metadaten (intern)', '36_beilagen' => 'Beilage(en)', '36_abszusatz' => 'Verfasser Zusatzinfos', '36_adrzusatz' => 'Empfänger Zusatzinfos', '36_absortzusatz' => 'Verfasser Ort Zusatzinfos', '36_adrortzusatz' => 'Empfänger Ort Zusatzinfos', '36_datumzusatz' => 'Datum Zusatzinfos', '36_' => '', '36_KFSA Hand.hueberleiferung' => 'Ãœberlieferungsträger', '36_KFSA Hand.harchiv' => 'Archiv', '36_KFSA Hand.hsignatur' => 'Signatur', '36_KFSA Hand.hprovenienz' => 'Provenienz', '36_KFSA Hand.harchivlalt' => 'Archiv_alt', '36_KFSA Hand.hsignaturalt' => 'Signatur_alt', '36_KFSA Hand.hblattzahl' => 'Blattzahl', '36_KFSA Hand.hseitenzahl' => 'Seitenzahl', '36_KFSA Hand.hformat' => 'Format', '36_KFSA Hand.hadresse' => 'Adresse', '36_KFSA Hand.hvollstaendig' => 'Vollständigkeit', '36_KFSA Hand.hzusatzinfo' => 'H Zusatzinfos', '36_KFSA Druck.drliteratur' => 'Druck in', '36_KFSA Druck.drsigle' => 'Sigle', '36_KFSA Druck.drbandnrseite' => 'Bd./Nr./S.', '36_KFSA Druck.drfaksimile' => 'Faksimile', '36_KFSA Druck.drvollstaendig' => 'Vollständigkeit', '36_KFSA Druck.dzusatzinfo' => 'D Zusatzinfos', '36_KFSA Doku.dokliteratur' => 'Dokumentiert in', '36_KFSA Doku.doksigle' => 'Sigle', '36_KFSA Doku.dokbandnrseite' => 'Bd./Nr./S.', '36_KFSA Doku.dokfaksimile' => 'Faksimile', '36_KFSA Doku.dokvollstaendig' => 'Vollständigkeit', '36_KFSA Doku.dokzusatzinfo' => 'A Zusatzinfos', '36_Link Druck.url_titel_druck' => 'Titel/Bezeichnung', '36_Link Druck.url_image_druck' => 'Link zu Online-Dokument', '36_Link Hand.url_titel_hand' => 'Titel/Bezeichnung', '36_Link Hand.url_image_hand' => 'Link zu Online-Dokument', '36_preasentation' => 'Nicht in die Präsentation', '36_verlag' => 'Verlag', '36_anhang_tite0' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename0' => 'Image', '36_anhang_tite1' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename1' => 'Image', '36_anhang_tite2' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename2' => 'Image', '36_anhang_tite3' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename3' => 'Image', '36_anhang_tite4' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename4' => 'Image', '36_anhang_tite5' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename5' => 'Image', '36_anhang_tite6' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename6' => 'Image', '36_anhang_tite7' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename7' => 'Image', '36_anhang_tite8' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename8' => 'Image', '36_anhang_tite9' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename9' => 'Image', '36_anhang_titea' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcenamea' => 'Image', '36_anhang_titeb' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcenameb' => 'Image', '36_anhang_titec' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcenamec' => 'Image', '36_anhang_tited' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcenamed' => 'Image', '36_anhang_titee' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcenamee' => 'Image', '36_anhang_titeu' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcenameu' => 'Image', '36_anhang_titev' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcenamev' => 'Image', '36_anhang_titew' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcenamew' => 'Image', '36_anhang_titex' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcenamex' => 'Image', '36_anhang_titey' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcenamey' => 'Image', '36_anhang_titez' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcenamez' => 'Image', '36_anhang_tite10' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename10' => 'Image', '36_anhang_tite11' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename11' => 'Image', '36_anhang_tite12' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename12' => 'Image', '36_anhang_tite13' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename13' => 'Image', '36_anhang_tite14' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename14' => 'Image', '36_anhang_tite15' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename15' => 'Image', '36_anhang_tite16' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename16' => 'Image', '36_anhang_tite17' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename17' => 'Image', '36_anhang_tite18' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename18' => 'Image', '36_h_preasentation' => 'Nicht in die Präsentation', '36_anhang_titef' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcenamef' => 'Image', '36_anhang_titeg' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcenameg' => 'Image', '36_anhang_titeh' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcenameh' => 'Image', '36_anhang_titei' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcenamei' => 'Image', '36_anhang_titej' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcenamej' => 'Image', '36_anhang_titek' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcenamek' => 'Image', '36_anhang_titel' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcenamel' => 'Image', '36_anhang_titem' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcenamem' => 'Image', '36_anhang_titen' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcenamen' => 'Image', '36_anhang_titeo' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcenameo' => 'Image', '36_anhang_titep' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcenamep' => 'Image', '36_anhang_titeq' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcenameq' => 'Image', '36_anhang_titer' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcenamer' => 'Image', '36_anhang_tites' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcenames' => 'Image', '36_anhang_titet' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcenamet' => 'Image', '36_anhang_tite19' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename19' => 'Image', '36_anhang_tite20' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename20' => 'Image', '36_anhang_tite21' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename21' => 'Image', '36_anhang_tite22' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename22' => 'Image', '36_anhang_tite23' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename23' => 'Image', '36_anhang_tite24' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename24' => 'Image', '36_anhang_tite25' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename25' => 'Image', '36_anhang_tite26' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename26' => 'Image', '36_anhang_tite27' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename27' => 'Image', '36_anhang_tite28' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename28' => 'Image', '36_anhang_tite29' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename29' => 'Image', '36_anhang_tite30' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename30' => 'Image', '36_anhang_tite31' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename32' => 'Image', '36_anhang_tite33' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename33' => 'Image', '36_anhang_tite34' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename34' => 'Image', '36_Relationen.relation_art' => 'Art', '36_Relationen.relation_link' => 'Interner Link', '36_volltext' => 'Brieftext (Digitalisat Leitdruck oder Transkript Handschrift)', '36_History.hisbearbeiter' => 'Bearbeiter', '36_History.hisschritt' => 'Bearbeitungsschritt', '36_History.hisdatum' => 'Datum', '36_History.hisnotiz' => 'Notiz', '36_personen' => 'Personen', '36_werke' => 'Werke', '36_orte' => 'Orte', '36_themen' => 'Themen', '36_briedfehlt' => 'Fehlt', '36_briefbestellt' => 'Bestellt', '36_intrans' => 'Transkription', '36_intranskorr1' => 'Transkription Korrektur 1', '36_intranskorr2' => 'Transkription Korrektur 2', '36_intranscheck' => 'Transkription Korr. geprüft', '36_intranseintr' => 'Transkription Korr. eingetr', '36_inannotcheck' => 'Auszeichnungen Reg. geprüft', '36_inkollation' => 'Auszeichnungen Kollationierung', '36_inkollcheck' => 'Auszeichnungen Koll. geprüft', '36_himageupload' => 'H/h Digis hochgeladen', '36_dimageupload' => 'D Digis hochgeladen', '36_stand' => 'Bearbeitungsstand (Webseite)', '36_stand_d' => 'Bearbeitungsstand (Druck)', '36_timecreate' => 'Erstellt am', '36_timelastchg' => 'Zuletzt gespeichert am', '36_comment' => 'Kommentar(intern)', '36_accessid' => 'Access ID', '36_accessidalt' => 'Access ID-alt', '36_digifotos' => 'Digitalisat Fotos', '36_imagelink' => 'Imagelink', '36_vermekrbehler' => 'Notizen Behler', '36_vermekrotto' => 'Anmerkungen Otto', '36_vermekraccess' => 'Bearb-Vermerke Access', '36_zeugenbeschreib' => 'Zeugenbeschreibung', '36_sprache' => 'Sprache', '36_accessinfo1' => 'Archiv H (+ Signatur)', '36_korrekturbd36' => 'Korrekturen Bd. 36', '36_druckbd36' => 'Druckrelevant Bd. 36', '36_digitalisath1' => 'Digitalisat_H', '36_digitalisath2' => 'Digitalisat_h', '36_titelhs' => 'Titel_Hs', '36_accessinfo2' => 'Archiv H (+ Signatur)', '36_accessinfo3' => 'Sigle (Dokumentiert in + Bd./Nr./S.)', '36_accessinfo4' => 'Sigle (Druck in + Bd./Nr./S.)', '36_KFSA Hand.hschreibstoff' => 'Schreibstoff', '36_Relationen.relation_anmerkung' => null, '36_anhang_tite35' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename35' => 'Image', '36_anhang_tite36' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename36' => 'Image', '36_anhang_tite37' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename37' => 'Image', '36_anhang_tite38' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename38' => 'Image', '36_anhang_tite39' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename39' => 'Image', '36_anhang_tite40' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename40' => 'Image', '36_anhang_tite41' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename41' => 'Image', '36_anhang_tite42' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename42' => 'Image', '36_anhang_tite43' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename43' => 'Image', '36_anhang_tite44' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename44' => 'Image', '36_anhang_tite45' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename45' => 'Image', '36_anhang_tite46' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename46' => 'Image', '36_anhang_tite47' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename47' => 'Image', '36_anhang_tite48' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename48' => 'Image', '36_anhang_tite49' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename49' => 'Image', '36_anhang_tite50' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename50' => 'Image', '36_anhang_tite51' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename51' => 'Image', '36_anhang_tite52' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename52' => 'Image', '36_anhang_tite53' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename53' => 'Image', '36_anhang_tite54' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename54' => 'Image', '36_KFSA Hand.hbeschreibung' => 'Beschreibung', '36_KFSA Kritanhang.krit_infotyp' => 'Infotyp', '36_KFSA Kritanhang.krit_infotext' => 'Infotext', '36_datumspezif' => 'Datum Spezifikation', 'index_orte_10' => 'Orte', 'index_orte_10.content' => 'Orte', 'index_orte_10.comment' => 'Orte (Kommentar)', 'index_personen_11' => 'Personen', 'index_personen_11.content' => 'Personen', 'index_personen_11.comment' => 'Personen (Kommentar)', 'index_werke_12' => 'Werke', 'index_werke_12.content' => 'Werke', 'index_werke_12.comment' => 'Werke (Kommentar)', 'index_periodika_13' => 'Periodika', 'index_periodika_13.content' => 'Periodika', 'index_periodika_13.comment' => 'Periodika (Kommentar)', 'index_sachen_14' => 'Sachen', 'index_sachen_14.content' => 'Sachen', 'index_sachen_14.comment' => 'Sachen (Kommentar)', 'index_koerperschaften_15' => 'Koerperschaften', 'index_koerperschaften_15.content' => 'Koerperschaften', 'index_koerperschaften_15.comment' => 'Koerperschaften (Kommentar)', 'index_zitate_16' => 'Zitate', 'index_zitate_16.content' => 'Zitate', 'index_zitate_16.comment' => 'Zitate (Kommentar)', 'index_korrespondenzpartner_17' => 'Korrespondenzpartner', 'index_korrespondenzpartner_17.content' => 'Korrespondenzpartner', 'index_korrespondenzpartner_17.comment' => 'Korrespondenzpartner (Kommentar)', 'index_archive_18' => 'Archive', 'index_archive_18.content' => 'Archive', 'index_archive_18.comment' => 'Archive (Kommentar)', 'index_literatur_19' => 'Literatur', 'index_literatur_19.content' => 'Literatur', 'index_literatur_19.comment' => 'Literatur (Kommentar)', 'index_kunstwerke_kfsa_20' => 'Kunstwerke KFSA', 'index_kunstwerke_kfsa_20.content' => 'Kunstwerke KFSA', 'index_kunstwerke_kfsa_20.comment' => 'Kunstwerke KFSA (Kommentar)', 'index_druckwerke_kfsa_21' => 'Druckwerke KFSA', 'index_druckwerke_kfsa_21.content' => 'Druckwerke KFSA', 'index_druckwerke_kfsa_21.comment' => 'Druckwerke KFSA (Kommentar)', '36_fulltext' => 'XML Volltext', '36_html' => 'HTML Volltext', '36_publicHTML' => 'HTML Volltext', '36_plaintext' => 'Volltext', 'transcript.text' => 'Transkripte', 'folders' => 'Mappen', 'notes' => 'Notizen', 'notes.title' => 'Notizen (Titel)', 'notes.content' => 'Notizen', 'notes.category' => 'Notizen (Kategorie)', 'key' => 'FuD Schlüssel' ) $query_id = '674071cd2925f' $value = '18,4 x 12,1 cm' $key = 'Format' $adrModalInfo = array( 'ID' => '3113', 'project' => '1', 'timecreate' => '2013-11-05 16:09:39', 'timelastchg' => '2017-12-20 18:27:53', 'key' => 'AWS-ap-00bu', 'docTyp' => array( 'name' => 'Person', 'id' => '39' ), '39_gebdatum' => '1783-02-01', '39_toddatum' => '1851-05-15', '39_name' => 'Koreff, Johann Ferdinand', '39_geschlecht' => 'm', '39_lebenwirken' => 'Geheimrat, Arzt, Schriftsteller Johann Ferdinand Korreff absolvierte ein Studium der Medizin in Halle und Berlin. 1803 kam Korreff zur klinischen Ausbildung nach Berlin, wo er bald Anschluss an den frühromantischen Kreis um Karl August Varnhagen von Ense fand. Anschließend war er als niedergelassener Arzt in Paris tätig, bis er 1811 Marquise Delphine de Custine als deren Leibarzt auf ihren Reisen nach Italien und in die Schweiz begleitete. Dort lernte er Karl August von Hardenberg kennen, als dessen Leibarzt er nach Berlin kam. 1816 wurde er dort Professor der Medizin und Chirurgie an der Berliner Universität und zwei Jahre später zum Regierungsrat ernannt. Korreff befasste sich mit der Theorie des Magnetismus. Als Mitglied der Akademie der Naturforschung Leopoldina veröffentlichte er neben naturphilosophischen auch literarische Schriften. Seine jüdische Herkunft und die Tatsache, dass er in der Gunst des Kanzlers Hardenberg stand, ließen ihn zum Opfer einer Intrige werden. Er ging nach Paris, wo er insbesondere die Rezeption der Werke E.T.A. Hoffmanns anstieß und sich erneut als Arzt zu etablieren versuchte.', '39_dbid' => '118777831 ', '39_pdb' => 'GND', '39_geburtsort' => array( 'ID' => '1018', 'content' => 'Breslau', 'bemerkung' => 'GND:2005949-8', 'LmAdd' => array() ), '39_sterbeort' => array( 'ID' => '171', 'content' => 'Paris', 'bemerkung' => 'GND:4044660-8', 'LmAdd' => array() ), '39_quellen' => 'NDB@https://www.deutsche-biographie.de/gnd118777831.html#ndbcontent@ WBIS@http://db.saur.de/WBIS/basicSearch.jsf@D437-122-X@ extern@Roger Paulin: August Wilhelm Schlegel. Cosmopolitan of Art and Poetry. Cambridge 2016, S. 581.@ Wikipedia@https://de.wikipedia.org/wiki/David_Ferdinand_Koreff@', '39_beziehung' => 'Koreff behandelte August Wilhelm Schlegel als Arzt. Später beförderte er maßgeblich die Gründung der Bonner Universität und setzte sich persönlich für die Berufung Schlegels ein.', '39_namevar' => 'Koreff, Johann David Ferdinand Koreff, David Johann Koreff, David Ferdinand (M) Koreff, David Koreff, F.', '39_status_person' => 'Vollständig', '39_sourcename0' => 'AWS-ap-00bu-0.jpg', 'folders' => array( (int) 0 => 'Personen', (int) 1 => 'Personen' ), '_label' => '', '_descr' => '', '_model' => 'Person', '_model_title' => 'Person', '_model_titles' => 'People', '_url' => '' ) $version = 'version-04-20' $domain = 'https://august-wilhelm-schlegel.de' $url = 'https://august-wilhelm-schlegel.de/version-04-20' $purl_web = 'https://august-wilhelm-schlegel.de/version-04-20/letters/view/3494' $state = '01.04.2020' $citation = 'Digitale Edition der Korrespondenz August Wilhelm Schlegels [01.04.2020]; August Wilhelm von Schlegel an Johann Ferdinand Koreff; 19.01.1820' $lettermsg1 = 'August Wilhelm Schlegel: Digitale Edition der Korrespondenz [Version-04-20]' $lettermsg2 = ' <a href="https://august-wilhelm-schlegel.de/version-04-20/letters/view/3494">https://august-wilhelm-schlegel.de/version-04-20/letters/view/3494</a>.' $changeLeit = array( (int) 0 => 'Oppeln-Bronikowski', (int) 1 => ' Friedrich von: David Ferdinand Koreff. Berlin u.a. 1928' ) $sprache = 'Deutsch' $caption = array( 'data' => array( (int) 7488 => array( 'id' => '7488', 'art' => 'Abschrift', 'datum' => '19.01.1820', 'datengeber' => 'Kraków, Biblioteka Jagiellońska', 'image' => array( [maximum depth reached] ) ), (int) 7507 => array( 'id' => '7507', 'art' => 'Original', 'datum' => '19.01.1820', 'datengeber' => 'Kraków, Biblioteka Jagiellońska', 'image' => array( [maximum depth reached] ) ) ), 'exists' => '1', 'content' => 'Zugehörige Dokumente' ) $tab = 'related' $n = (int) 1 $image = '/cake_fud/files/temp/images/dzi/76fc9363be063aad87c6ebd7da78948b.jpg.xml'
include - APP/View/Letters/view.ctp, line 360 View::_evaluate() - APP/Lib/cakephp/lib/Cake/View/View.php, line 971 View::_render() - APP/Lib/cakephp/lib/Cake/View/View.php, line 933 View::render() - APP/Lib/cakephp/lib/Cake/View/View.php, line 473 Controller::render() - APP/Lib/cakephp/lib/Cake/Controller/Controller.php, line 968 Dispatcher::_invoke() - APP/Lib/cakephp/lib/Cake/Routing/Dispatcher.php, line 200 Dispatcher::dispatch() - APP/Lib/cakephp/lib/Cake/Routing/Dispatcher.php, line 167 [main] - APP/webroot/index.php, line 109
[1] [Bonn,] 19. Januar 1820.
Ihren Brief vom 8. Januar erhielt ich vor einigen Tagen, mein teurer und hochverehrter Freund, und eile zuvörderst, Ihren freundschaftlichen Vorwürfen zu begegnen. Meine Gesinnungen gegen Sie können sich nie ändern. Ich werde Ihnen zeitlebens dankbar sein für die freundschaftliche Wärme, womit Sie zu meiner Hilfe herbeigeeilt sind, als ich in Auxerre krank lag: ich erzähle es gern, daß Sie mich damals den Klauen ungeschickter Ärzte, oder was einerlei ist, dem Tode entrissen haben. Aber ich fand nicht bloß eine Befriedigung des Herzens in Ihrem Wohlwollen, Ihr Umgang gewährte mir den lebhaftesten Genuß, und die Tage, die ich mit Ihnen in Paris, auf dem Lande, in der Schweiz, oder wo es sein mochte, zugebracht, gehören zu meinen angenehmsten Erinnerungen.
Immer freute ich mich, in Ihnen den witzigen Gesellschafter, den geistreichen Beobachter der Welt, den ideenreichen Forscher wiederzufinden und meinen Geist durch Ihre Mitteilungen anzuregen. Als ich im Jahre 1817 einen unersetzlichen Verlust erlitten hatte, als die Auflösung eines Verhältnisses ohnegleichen durch den Tod mir eine unerwünschte Freiheit wiedergab, habe ich in Ihren Einladungen zur Rückkehr nach Deutschland aufs neue Ihren freundschaftlichen Eifer erkannt. Bei unserem Zusammentreffen in Koblenz und in Bonn glaubte ich von Ihrer Seite einige Zurückhaltung [2] zu bemerken und vermied es, diese Grenze zu durchbrechen. Seitdem ist, soviel ich weiß, keine Botschaft von Ihnen zu mir gelangt, sonst wäre sie nicht unerwidert geblieben. Sie kennen meine alte Nachlässigkeit im Briefschreiben: es ist ein Familienfehler, den sogar mein Bruder mir zugute halten muß, so wie ich ihm. Überdies, was hätte ich Ihnen, der Sie in mannigfaltigen und bedeutenden Weltverhältnissen leben, aus meiner wissenschaftlichen Eingezogenheit Unterhaltendes melden können? Dazu kam, daß ich seit meiner Ankunft in Bonn sehr häufig verstimmt war, und zwar durch einen Verdruß der Art, wovon man nicht gern redet. Dies führt mich auf die Verleumdungen, deren Sie erwähnen. Sie können, mein teurer Freund, keine sehr schweren Kämpfe zu bestehen gehabt haben, denn die lügenhafte Abgeschmacktheit dieser Verleumdungen mußte jedem Unbefangenen in die Augen springen. Vergebens habe ich die Urheber durch die geringschätzigste Zurückweisung ihrer Zumutungen aufgefordert, ans Licht hervorzutreten, um mir alsdann volle Genugtuung zu schaffen. Sie haben sich wohl davor gehütet. Sie hatten mit bleiernen Pfeilen auf eine stählerne Rüstung geschossen. Das flüchtige Aufsehen ist längst in tiefe Vergessenheit begraben, ich genieße aus der Ferne und Nähe der gewohnten Achtung. Übrigens waren in Berlin zwei verehrte Freunde von mir, der General v. Müffling und der Staatsrat Hufeland, näher von der Sache unterrichtet und werden [3] wohl gelegentlich das Nötige gesagt haben. Wenn es Sie interessieren kann, will ich Sie ein andermal davon unterhalten: mir ist es nun schon gleichgültig geworden, aber es bleibt immer eine seltsam merkwürdige Geschichte.
Sie sehen, daß ich das Bedürfnis habe, zu Ihnen im vollen Vertrauen der Freundschaft zu reden. Aber kommen wir nach dieser schon allzu langen Vorrede auf die Hauptsache. Auch hier muß ich zuvörderst einige irrige Annahmen aus dem Wege räumen, die ich in Ihrem Briefe bemerke.
Ich gebe Ihnen mein Ehrenwort, daß ich den getanen Schritt mit niemandem verabredet, noch viel weniger mich dazu verbindlich gemacht [habe]. Der Entschluß ist ganz aus mir selbst hervorgegangen. Sollte in einer Stelle Ihres Briefes, was ich kaum glauben kann, unser allgemein geliebter und verehrter, leider ehemaliger Kurator gemeint sein, so kann ich versichern, daß er, wiewohl es ihn geschmerzt hat, sich für jetzt von der Universität zu trennen, den aufrichtigsten Anteil an ihrem fortwährenden Gedeihen nimmt, und daß er, in der Voraussetzung, ich könnte im Sinne haben, mich von dem Lehramte zurückzuziehen, mir die dringendsten Gründe entgegengestellt hat. Ich habe die Sache ganz als meine Privatangelegenheit behandelt, ich habe mich nur wenigen Freunden im engsten Vertrauen [4] eröffnet, ich habe fortgefahren, meine Vorlesungen mit dem gewohnten Fleiße zu geben, und das hiesige Publikum hat erst aus dem Berlinischen Zeitungsartikel etwas erfahren. Aber auch jetzt weiche ich den deshalb an mich geschehenden Anfragen durch unbestimmte Äußerungen aus.
Ferner muß ich erklären, daß der Aufenthalt in Bonn mir keineswegs mißfällt, sondern daß ich vielmehr eine große Neigung dazu gefaßt habe. Die heitere Gegend, das milde Klima, die bequeme Lage zu kleinen und großen Reisen, das freundschaftliche Verhältnis mit meinen Amtsgenossen, die gesellige Ungezwungenheit, selbst Beschränktheit einer kleinen Stadt sagten mir zu. Dazu kommt nun, daß ich meine gelehrten Vorräte nicht ohne Mühe und Kosten um mich her versammelt und mich angenehm eingerichtet habe. Ich hatte es recht eigentlich darauf angelegt, in meinem Hause einen literarischen Zirkel zu bilden. Ich hege keine Abneigung gegen Berlin, das ich ja von alter Zeit kenne. Nur scheute ich das rauhere Klima und die weite Entfernung von meinen Freunden in Frankreich. Auch glaubte ich den geselligen Anforderungen dort nicht ausweichen zu können, und meine Gesundheit sowohl als meine weit aussehenden Forschungen fordern eine von den Zerstreuungen der großen Welt ungestörte Ruhe.
[5] Ich habe ja selbst um die Verlängerung meines hiesigen Aufenthalts bis zum nächsten Herbst angehalten, und das Ministerium hat die Gnade gehabt, mein Gesuch zu bewilligen. Ich hoffte in der Folge, vielleicht mit dem Vorbehalt, eine Reihe von Vorlesungen in Berlin zu geben, meine definitive Bestimmung für Bonn auszuwirken. Hier fand ich eine besonders erfreuliche Sphäre gelehrter Tätigkeit, wo man die Früchte seines Fleißes gleichsam vor seinen Augen wachsen und reifen sehen konnte. Es war ein herrlicher Gedanke, hier am Rheine gründliche deutsche Bildung und Liebe dazu zu verbreiten. Sie haben recht, teuerster Freund, die kgl. preußische Regierung hat unendlich viel für Kunst und Wissenschaft getan, und die Stiftung von Bonn war ein echt vaterländisches Ereignis. Die Wahl des Ortes war die glücklichste: die königliche Freigebigkeit des Monarchen, die weise Sorgfalt des Ministeriums können nicht genug gepriesen werden. Ich war stolz darauf, Fremden, die mich besuchten, dem Grafen Montlosier, dem Herzog von Richelieu, dem Grafen Reinhard, den großen Umfang und die Vortrefflichkeit der neuen Anstalt darlegen zu können. Ich brachte sie zu dem Geständnis, daß es in Frankreich, wenigstens außer Paris, nichts Ähnliches gebe. Ich lege Ihnen einen Brief des Herzogs von Richelieu bei, den er mir kurz nach seinem Besuche schrieb.
Wenn viel für uns [6] geschehen war, so haben wir uns auch unsererseits wacker gerührt. Vierhundert Studierende, darunter eine große Anzahl schon gebildeter junger Männer aus allen Gegenden Deutschlands, im ersten Jahre nach der Stiftung: das ist in den Annalen der Universitäten unerhört. Ich gebe diesen Winter eine öffentliche Vorlesung vor zweihundert Zuhörern. ‒ Wenn es ungestört so fortgegangen wäre, so hätten wir in einigen Jahren an Frequenz und Ruhm auch im Auslande, mit Göttingen wetteifern mögen.
Freilich, es ist ein Großes, wenn der Staat Aufwand für wissenschaftliche Anstalten macht, den Gelehrten ihre Existenz reichlich sichert. Aber diese Wohltaten verlieren ihre Kraft, wenn nicht noch eine, die höchste hinzukommt: ehrenvolle Auszeichnungen, aufmunternde Beweise des Wohlwollens von seiten der Regierung. Der akademische Lehrer insbesondere kann das Zutrauen nicht entbehren. Und dieses Zutrauen haben wir nun durch eine unglückliche Konstellation verwirkt, ich weiß nicht wie; wenigstens scheinen mir die Anlässe in gar keinem Verhältnisse mit den Folgen zu stehen. Von einem großen Staatenverein ist das Anathema ausgesprochen worden. Der Widerhall davon ist durch Europa erschollen, und wir mögen nun bald in amerikanischen Zeitungsblättern lesen, daß wir, sämtlich oder großenteils, Verführer der Jugend sind. Doch ich will auf das, was die deutschen Universitäten im allgemeinen seit der Schrift von Stourdza betroffen hat, nicht eingehen. Mein Brief würde zum Buche [7] werden, Sie würden meiner Ansicht Ihre Gründe entgegenstellen, und am Ende würde vielleicht keiner den anderen überzeugen. Ich beschränke mich auf meine eigene Angelegenheit. Zu dem getanen Schritte hat mich nichts anderes bewogen als die Überzeugung, wovon ich auch jetzt nicht weichen kann, daß das Amt, wozu ich vor anderthalb Jahren so ehrenvoll berufen wurde, nicht mehr dasselbe ist, daß es durch die neuen Einrichtungen seine wesentlichsten Vorrechte, seine Annehmlichkeit und seine Würde verloren hat.
Sie erlassen mir wohl den Beweis, sonst bin ich erbötig, ihn nachdrücklich zu führen.
Aber Sie sagen mir, die notwendig befundenen Vorkehrungsmaßregeln seien nicht gegen Gelehrte von meinem Charakter gemeint. Es ist wahr, ich habe nie den Ehrgeiz gehabt, eine politische Rolle zu spielen, weder als Schriftsteller, noch auf andere Art: sonst hätte ich nicht so manche günstige Gelegenheit vorbeigehen lassen. Ein einziges Mal habe ich meinen Namen eingezeichnet, das war in der allgemeinen Sache des Vaterlandes, in dem europäischen Kampfe für die Selbständigkeit der Staaten. Ich bin es seit langen Jahren gewohnt, in der Mitte politischer Gärungen als ruhiger Zuschauer zu stehen, nur eine mäßigende und vermittelnde Stimme hören zu lassen und mit Menschen von allen Parteien in freundlichem Verhältnisse zu bleiben. Noch am Tage meiner Abreise [8] von Paris schrieb mir Herr von Chateaubriand, ich sei dazu berufen, die Geschichte Frankreichs im Mittelalter zu schreiben. Allein das in Deutschland erwachte Mißtrauen gegen die Gelehrten und Schriftsteller überhaupt liegt am Tage; und ein solches Mißtrauen ist nicht wie eine gewöhnliche Flamme, welche erlischt, wenn der Nahrungsstoff erschöpft ist: es phosphoresziert nur um so heller in luftleerem Raume. Wenn der Verdacht sich auf Meinungen, auch auf nicht ausgesprochene, richtet, kann ich sicher sein, daß die Meinungen des Verfassers der Schrift „Sur le système continental“ und einiger anderer politischer Schriften im Jahre 1813, des vieljährigen Freundes der Frau von Staël, des Mitherausgebers ihres nachgelassenen Werkes (ich will Sie geflissentlich an alles erinnern), immer unverdächtig scheinen werden?
Mit dem besten Willen kam ich nach Deutschland. Meine Freunde in Frankreich ließen mich ungern von sich und würden mich mit offenen Armen wieder aufnehmen. Sie wissen, daß ich dort sehr angenehme Verhältnisse habe, und wenn ich bloß meine Neigung befragt hätte, so wäre ich wohl immer da geblieben. Aber es schien mir vielleicht rühmlicher, gewiß verdienstlicher und berufsgemäßer, meine Kräfte zum Nutzen des Vaterlandes zu verwenden. Ich fand alles in scheinbar tiefer Ruhe. Plötzlich ist ein Ungewitter aufgezogen, aus einem Wölkchen, wie das war, welches der Prophet Elias am Horizont erblickte. Mein erster [9] Gedanke war, ein Obdach zu suchen. Glauben Sie mir, ich bilde mir nicht ein, zu irgend etwas notwendig zu sein: meine Entfernung vom öffentlichen Unterricht würde keine merkliche Lücke verursachen. Mein Fach gehört zu den entbehrlichen, für die nur dann Begünstigung zu hoffen ist, wenn bei vollkommen heiterer Stimmung auch an äußere Verzierung gedacht wird. Der Inhalt Ihres Briefes war mir daher etwas ganz Unerwartetes.
Sie bezeugen mir die unendlich ehrenvolle Hochschätzung des Fürsten Staatskanzlers: ich bitte Sie, den Ausdruck meiner ehrerbietigsten Gesinnungen und meiner Dankbarkeit vor Se. Durchlaucht zu bringen. Wenn ich die schmeichelhafte Überzeugung hegen darf, daß der Staatskanzler, daß der Minister von Altenstein, dessen Briefe ich als kostbare Beweise der Anerkennung aufbewahre, auf die Fortsetzung meiner wissenschaftlichen Tätigkeit im Dienste des Staats einigen Wert legen, so wirft das freilich ein bedeutendes Gewicht in die andere Wagschale.
Lassen Sie uns also miteinander überlegen, ob sich irgendein Ausweg finden läßt. Sie sagen mir, „die getroffenen Maßregeln werden mich auf keine Art unangenehm berühren, mein Leben und Wirken stehe da, vor jeder unfreundlichen Berührung geschützt, wie von einer Ägide, die kein Pfeil durchbohrt.“ Könnten Sie mir darüber eine amtliche Versicherung schaffen? Brief und Siegel? Das wäre ja gewissermaßen
[10] „Ein eisern Privilegium,
Zu hexen frank und frei herum.“
Aber im Ernst, kann irgendein Einzelner billigerweise verlangen, daß zu seinen Gunsten eine Ausnahme gemacht werde von einer allgemeinen Maßregel, die so viele würdige Männer trifft? Sonst standen zwischen den Professoren und dem Ministerium nur die Kuratoren, Männer von erlauchter Geburt und in hohen Staatsämtern, deren Namen schon den Universitäten zur Zierde gereichte; und ihre Wirksamkeit war durchaus nicht hemmend, sondern eine fördernde und aufmunternde Fürsorge. Von spezieller Aufsicht war gar nicht die Rede; sie schien um so weniger nötig, da die Grundsätze der Lehrer vor ihrer Anstellung meist durch ihre Schriften bekannt waren. In dem unerhörten Fall, daß ein Lehrer sein Amt zu übeln Zwecken gemißbraucht hätte, kam es zunächst dem akademischen Senate zu, für die Ehre und Unbescholtenheit der Universität zu sorgen. Jetzt sind Aufseher in der Nähe hingestellt mit einer unbedingten und bisher beispiellosen Vollmacht. Wie ist einem solchen Verhältnis auszuweichen? Ich sehe nur ein einziges Mittel. Die Maßregel ist nur als transitorisch, das Verhältnis der Universitäten zu den Kuratoren nur als suspendiert angekündigt worden. Es käme also darauf an, einen speziellen wissenschaftlichen Auftrag auszumitteln, dessen Ausführung mich während [11] dieser Zeit hinlänglich beschäftigte, auch wenn ich einstweilen der gewöhnlichen Geschäfte eines akademischen Lehrers überhoben würde.
Einen solchen Auftrag wüßte ich wohl. Sogleich bei meiner Rückkehr in Deutschland habe ich mein Augenmerk darauf gerichtet; aber ich hegte nicht mehr die Hoffnung, jetzt, da die Bewegungen des Augenblicks die Gemüter ganz in Anspruch nehmen, Begünstigung dafür zu finden. Sie erregen diese Hoffnung von neuem, indem Sie mir sagen, der preußische Staat werde auch jetzt fortfahren, väterlich und liberaler als jeder andre für das Gedeihen der Wissenschaft und Kunst zu sorgen.
Mein Wunsch wäre nämlich, das Studium des Sanskrit und der indischen Literatur überhaupt in Deutschland auf eine gründliche Art einheimisch zu machen. Das große gelehrte Interesse der Sache brauche ich Ihnen nicht auseinanderzusetzen: Sie sind im Besitz aller darauf bezüglichen Ideen. Ich lege einen Aufsatz bei, wodurch ich die Gönner der Wissenschaften in Berlin aufmerksam zu machen gesucht habe, er ist den Bonnischen Jahrbüchern eingerückt worden.
Noch will ich erinnern, daß nicht nur in Paris ein eigner Lehrstuhl für das Sanskrit errichtet ist, sondern daß ein deutscher Gelehrter, Fr. Bopp, mit Unterstützung der bayerischen Regierung, und, auf meine Empfehlung, insbesondere des Kronprinzen von Bayern, seit einer Anzahl von Jahren in Paris, jetzt in London, einzig zu diesem Zwecke studiert und das Versprechen [12] einer Professur in Würzburg erhalten hat. Er hat jetzt einen indischen Text in London sehr lobenswert herausgegeben, worüber ich nächstens eine Beurteilung drucken lassen werde. In Göttingen ist noch nichts geschehen, doch steht es über kurz oder lang zu erwarten, da die Verhältnisse mit England es dort besonders erleichtern.
Wenn man also, wie billig, bei keiner Erweiterung der Wissenschaft zurückbleiben will, so wäre es nötig, auf irgendeiner der preußischen Universitäten etwas für das Studium der indischen Literatur zu tun. Ich glaube, es würde für Bonn keine gleichgültige Auszeichnung sein, wenn man hier die Hilfsmittel des Sanskrit, die ich schon großenteils besitze, beisammen fände; wenn man in der Folge auch Elementarbücher und indische Texte drucken könnte. Die Lage ist besonders günstig wegen der Nähe von London und Paris, wo allein indische Manuskripte sind. Einige außerordentliche Unterstützung wäre erforderlich, aber sie würde nicht unerschwinglich sein, keineswegs außer Verhältnis mit dem, was das hohe Ministerium für andre auch nicht ganz notwendige Studien so freigebig bewilligt hat.
Diesen Lieblingsplan hatte ich nun schon völlig aufgegeben, als ich vor sechs Wochen nach Berlin schrieb. Ich überlasse es Ihnen, mein teuerster Freund, ob Sie den Versuch wagen wollen, der Sache Eingang zu verschaffen. Auf erhaltenen Befehl würde ich sogleich dem Minister [13] des öffentlichen Unterrichts einen ins einzelne gehenden Plan vorlegen.
Ich weiß wohl, daß die Ausführung mir eine Menge mühseliger und trockener Arbeiten auferlegen und daß ich einige Jahre hindurch alle Hände voll zu tun haben würde, statt daß ich, bei individueller Fortsetzung des Studiums, nur die Blüte davon pflücken und sie zu welthistorischen, philosophischen, dichterischen Zwecken benutzen könnte. Aber die Liebe zur Sache würde mir die Schwierigkeiten überwinden helfen.
Ich hoffe, Sie werden in diesen Äußerungen die Bereitwilligkeit erkennen, den Eröffnungen, die Sie mir von seiten eines erlauchten Gönners gemacht haben, entgegenzukommen. Eine Reise nach Berlin halte ich in dem gegenwärtigen Augenblick durchaus nicht für zweckmäßig.
Leben Sie recht wohl, mein teurer Freund, und erfreuen Sie mich bald mit einer Antwort. Denn nach dem getanen Schritte bin ich in der Lage jenes alten Ritters in einer spanischen Romanze:
„Schon den einen Fuß im Bügel.“
Und um einen neuen Lebensplan auszuführen, müssen doch mancherlei Anstalten getroffen werden.
[14]
[15]
[16]
Ihren Brief vom 8. Januar erhielt ich vor einigen Tagen, mein teurer und hochverehrter Freund, und eile zuvörderst, Ihren freundschaftlichen Vorwürfen zu begegnen. Meine Gesinnungen gegen Sie können sich nie ändern. Ich werde Ihnen zeitlebens dankbar sein für die freundschaftliche Wärme, womit Sie zu meiner Hilfe herbeigeeilt sind, als ich in Auxerre krank lag: ich erzähle es gern, daß Sie mich damals den Klauen ungeschickter Ärzte, oder was einerlei ist, dem Tode entrissen haben. Aber ich fand nicht bloß eine Befriedigung des Herzens in Ihrem Wohlwollen, Ihr Umgang gewährte mir den lebhaftesten Genuß, und die Tage, die ich mit Ihnen in Paris, auf dem Lande, in der Schweiz, oder wo es sein mochte, zugebracht, gehören zu meinen angenehmsten Erinnerungen.
Immer freute ich mich, in Ihnen den witzigen Gesellschafter, den geistreichen Beobachter der Welt, den ideenreichen Forscher wiederzufinden und meinen Geist durch Ihre Mitteilungen anzuregen. Als ich im Jahre 1817 einen unersetzlichen Verlust erlitten hatte, als die Auflösung eines Verhältnisses ohnegleichen durch den Tod mir eine unerwünschte Freiheit wiedergab, habe ich in Ihren Einladungen zur Rückkehr nach Deutschland aufs neue Ihren freundschaftlichen Eifer erkannt. Bei unserem Zusammentreffen in Koblenz und in Bonn glaubte ich von Ihrer Seite einige Zurückhaltung [2] zu bemerken und vermied es, diese Grenze zu durchbrechen. Seitdem ist, soviel ich weiß, keine Botschaft von Ihnen zu mir gelangt, sonst wäre sie nicht unerwidert geblieben. Sie kennen meine alte Nachlässigkeit im Briefschreiben: es ist ein Familienfehler, den sogar mein Bruder mir zugute halten muß, so wie ich ihm. Überdies, was hätte ich Ihnen, der Sie in mannigfaltigen und bedeutenden Weltverhältnissen leben, aus meiner wissenschaftlichen Eingezogenheit Unterhaltendes melden können? Dazu kam, daß ich seit meiner Ankunft in Bonn sehr häufig verstimmt war, und zwar durch einen Verdruß der Art, wovon man nicht gern redet. Dies führt mich auf die Verleumdungen, deren Sie erwähnen. Sie können, mein teurer Freund, keine sehr schweren Kämpfe zu bestehen gehabt haben, denn die lügenhafte Abgeschmacktheit dieser Verleumdungen mußte jedem Unbefangenen in die Augen springen. Vergebens habe ich die Urheber durch die geringschätzigste Zurückweisung ihrer Zumutungen aufgefordert, ans Licht hervorzutreten, um mir alsdann volle Genugtuung zu schaffen. Sie haben sich wohl davor gehütet. Sie hatten mit bleiernen Pfeilen auf eine stählerne Rüstung geschossen. Das flüchtige Aufsehen ist längst in tiefe Vergessenheit begraben, ich genieße aus der Ferne und Nähe der gewohnten Achtung. Übrigens waren in Berlin zwei verehrte Freunde von mir, der General v. Müffling und der Staatsrat Hufeland, näher von der Sache unterrichtet und werden [3] wohl gelegentlich das Nötige gesagt haben. Wenn es Sie interessieren kann, will ich Sie ein andermal davon unterhalten: mir ist es nun schon gleichgültig geworden, aber es bleibt immer eine seltsam merkwürdige Geschichte.
Sie sehen, daß ich das Bedürfnis habe, zu Ihnen im vollen Vertrauen der Freundschaft zu reden. Aber kommen wir nach dieser schon allzu langen Vorrede auf die Hauptsache. Auch hier muß ich zuvörderst einige irrige Annahmen aus dem Wege räumen, die ich in Ihrem Briefe bemerke.
Ich gebe Ihnen mein Ehrenwort, daß ich den getanen Schritt mit niemandem verabredet, noch viel weniger mich dazu verbindlich gemacht [habe]. Der Entschluß ist ganz aus mir selbst hervorgegangen. Sollte in einer Stelle Ihres Briefes, was ich kaum glauben kann, unser allgemein geliebter und verehrter, leider ehemaliger Kurator gemeint sein, so kann ich versichern, daß er, wiewohl es ihn geschmerzt hat, sich für jetzt von der Universität zu trennen, den aufrichtigsten Anteil an ihrem fortwährenden Gedeihen nimmt, und daß er, in der Voraussetzung, ich könnte im Sinne haben, mich von dem Lehramte zurückzuziehen, mir die dringendsten Gründe entgegengestellt hat. Ich habe die Sache ganz als meine Privatangelegenheit behandelt, ich habe mich nur wenigen Freunden im engsten Vertrauen [4] eröffnet, ich habe fortgefahren, meine Vorlesungen mit dem gewohnten Fleiße zu geben, und das hiesige Publikum hat erst aus dem Berlinischen Zeitungsartikel etwas erfahren. Aber auch jetzt weiche ich den deshalb an mich geschehenden Anfragen durch unbestimmte Äußerungen aus.
Ferner muß ich erklären, daß der Aufenthalt in Bonn mir keineswegs mißfällt, sondern daß ich vielmehr eine große Neigung dazu gefaßt habe. Die heitere Gegend, das milde Klima, die bequeme Lage zu kleinen und großen Reisen, das freundschaftliche Verhältnis mit meinen Amtsgenossen, die gesellige Ungezwungenheit, selbst Beschränktheit einer kleinen Stadt sagten mir zu. Dazu kommt nun, daß ich meine gelehrten Vorräte nicht ohne Mühe und Kosten um mich her versammelt und mich angenehm eingerichtet habe. Ich hatte es recht eigentlich darauf angelegt, in meinem Hause einen literarischen Zirkel zu bilden. Ich hege keine Abneigung gegen Berlin, das ich ja von alter Zeit kenne. Nur scheute ich das rauhere Klima und die weite Entfernung von meinen Freunden in Frankreich. Auch glaubte ich den geselligen Anforderungen dort nicht ausweichen zu können, und meine Gesundheit sowohl als meine weit aussehenden Forschungen fordern eine von den Zerstreuungen der großen Welt ungestörte Ruhe.
[5] Ich habe ja selbst um die Verlängerung meines hiesigen Aufenthalts bis zum nächsten Herbst angehalten, und das Ministerium hat die Gnade gehabt, mein Gesuch zu bewilligen. Ich hoffte in der Folge, vielleicht mit dem Vorbehalt, eine Reihe von Vorlesungen in Berlin zu geben, meine definitive Bestimmung für Bonn auszuwirken. Hier fand ich eine besonders erfreuliche Sphäre gelehrter Tätigkeit, wo man die Früchte seines Fleißes gleichsam vor seinen Augen wachsen und reifen sehen konnte. Es war ein herrlicher Gedanke, hier am Rheine gründliche deutsche Bildung und Liebe dazu zu verbreiten. Sie haben recht, teuerster Freund, die kgl. preußische Regierung hat unendlich viel für Kunst und Wissenschaft getan, und die Stiftung von Bonn war ein echt vaterländisches Ereignis. Die Wahl des Ortes war die glücklichste: die königliche Freigebigkeit des Monarchen, die weise Sorgfalt des Ministeriums können nicht genug gepriesen werden. Ich war stolz darauf, Fremden, die mich besuchten, dem Grafen Montlosier, dem Herzog von Richelieu, dem Grafen Reinhard, den großen Umfang und die Vortrefflichkeit der neuen Anstalt darlegen zu können. Ich brachte sie zu dem Geständnis, daß es in Frankreich, wenigstens außer Paris, nichts Ähnliches gebe. Ich lege Ihnen einen Brief des Herzogs von Richelieu bei, den er mir kurz nach seinem Besuche schrieb.
Wenn viel für uns [6] geschehen war, so haben wir uns auch unsererseits wacker gerührt. Vierhundert Studierende, darunter eine große Anzahl schon gebildeter junger Männer aus allen Gegenden Deutschlands, im ersten Jahre nach der Stiftung: das ist in den Annalen der Universitäten unerhört. Ich gebe diesen Winter eine öffentliche Vorlesung vor zweihundert Zuhörern. ‒ Wenn es ungestört so fortgegangen wäre, so hätten wir in einigen Jahren an Frequenz und Ruhm auch im Auslande, mit Göttingen wetteifern mögen.
Freilich, es ist ein Großes, wenn der Staat Aufwand für wissenschaftliche Anstalten macht, den Gelehrten ihre Existenz reichlich sichert. Aber diese Wohltaten verlieren ihre Kraft, wenn nicht noch eine, die höchste hinzukommt: ehrenvolle Auszeichnungen, aufmunternde Beweise des Wohlwollens von seiten der Regierung. Der akademische Lehrer insbesondere kann das Zutrauen nicht entbehren. Und dieses Zutrauen haben wir nun durch eine unglückliche Konstellation verwirkt, ich weiß nicht wie; wenigstens scheinen mir die Anlässe in gar keinem Verhältnisse mit den Folgen zu stehen. Von einem großen Staatenverein ist das Anathema ausgesprochen worden. Der Widerhall davon ist durch Europa erschollen, und wir mögen nun bald in amerikanischen Zeitungsblättern lesen, daß wir, sämtlich oder großenteils, Verführer der Jugend sind. Doch ich will auf das, was die deutschen Universitäten im allgemeinen seit der Schrift von Stourdza betroffen hat, nicht eingehen. Mein Brief würde zum Buche [7] werden, Sie würden meiner Ansicht Ihre Gründe entgegenstellen, und am Ende würde vielleicht keiner den anderen überzeugen. Ich beschränke mich auf meine eigene Angelegenheit. Zu dem getanen Schritte hat mich nichts anderes bewogen als die Überzeugung, wovon ich auch jetzt nicht weichen kann, daß das Amt, wozu ich vor anderthalb Jahren so ehrenvoll berufen wurde, nicht mehr dasselbe ist, daß es durch die neuen Einrichtungen seine wesentlichsten Vorrechte, seine Annehmlichkeit und seine Würde verloren hat.
Sie erlassen mir wohl den Beweis, sonst bin ich erbötig, ihn nachdrücklich zu führen.
Aber Sie sagen mir, die notwendig befundenen Vorkehrungsmaßregeln seien nicht gegen Gelehrte von meinem Charakter gemeint. Es ist wahr, ich habe nie den Ehrgeiz gehabt, eine politische Rolle zu spielen, weder als Schriftsteller, noch auf andere Art: sonst hätte ich nicht so manche günstige Gelegenheit vorbeigehen lassen. Ein einziges Mal habe ich meinen Namen eingezeichnet, das war in der allgemeinen Sache des Vaterlandes, in dem europäischen Kampfe für die Selbständigkeit der Staaten. Ich bin es seit langen Jahren gewohnt, in der Mitte politischer Gärungen als ruhiger Zuschauer zu stehen, nur eine mäßigende und vermittelnde Stimme hören zu lassen und mit Menschen von allen Parteien in freundlichem Verhältnisse zu bleiben. Noch am Tage meiner Abreise [8] von Paris schrieb mir Herr von Chateaubriand, ich sei dazu berufen, die Geschichte Frankreichs im Mittelalter zu schreiben. Allein das in Deutschland erwachte Mißtrauen gegen die Gelehrten und Schriftsteller überhaupt liegt am Tage; und ein solches Mißtrauen ist nicht wie eine gewöhnliche Flamme, welche erlischt, wenn der Nahrungsstoff erschöpft ist: es phosphoresziert nur um so heller in luftleerem Raume. Wenn der Verdacht sich auf Meinungen, auch auf nicht ausgesprochene, richtet, kann ich sicher sein, daß die Meinungen des Verfassers der Schrift „Sur le système continental“ und einiger anderer politischer Schriften im Jahre 1813, des vieljährigen Freundes der Frau von Staël, des Mitherausgebers ihres nachgelassenen Werkes (ich will Sie geflissentlich an alles erinnern), immer unverdächtig scheinen werden?
Mit dem besten Willen kam ich nach Deutschland. Meine Freunde in Frankreich ließen mich ungern von sich und würden mich mit offenen Armen wieder aufnehmen. Sie wissen, daß ich dort sehr angenehme Verhältnisse habe, und wenn ich bloß meine Neigung befragt hätte, so wäre ich wohl immer da geblieben. Aber es schien mir vielleicht rühmlicher, gewiß verdienstlicher und berufsgemäßer, meine Kräfte zum Nutzen des Vaterlandes zu verwenden. Ich fand alles in scheinbar tiefer Ruhe. Plötzlich ist ein Ungewitter aufgezogen, aus einem Wölkchen, wie das war, welches der Prophet Elias am Horizont erblickte. Mein erster [9] Gedanke war, ein Obdach zu suchen. Glauben Sie mir, ich bilde mir nicht ein, zu irgend etwas notwendig zu sein: meine Entfernung vom öffentlichen Unterricht würde keine merkliche Lücke verursachen. Mein Fach gehört zu den entbehrlichen, für die nur dann Begünstigung zu hoffen ist, wenn bei vollkommen heiterer Stimmung auch an äußere Verzierung gedacht wird. Der Inhalt Ihres Briefes war mir daher etwas ganz Unerwartetes.
Sie bezeugen mir die unendlich ehrenvolle Hochschätzung des Fürsten Staatskanzlers: ich bitte Sie, den Ausdruck meiner ehrerbietigsten Gesinnungen und meiner Dankbarkeit vor Se. Durchlaucht zu bringen. Wenn ich die schmeichelhafte Überzeugung hegen darf, daß der Staatskanzler, daß der Minister von Altenstein, dessen Briefe ich als kostbare Beweise der Anerkennung aufbewahre, auf die Fortsetzung meiner wissenschaftlichen Tätigkeit im Dienste des Staats einigen Wert legen, so wirft das freilich ein bedeutendes Gewicht in die andere Wagschale.
Lassen Sie uns also miteinander überlegen, ob sich irgendein Ausweg finden läßt. Sie sagen mir, „die getroffenen Maßregeln werden mich auf keine Art unangenehm berühren, mein Leben und Wirken stehe da, vor jeder unfreundlichen Berührung geschützt, wie von einer Ägide, die kein Pfeil durchbohrt.“ Könnten Sie mir darüber eine amtliche Versicherung schaffen? Brief und Siegel? Das wäre ja gewissermaßen
[10] „Ein eisern Privilegium,
Zu hexen frank und frei herum.“
Aber im Ernst, kann irgendein Einzelner billigerweise verlangen, daß zu seinen Gunsten eine Ausnahme gemacht werde von einer allgemeinen Maßregel, die so viele würdige Männer trifft? Sonst standen zwischen den Professoren und dem Ministerium nur die Kuratoren, Männer von erlauchter Geburt und in hohen Staatsämtern, deren Namen schon den Universitäten zur Zierde gereichte; und ihre Wirksamkeit war durchaus nicht hemmend, sondern eine fördernde und aufmunternde Fürsorge. Von spezieller Aufsicht war gar nicht die Rede; sie schien um so weniger nötig, da die Grundsätze der Lehrer vor ihrer Anstellung meist durch ihre Schriften bekannt waren. In dem unerhörten Fall, daß ein Lehrer sein Amt zu übeln Zwecken gemißbraucht hätte, kam es zunächst dem akademischen Senate zu, für die Ehre und Unbescholtenheit der Universität zu sorgen. Jetzt sind Aufseher in der Nähe hingestellt mit einer unbedingten und bisher beispiellosen Vollmacht. Wie ist einem solchen Verhältnis auszuweichen? Ich sehe nur ein einziges Mittel. Die Maßregel ist nur als transitorisch, das Verhältnis der Universitäten zu den Kuratoren nur als suspendiert angekündigt worden. Es käme also darauf an, einen speziellen wissenschaftlichen Auftrag auszumitteln, dessen Ausführung mich während [11] dieser Zeit hinlänglich beschäftigte, auch wenn ich einstweilen der gewöhnlichen Geschäfte eines akademischen Lehrers überhoben würde.
Einen solchen Auftrag wüßte ich wohl. Sogleich bei meiner Rückkehr in Deutschland habe ich mein Augenmerk darauf gerichtet; aber ich hegte nicht mehr die Hoffnung, jetzt, da die Bewegungen des Augenblicks die Gemüter ganz in Anspruch nehmen, Begünstigung dafür zu finden. Sie erregen diese Hoffnung von neuem, indem Sie mir sagen, der preußische Staat werde auch jetzt fortfahren, väterlich und liberaler als jeder andre für das Gedeihen der Wissenschaft und Kunst zu sorgen.
Mein Wunsch wäre nämlich, das Studium des Sanskrit und der indischen Literatur überhaupt in Deutschland auf eine gründliche Art einheimisch zu machen. Das große gelehrte Interesse der Sache brauche ich Ihnen nicht auseinanderzusetzen: Sie sind im Besitz aller darauf bezüglichen Ideen. Ich lege einen Aufsatz bei, wodurch ich die Gönner der Wissenschaften in Berlin aufmerksam zu machen gesucht habe, er ist den Bonnischen Jahrbüchern eingerückt worden.
Noch will ich erinnern, daß nicht nur in Paris ein eigner Lehrstuhl für das Sanskrit errichtet ist, sondern daß ein deutscher Gelehrter, Fr. Bopp, mit Unterstützung der bayerischen Regierung, und, auf meine Empfehlung, insbesondere des Kronprinzen von Bayern, seit einer Anzahl von Jahren in Paris, jetzt in London, einzig zu diesem Zwecke studiert und das Versprechen [12] einer Professur in Würzburg erhalten hat. Er hat jetzt einen indischen Text in London sehr lobenswert herausgegeben, worüber ich nächstens eine Beurteilung drucken lassen werde. In Göttingen ist noch nichts geschehen, doch steht es über kurz oder lang zu erwarten, da die Verhältnisse mit England es dort besonders erleichtern.
Wenn man also, wie billig, bei keiner Erweiterung der Wissenschaft zurückbleiben will, so wäre es nötig, auf irgendeiner der preußischen Universitäten etwas für das Studium der indischen Literatur zu tun. Ich glaube, es würde für Bonn keine gleichgültige Auszeichnung sein, wenn man hier die Hilfsmittel des Sanskrit, die ich schon großenteils besitze, beisammen fände; wenn man in der Folge auch Elementarbücher und indische Texte drucken könnte. Die Lage ist besonders günstig wegen der Nähe von London und Paris, wo allein indische Manuskripte sind. Einige außerordentliche Unterstützung wäre erforderlich, aber sie würde nicht unerschwinglich sein, keineswegs außer Verhältnis mit dem, was das hohe Ministerium für andre auch nicht ganz notwendige Studien so freigebig bewilligt hat.
Diesen Lieblingsplan hatte ich nun schon völlig aufgegeben, als ich vor sechs Wochen nach Berlin schrieb. Ich überlasse es Ihnen, mein teuerster Freund, ob Sie den Versuch wagen wollen, der Sache Eingang zu verschaffen. Auf erhaltenen Befehl würde ich sogleich dem Minister [13] des öffentlichen Unterrichts einen ins einzelne gehenden Plan vorlegen.
Ich weiß wohl, daß die Ausführung mir eine Menge mühseliger und trockener Arbeiten auferlegen und daß ich einige Jahre hindurch alle Hände voll zu tun haben würde, statt daß ich, bei individueller Fortsetzung des Studiums, nur die Blüte davon pflücken und sie zu welthistorischen, philosophischen, dichterischen Zwecken benutzen könnte. Aber die Liebe zur Sache würde mir die Schwierigkeiten überwinden helfen.
Ich hoffe, Sie werden in diesen Äußerungen die Bereitwilligkeit erkennen, den Eröffnungen, die Sie mir von seiten eines erlauchten Gönners gemacht haben, entgegenzukommen. Eine Reise nach Berlin halte ich in dem gegenwärtigen Augenblick durchaus nicht für zweckmäßig.
Leben Sie recht wohl, mein teurer Freund, und erfreuen Sie mich bald mit einer Antwort. Denn nach dem getanen Schritte bin ich in der Lage jenes alten Ritters in einer spanischen Romanze:
„Schon den einen Fuß im Bügel.“
Und um einen neuen Lebensplan auszuführen, müssen doch mancherlei Anstalten getroffen werden.
[14]
[15]
[16]