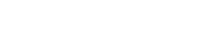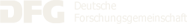Zu meiner Genugtuung erhielt ich gestern Ihre beiden Briefe vom 24. und 27.; ich weiß nicht, was für ein Grund eigentlich vorlag, daß der erste so verspätet ankam.
Liebe Freundin! Augenblicklich bin ich nicht imstande, meiner Stiefschwester einen Rat zu geben. Getrennt von ihr, wie ich es bin, fehlen mir die Voraussetzungen dafür. Wegen ihres Befindens muß sie den Rat der Ärzte einholen und selber dafür sorgen, daß sie nicht mehr seelisch leidet. Hat sie sich entschlossen, ihre Angelegenheiten in Ordnung zu bringen, so weiß sie ganz genau, daß ich immer dienstbereit ihr zur Verfügung stehe und daß ich alles daran setzen werde, ihre Pläne zu verwirklichen.
Ich glaube, Herr von B[alk] sieht mit etwas Mißgunst auf Friedrichs neues Vaterland [Österreich]. Das, was Sie mir hierüber mitteilen, bestätigen meine eigenen Beobachtungen – auch fürchte ich, er sieht zu rosig, wenn er meint, ein deutscher Professor könne in seinem Vaterlande [Rußland] ohne weiteres eine Stellung finden. Doch im allgemeinen stimmt das, was er sagt, mit den augenblicklichen Umständen überein.
Ihren schönen Artikel über Camoëns werde ich durchdenken und Ihnen meine wenigen Bemerkungen dazu zuschicken. Doch ich fürchte, ich vermag nichts Wesentliches hinzuzufügen, denn ich kann mir die nötigen Bücher nicht verschaffen. Ich finde es sehr liebenswürdig von Ihnen, einen solchen Artikel beizusteuern, allerdings ist der Rahmen für Sie zu eng gespannt –: solch ein Abriß biographischer Notizen wird durch weitgreifende Gedankenreihen geradezu erdrückt.
Liebe Freundin! Ich habe das Empfinden, Sie mißbrauchen mein Vertrauen, wenn Sie sich als Zensor, als puritanischen Zensor über ein höchst unschuldiges Verhältnis aufspielen, über das ich mit der größten Aufrichtigkeit zu Ihnen gesprochen habe: – Sie sollten mir doch auf mein Wort glauben und nicht auf das hören, was andere sagen. Ferner ist es ungerecht und geht darauf aus, den andern einfach zu unterdrücken, statt seine individuellen Ansprüche anzuerkennen. Sie sind gereizt, weil ich für einige Monate ein Glück gefunden habe, auf das ich eigentlich immer Anrecht hätte. Viel zu viel Menschen sind um Sie herum, das müssen Sie mir doch zugeben. Das gefällt Ihnen sehr. Wenn ich auch das Glück würdige, mit Ihnen zusammen sein zu dürfen, so muß ich Ihnen doch sagen, daß ich mich oft schauderhaft allein fühle. Warum sollte nicht neben der wenigen freien Zeit, die Sie für mich übrig haben, noch weiter Raum für eine Freundschaft da sein, die den Geist ausruhen läßt und die Phantasie anregt?
Den Genfern bin ich sehr dankbar dafür, daß sie sich so angelegentlich damit beschäftigen, wohin ich gehe und in welcher Gesellschaft ich verkehre – leider kann ich nicht Gleiches mit Gleichem vergelten — und ich bekenne Ihnen, daß ich wirklich nicht weiß, wer einer Dame in Genf den Hof macht und ob es jemand überhaupt tut. Ich bin für meine Sünden fünf Jahre lang in diesen Eispalast eingesperrt worden, und niemals habe ich eine Frau gefunden, die an meiner Unterhaltung den geringsten Gefallen gefunden und die ich nicht geradezu beleidigt hätte, wenn ich mir hätte einfallen lassen wollen, sie alle Tage zu besuchen und meine Nachmittage bei ihr zu verbringen. Ich verabscheue Besuche, die man nur der Form wegen macht, ich verabscheue diese abgeschmackten Gesellschaften von hundert Personen; ein wirklich inneres Leben ist nur zu zweit oder im Rahmen eines kleinen Zirkels von Freunden möglich: das ist dann dasselbe. So leben wir Deutschen – wir sehen uns eben jeden Tag oder überhaupt nicht – und dieses Leben habe ich wieder begonnen, als ich es auf meinem Wege fand. – Sie aber machen mir daraus ein Verbrechen.
Frau H[aller] hat Herz, sie hat Geist, ohne viel Wesens davon zu machen. Sie liebt die deutsche Literatur, sie liebt die Dichtkunst im allgemeinen. Aber da sie sich niemals darauf etwas einbildete, so konnte ich ihr zu meinem Vergnügen viele schöne Dinge mitteilen, die für sie ganz neu waren. Sie spricht meine Muttersprache mit Anmut, während sonst jederman hier nur fürchterlich ›welsch‹ stottert. Sie bleibt lieber zu Hause im Kreise ihrer Kinder und läßt sich vorlesen, als abends in einer Gesellschaft Whist zu spielen. Sie weiß, daß man über diese unsere Beziehungen klatscht, sie nimmt auch innerhalb vernünftiger Grenzen auf die Meinung anderer Rücksicht, aber sie denkt nicht daran, nun, weil recht mittelmäßige Geister sich darüber aufregen, einen unbefangenen Gedanken- und Gefühlsaustausch aufzugeben, der ihrem Geist viel gibt, ihr Herz erhebt und es ihr so ermöglicht, das mühselige Leben eines eintönigen Einerlei auszufüllen. Mit reinem Gewissen und freundlichem Gemüt kann man schon allen diesen kleinen Klatschereien trotzen, die ja schließlich sich von selber beruhigen.
Sie würden mir eine Freude machen, wenn Sie mir einen Kreditbrief schickten; ich mußte meine Schulden bezahlen und hatte noch andere außerordentliche Ausgaben zu begleichen. Meine täglichen Bedürfnisse, mein möbliertes Zimmer, Heizung, Beleuchtung, Wäsche, Aufwartung, Essen und Trinken u. s. w. belaufen sich monatlich auf mehr als zehn Louisdor. Meine Pension ist nicht billiger als das Leben im Gasthaus, aber nur eine solche Pension kommt für mich in Frage. Ich habe mir aus Deutschland eine Summe Geldes kommen lassen – sonst hätte ich Sie schon früher bitten müssen.
Tausendmal Lebewohl, liebe Freundin!
Ich könnte vielleicht billiger leben, wenn ich wüßte, wie lange mein Aufenthalt dauert, aber das ist ja gerade das Unangenehme bei kürzerem Aufenthalt: man muß immer mehr zahlen. Und dann wissen Sie ja: ›Jeder Schweizer läßt sich bezahlen‹.