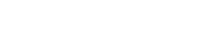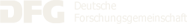Was Ew. Hochwohlgebornen noch über meine grammatische Abhandlung sagen, habe ich mit großem Interesse gelesen und beherzigt. Ich halte noch heute die in derselben entwickelten Ideen für die richtigen, aber jene Abhandlung hat zweierlei gegen sich. Sie führt das in ihr Enthaltene nicht genug aus, und ich war auch der darin enthaltenen Ideen, als ich sie schrieb, noch [2] nicht vollkommen Meister. Sie wurden mir erst klar, indem ich schrieb, was immer nicht gut ist. Ich habe daher angefangen, die philosophischen Grundsätze, auf welchen das Sprachstudium ruhen muß, ganz von neuem und in möglichster Vollständigkeit zu entwickeln, und habe mich damit anhaltend in den ersten Wintermonaten beschäftigt. Zu Ende bin ich allerdings nicht gekommen, allein die Arbeit wird nicht liegen bleiben; ob ich gleich veranlaßt worden bin, sie zu unterbrechen, nehme ich sie gewiß wieder auf.
Schon früher hatte ich eine Abhandlung in der Akademie über den Zusammenhang der Schrift mit der Sprache gelesen, von der Sie vielleicht einen Auszug im Journal Asiatique gelesen haben. Es ist närrisch genug, daß dieser erschienen ist, ehe das Original gedruckt ist. Allein Professor Schultz, der ihn gemacht, wünschte den schleunigen Abdruck, und ich habe Gründe die Abhandlung noch zurückzuhalten. Ich möchte in einer Fortsetzung über die Aegyptische Schrift reden, und dazu ist es doch nothwendig die Herausgabe der Spohnischen Arbeiten erst bis zu Ende abzuwarten. Ich bin dieser Sache sehr genau gefolgt, sie liegt jetzt höchst sonderbar. Die Spohnischen Entzifferungen werden, meiner Meynung nach, viel größere Aufschlüsse über die Sprache und Schrift geben, als die Champollionschen, aus denen mehr für die Geschichte zu erwarten scheint. Ich halte beide im Ganzen für richtig, obgleich sich bei dem Herausgeber Spohns etwas, und nicht Unwichtiges gegen Champollion vorzubereiten scheint.
Alle diese Arbeiten aber habe ich, seit dem Anfang Aprils etwa, der Gítá zu Liebe unterbrochen. Sie hat mich plötzlich wieder so angezogen, daß ich seitdem wenig Andres, als was enge damit zusammenhängt, getrieben habe. Die erste Veranlassung war der Wunsch, die philosophische Terminologie der Indier genauer kennen zu lernen, dies hat mich allmählich weiter geführt, ich habe gesucht mich des ganzen in dem Gedicht enthaltnen philosophischen Stoffes zu bemächtigen, und [3] habe eine jedoch noch nicht vollendete Abhandlung darüber geschrieben, in der ich, ohne aber im Geringsten der Ordnung der Gesänge zu folgen, was eine bequeme, aber gar nicht zum eigentlichen Zwecke führende Methode ist, eine sehr gedrängte, aber, wie ich hoffe, vollständige Darstellung des philosophischen Systems gebe, welches das Gedicht entwickelt. Hiezu haben mich vor Allem Colebrookes Abhandlungen veranlaßt. Er erwähnt der Gítá gar nicht, und ich kann mir kaum denken, daß es seine Absicht ist, ihr eine eigne Abhandlung zu widmen. Da die Gítá im Grunde die Yoga Lehre ist, und er diese in seiner ersten Abhandlung nach Patandschali auseinandersetzt, so scheint es nicht, als wollte er ihr noch eine eigne Arbeit widmen. Ich habe aber gesucht weniger trocken, als Colebrooke, zu seyn, und mehr einen anschaulichen Begriff des Originals zu geben. Die Arbeit zieht mich noch unendlich an. Sie wissen, wie sehr ich von der ersten Lesung des Gedichts ergriffen war, und dieser Eindruck bleibt mir, je länger und mehr ich es zergliedre. Was mich aber sehr zweifelhaft läßt, ist das eigentliche Zeitalter. Merkwürdig ist, daß Krischnas sich unter den Buchstaben α nennt. Dies deutet auf Schreibekunst. Ist nun, wenn der Vers nicht eingeschoben ist, das Gedicht jung, oder die Schrift in Indien so alt? Das Letztere ist meine geheime Meynung. Aber die Beweise sind nicht leicht. Hier bin ich noch sehr im Dunkel. Sehr sonderbar ist auch die Anordnung des Gedichts, und läßt wohl auf allmähliche Anbildungen, ob vom ersten Verfasser oder spätere ? schließen. Bis zum Ende des 11. Gesanges geht es ziemlich nach Einem Plane fort, und schließt auch damit einen Kreis ab. Nachher enthält fast jeder Gesang eine eigne Erörterung, die sich füglich vom Andern trennen ließe. Einzelne Einschiebungen erleichtert die Natur der Slokas. Daß es schon viel philosophische Gedichte vor der Gítá gab, wird ausdrücklich darin gesagt, und ist aus Allem klar, vorzüglich aus der so bestimmten Terminologie. Aus vielen wiederkehrenden Ausdrücken und Halbversen sieht man auch, daß schon eine große Menge von Materialien da war, die man nur geschickt zu verbinden brauchte.
Während dieser Arbeit stieß ich auf Langlois Recension, jedoch [4] nur die der 6. ersten Gesänge. Ich gestehe, daß sie mich indignirt hat. So offenbare kleinliche Scheelsucht, eine solche hämische Partheilichkeit, und das alles gegen Ihre Uebersetzung, die ich für meisterhaft halte, wenn sich auch an einzelnen Dingen kritteln läßt und ließe. Dabei schien mir seine Kenntniß und noch mehr seine Art, die Sache zu behandeln, gar nicht so, daß sie große Achtung einflößen könnte. Vorzüglich ist er in philosophischen Ideen zurück, und man kann wohl mit Wahrheit sagen, daß er das Gedicht, als philosophisches Ganzes, auch schlechterdings nicht verstanden hat. Man kann nichts Entstellenderes und Magreres lesen, als seine sogenannten Auszüge. Ich möchte vom jungen Burnouf, der bisweilen ähnliche Arbeiten im Journal Asiatique macht, mehr halten.
In dem Verdruß über diese angeblichen Kritiken sind die Bemerkungen über Langlois Aufsätze entstanden, die ich so frei bin, Ew. Hochwohlgebornen anliegend zu übermachen. Ich hatte schon angefangen, Ihnen zu schreiben, und wollte in dem Briefe die Langloisschen Bemerkungen durchgehn. Ich sahe aber, daß es zu weitläuftig wurde, und so erhalten Sie den Aufsatz als Beilage. Ich habe ihm aber die Briefform gelassen, und habe alle Titel vermieden, wie ich Sie in einem ähnlichen Fall auch zu thun bitte.
Ich überlasse nun diese Arbeit gänzlich Ihnen, und bitte Sie zu überlegen, ob Sie dieselbe für die Indische Bibliothek brauchen wollen, ob ganz, ob Einzelnes daraus nach Ihrer Wahl. Das Einzige, was ich Sie bitte, ist, daß Sie, wenn Sie, bei genauem Durchgehen, etwas wirklich Unrichtiges finden, für mich, wie Sie schon sonst gethan, die Freundschaft haben, es zu streichen. Daß ich auch in einigen Stellen Ihre Uebersetzung angegriffen habe, darüber entschuldige ich mich nicht. Ich kenne Ihre Denkungsart darüber. Ich habe zum Theil diese Einwendungen mit Fleiß eingestreut, um nicht partheiisch für Sie und gegen Langlois zu erscheinen. Da ich an einigen Stellen, nach meiner [5] wahren und innigen Ueberzeugung, Ihrer Uebersetzung habe die volleste Gerechtigkeit widerfahren lassen, so dachte ich mir, daß es Ihnen selbst, wenn Sie die Arbeit werth finden, in der Indischen Bibliothek abgedruckt zu werden, lieber seyn würde, auch Tadel beigemischt zu sehen. Verbinden würden mich Ew. Hochwohlgebornen, wenn Sie mir bald sagten, ob Sie von dem Aufsatz, den ich Ihnen rathen würde, als einen Auszug aus einem Briefe von mir, versteht sich mit meinem Namen, zu geben, Gebrauch zu machen denken. Thäten Sie es nicht, so würde ich daraus das, was nicht polemisch, und weder gegen Ihre Uebersetzung, noch gegen Langlois gerichtet ist, in Anmerkungen zu meiner im Vorigen erwähnten Abhandlung brauchen, das Polemische aber ganz unterdrücken. Die Orthographie der Indischen Namen und Wörter bitte ich Sie nach Ihrer Gewohnheit, wo es nöthig ist, umzuändern. Ob Sie die wirklichen Sanskrit Wörter mit Sanskrit oder lateinischen Lettern drucken lassen, da das Erstere mehr Mühe macht, ist mir gleich viel. Ich habe angestanden, ob ich bei denselben immer den Nominativ, wie Sie und ich nach Ihnen bei Namen thue, oder die absolute Form brauchen sollte. Ich habe aber zuletzt gefunden, daß das Eine und das Andre, allgemein durchgeführt, unbequem ist. Ich habe also zwar als Regel die absolute Form gebraucht, die das Wort immer im ganzen Umfange seiner Umwandlungen giebt, allein den Nominativ da, wo irgend ein specieller Grund dazu vorhanden war.
Wenn ich aber hierbei schon thue, als würden Sie den Aufsatz abdrucken lassen, so bitte ich Ew. Hochwohlgebornen inständigst hierin ganz nach Ihrem Urtheil und Ihrem Gutfinden zu handeln. Ich habe ihn, was Langlois Kritiken und die Stellen Ihrer Uebersetzung betrift, ganz eigen für Sie geschrieben, und wünschte darum, daß Sie ganz frei damit handelten. Zurückzuschicken brauchen Sie mir den Aufsatz auf keinen Fall, da ich mein Concept noch besitze.
Jetzt erlaube ich mir noch einige Worte über zwei Stellen meines Aufsatzes.
Die 4. Bemerkung (S. 2.) bitte ich Sie zu streichen. Bopp hat mich belehrt, daß der Scholiast der Gítá die Stelle, wie Sie erklärt. Ich [6] gestehe, daß es mir neu war, daß die Indier auch omina durch Vogelflug und ähnliche Vorbedeutungen hatten.
In nr. 34. (S. 32.) bitte ich Sie zwischen die Worte Bedeutung genommen wird und Bopp, den ich Folgendes einzuschieben:
Als eine solche könnte die in Manus Gesetzbuch angesehen werden, wo es (XII. 119.) heißt:
âtmâiwa dêwatâḥ sarwâḥ sarwamâtmanyawasthitaṇ,
âtmâ hi janayatyêshaṇ karmayôgaṇ s͗arîrinâṇ.
Hier erklärt der Scholiast âtmâ richtig durch paramâtmâ. Denn wenn der Brahmane Alles in sich selbst, in seiner Seele sehen soll, wie sl. 118. gesagt wird, so kann dies nur dadurch geschehen, daß der höchste Geist Alles beseelt, und daher alles Beseelte in sich faßt, was der Scholiast durch sarwâtmatwaṇ paramâtmanaḥ ausdrückt. Es ist aber hier offenbar der allgemeine Ausdruck für den besondern gebraucht, damit der 119. Slokas zum 118. passen soll, und weil auch wirklich der philosophische Grund der Behauptung in der Einerleiheit alles Geistigen liegt. Es läßt sich daher, nach meinem Ermessen, aus der Verwechslung beider Ausdrücke an dieser Stelle nichts auf andre schließen, wo solche besondre Gründe nicht vorhanden sind.
Ich schließe jetzt diesen langen Brief. Leben Sie herzlich wohl, verzeihen Sie die Länge erst meines Stillschweigens und nun meines Schreibens und erhalten Sie mir Ihre gütigen und wohlwollenden Gesinnungen, auf die ich so hohen Werth lege. Mit der hochachtungsvollsten Freundschaft der Ihrige, Humboldt.
Tegel bei Berlin, den 17. Junius, 1825.
[7]
[8]