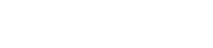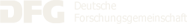Ich schreibe Ihnen, geliebtester Freund, hauptsächlich um von Ihnen zu hören, und wie ich hoffe, erfreuliche Nachrichten von Ihrem und der Ihrigen Wohlbefinden zu erhalten; denn eigentlich habe ich nichts zu melden, was Sie sich nicht im Voraus eben so denken könnten. Ich bin sehr fleißig, und lebe, den Kreis meiner Freunde ausgenommen, wo ich freylich manche merkwürdige Personen antreffe, so abgeschieden von der Welt wie möglich. Gewöhnlich gehe ich um zehn Uhr zu Bette, und bin dagegen um fünf Uhr, auch wohl noch früher bey der Arbeit. Ich bin sogleich mit einer Art von Heißhunger auf die Manuscripte gefallen, und habe mit Befriedigung wahrgenommen, daß mir die Flügel denn doch gewaltig gewachsen sind. Aber ich habe mich nicht dem Genuß der Neugier überlassen, vielerley unbekanntes zu lesen oder flüchtig zu durchlaufen, sondern ich unterziehe mich dem trockensten Geschäft: ich collationire die Handschriften mit den gedruckten Ausgaben. So habe ich nun bereits das nicht unwichtige Resultat gewonnen, daß es im Bhagavad-Gîtâ eigentlich gar keine Varianten giebt, sondern daß der Text in jeder Sylbe treu bewahrt worden ist. Ich wäre im Stande, einen vollkommen richtigen Text zu geben, und die zahlreichen Fehler der Ausgabe von Calcutta zu verbessern. Aber ich denke, man muß sich nicht mit der Auslegung dieses Meisterstücks von philosophischer Poesie befassen, ohne die Commentare aus dem Grunde studirt zu haben. Hier ist ein sehr ausführlicher; nur hat ihn mir leider Chezy weggenommen, weil er diesen Winter Vorlesungen über den Bhagavad-Gîtâ hält. Indessen habe ich in der Geschwindigkeit ein Capitel copirt, um wenigstens von der Methode einen Begriff zu haben. Jetzt bin ich beym Râmâyana. Ich fand anfangs im Eingange so viele Abweichungen, Auslassungen, Versetzungen u.s.w. daß ich fast den Muth verlor. Doch scheint dieß [2] im Fortgange des Gedichtes abzunehmen, und ich bin gewiß eine reiche Ausbeute berichtigender Lesearten zu gewinnen. Erst wann ich die beyden bereits gedruckten Bücher so durchgeackert habe, werde ich mir den Genuß gewähren, die übrigen fünf nach der Reihe zu lesen. Es giebt hier zwey Handschriften des Râmâyana, eine in Bengali, die andre in Devanagari, von verschiednen Händen, zum Teil herrlich geschrieben. An das Bengali-Lesen habe ich mich noch nicht gemacht, es muß freylich geschehen, aber es ist mir eine Art von Schreckbild. Sie sehen, ich habe alle Hände voll zu thun.
Ich habe für meine Sammlung ein paar Idole in Bronze aufgetrieben, beträchtlich größere, als die ich schon habe. Hier sind dergleichen Dinge ungemein selten; in England mögen sie häufig seyn, aber auch dort schwerlich zum Verkauf, sondern in Privatsammlungen.
Mit Humboldt bin ich auf dem freundschaftlichsten Fuße. Er theilt mir allerley mit, und ich ihm. Er hat meine Abhandlung über den Elephanten sehr gelobt, und sie wird von den jungen Leuten, welche hier Zoologie studiren, fleißig gelesen. Cuvier hingegen arbeitet nicht nur nichts mehr in seiner Wissenschaft, sondern der Hans Narr giebt sich auch, als ein nunmehr wichtiger Staatsmann, das Ansehen, über seine ehemaligen Beschäftigungen hinweg zu seyn, denen er doch allein seinen Ruhm verdankt. Man sprach, wie mir Humboldt erzählte, in einer Gesellschaft von meiner Indischen Bibliothek. Cuvier erkundigte sich darnach. Humboldt sagte: Das erste Heft handelt meistens von Indischer Mythologie und Poesie, aber das zweyte wird Sie besonders interessiren, wegen der vortrefflichen Abhandlung über den Elephanten. Wie können Sie wissen, erwiederte Cuvier, daß mich das besonders interessiren müßte? Gerade das erste Heft wird mich weit mehr anziehn. – Die Gesellschaft, die [3] gegenwärtig war, fand diese Manieren denn doch sehr lächerlich. – Humboldt hat mir etwas für die Indische Bibliothek versprochen; Chezy hat mir schon etwas gegeben: ein reizendes Stück Poesie, nach seiner Weise in Prosa behandelt. Freylich ist es für eine Akademische Vorlesung eingerichtet: aber ich gebe es dennoch gern, eben im Gegensatze mit unsrer Deutschen Wuth der Wörtlichkeit. Chezy treibt die Sache übrigens nach der alten Weise fort; er wird das Kraut nicht fett machen, und insbesondre haben wir nicht zu fürchten daß er uns mit irgend etwas zuvorkommen werde.
Meine Gesundheit ist vortrefflich, fast noch besser als die letzte Zeit in Bonn. Alle Welt hat hier gefunden, daß ich stärker geworden bin, und wohler aussehe, als ehemals. Dieß verdanke ich Ihrer treuen und weisen Sorgfalt, theuerster Freund. Ich suche es denn auch dabey zu erhalten, ich lebe sehr regelmäßig, und versäume nichts, was mir dienlich ist. Das Leben hat einen Werth, da ich noch ein so schönes weites Feld der Thätigkeit vor mir sehe. Ich sitze viel, aber zuweilen laufe ich doch auch wieder herum: von meiner Wohnung nach der Königl. Bibliothek ist schon ein starker Spaziergang. Seit ein paar Tagen schienen meine Augen von dem vielen Lesen der Manuscripte bey Licht (das nun einmal in dieser Jahrszeit unvermeidlich ist, aber in den Morgenstunden doch wohl weniger anstrengt, als in die Nacht hinein) angegriffen zu seyn; heute ist es schon wieder besser.
Der Troglodyte in meinem Leibe ist auch einmal wieder zum Vorschein gekommen, aber ich habe nur ein kleines Bruchstück von ihm habhaft werden können: er hat sich gleich wieder in seine unterirdische Höhle zurückgezogen. Und seltsam genug, dieß fand Statt, nicht etwa bey einer Schwächung in den Verdauungswerkzeugen, sondern bey völlig gesunden Excretionen; wie es scheint, wurde er durch die Anstrengung der Muskeln herausgetrieben.
[4] In Brüssel, wo ich mich zwey Tage aufhielt, habe ich Harbauer gesehen, der rüstig und in einer bedeutenden Sphäre wirksam ist. Er ist nicht nur der einzige Leibarzt des Königs, der dessen ganzes Vertrauen genießt, sondern an der Spitze des ganzen Medicinal-Wesens, im Civil, Militär und für die Marine. Er war auch permanenter Rector der Universität Löwen, die er auf einen ganz neuen Fuß gesetzt zu haben behauptet. Er war es eigentlich, der mehrere Deutsche dorthin, nach Lüttich und sonst berufen.
Von Friedrich habe ich hier durch die Schwester seiner Frau ziemlich gute Nachrichten erhalten; von ihm selbst habe ich nichts, wiewohl ich ihm aus Brüssel geschrieben.
Leben Sie tausendmal wohl, bester Herzensfreund, und lassen Sie mich bald von sich hören. Es wird mir wohl thun, wenn es auch nur wenige Zeilen sind. Nächstens mehr.
Hiebey ein Briefchen an Ihre liebe Frau.
1) Im Original: Bonn.