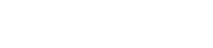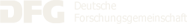Du hast, mein geliebter Freund, meine Arbeiten nach altdeutschen Vorbildern von jeher Deiner besondern Aufmerksamkeit gewürdigt, und noch in Deinem letzten Brief Dich darüber geäussert, so daß ich Dir nun meinen Galmy getrosten Muthes überschicke. Es ist eine Bekanntschaft, die mir selbst gewissermaassen neu geworden ist. Schon vor einem Jahre hatte ich ihn vollendet (oder wohl noch früher; ich bin ein schlechter Zeitrechner), und nun tritt er wie das Werk eines Andern vor mich hin; ich muß mich besinnen, wenn ich das Absichtliche, welches in mir dabei zum Grunde lag, hervorrufen will, wogegen mir mancher Anklang verständlicher geworden ist, der mir damals nur wie ein ahnendes Geflüster vorüber streifte. Was ich von meinem alten Plane noch weiß, ist Folgendes. Die ganze Geschichte faltete sich mir gleich beim ersten Lesen gewissermaassen in zwei Theile auseinander: der erste die Festlichkeit, Frische und Zier des ritterlichen Lebens, der zweite das Geschick, mit anscheinender Feindseeligkeit zum ersehnten Ziele führend. Dem gemäß wählte ich nun bei der Bearbeitung Ton und Sylbenmaaß: im ersten Theile die 8 und 9 sylbigen, unmittelbar gereimten Jamben, sich bis zu den zierlichern und verschlungnern Versarten steigernd, im zweiten das eigentlich dramatische Sylbenmaaß, oft mit Prosa untermischt, jedoch zwischendurch Schottische Roman[2]zenklänge, und spanisch-südliche Pracht, und sehnende Rückblicke nach dem gewohnten Spiel, bis endlich nach beendigtem Kreislauf sich Alles wieder in Galanterie und Musik auflöst. Eine recht eigentliche Auflösung sollte der Schluß sein, woraus Pellegrins Persönlichkeit, der ich diesmal mehr Einfluß als in allem früher Gedruckten verstattete, ganz unverkleidet hervortreten sollte. Ja ich habe sogar einem Liede des Minstrels im ersten Teil mein Wappen recht eigentlich aufgedrückt, und ihn überhaupt absichtlich aus der Normandie, meiner Familie erstem Vaterlande, herkommen lassen. Wie sich mir der Plan immer mehr und mehr entwickelte, nahm Alles eine fast allegorische Gestalt an. Galmy das sehnende Meer, die Herzogin die heraufstrahlende, alles bildende Sonne, Friedrich das leitende Gestirn, welches zuletzt in die Liebesgluthen des wärmern Lichtes mit verschwimmt. – Ich halte wohl sonst nicht viel von solchen Entwicklungen eines schon ausgeführten Plans, der für sich selbst reden muß, wenn er überhaupt reden kann; auch könntest Du mir antworten, wie ein Französischer Herzog einem Schriftsteller auf ähnliche Auseinandersetzungen: Vous avez voulu dire de belles choses, Monsieur; pourquoi ne les dites Vous pas? – Aber, geliebter Meister, bedenke nur, daß ich Dir eine andre Rechenschaft schuldig war, als einem Französischen Herzog, und daß ich möchte, Du sähest nicht nur was ich vermochte, sondern auch was ich wollte. Mit einer schlimmen Nachklage muß ich [3] noch kommen. Sie betrifft die unerhörten Druckfehler, wovon vorzüglich der erste Theil wimmelt. Laß dich dadurch nicht allzu sehr stören. Ich hoffe, Du wirst mir nicht zutrauen, daß ich die Berge durch Held und reines Minnen statt Huld und reines Minnen erschaffen lasse, und was des Unsinns mehr ist. – Dies Buch enthält Vieles von mir selbst und aus meinem vergangnen Leben. Fast noch mehr davon findest Du in einigen Träumen, die ich Erscheinungen betitelt habe, und aus einer Grille nicht mit Pellegrin unterzeichnet, sondern mit Floresta. Sie werden wohl zu Michaelis gedruckt sein.
Dein männlicher Aufruf zu ernstern Arbeiten hat die Saite, welche schon laut in mir tönte, noch um Vieles lebendiger geweckt. Der Heinrich, von dem ich im letzten Briefe schrieb, wächst mir unter den Händen. Es werden nun statt dreier Stücke vier. Nämlich: Heinrich und die Sachsen, Heinrich in Canossa (beide fertig), Heinrich und Rudolf (woran ich eben arbeite) und Heinrichs Tod. Das dritte Stück, welches ich in den anfänglichen Plan eingeschoben habe, erschien mir erst während der Arbeit so nothwendig, als es wirklich ist. Wenn Heinrich in Canossa den Sieg und die Macht des Geistlichen darstellt, so will doch auch das Schwerdt, das so kühn in Heinrichs Leben eingriff, seinen Theil haben. Diesen soll ihm das genannte Stück geben, ein Kriegerschauspiel voll von Feldherrnplänen und Soldatenkeckheit, welches mir vielleicht von Allem am Besten [4] gelingen wird. Die Schlacht von Merseburg selbst ist so reich an wechselnder Gestaltung und ausgezeichneten Helden, daß ihr Gang den vierten Act einnehmen soll, und vor den Augen des Zuschauers alle die ernsten Thaten unmittelbar darstellen. Darauf freue ich mich ganz vorzüglich. Ich nehme die Arbeit als einen zwiefachen Genuß, indem sie mich zu den beiden Gottheiten führt, denen mein Leben vorzüglich geweiht ist, oder doch geweiht sein sollte. Denn unsre Zeit ist freilich von der Art, daß es nicht meiner Verhältnisse als Vater und Gatte bedürfte, um das Schwerdt an meiner Seite rosten zu lassen. Die heilige Poesie schenke denn wieder, was die unheilige Zeit versagte, und – einen Schleier über diesen tiefen Unmuth. – Ich habe ja noch so manches Erfreuliche aus Deinem Briefe zu beantworten, und halte mich lieber daran. Vor Allem an Deine Versuche, die Franzosen zum Verständnisse zu bringen über die Nichtpoesie ihres Theaters und was sonst Bedeutendes hiermit zusammenhängt. Ich bin ungemein begierig darauf. Wenn dies Unternehmen irgend Jemandem glücken sollte und könnte, so wärst Du von Allen, die ich kenne, wohl ohne Zweifel der Herakles zu der That. Du bist so mild und scharf, so ernst und lustig, so höflich und schonungslos, daß ich Hoffnung faße, die taubstumme Nation werde einige Laute von Dir vernehmen, und damit ist ja das Mehrste gewonnen. Wenn man sich nur erst über einige Zeichen versteht, so dringt wohl nach und nach das ganze Universum in den abgeschlossnen Kreis. Bis jetzt scheinen sie mir immer grade im umgekehrten Verständniß der Ausländer geblieben zu sein, [5] oder auch das nicht einmal. Es ist wohl vielmehr ein absolutes Nichthinhören und Entschwinden, die unerschütterliche Ueberzeugung, Alles schon vorher und besser gewußt zu haben, was die Andern sprechen. Bin ich hierüber im Irrthume, so belehre Du mich eines Bessern, der sie nun genauer hat kennen lernen, und auch ohne Zweifel weit mehr von ihrer Literatur weiß, als ich. Dieser mich wieder mehr zu nähern (durch die Molierischen Werke) habe ich zwar vor einiger Zeit versucht, aber mit unglücklichem Erfolg. Der gewohnte Widerwille stieß mich zurück. Ich will nun noch an den Corneille gehn. Schreib mir bald über diesen Gegenstand, und von Allem, was Deine Bemühungen gewinnen. Es wäre ein höchst verdienstliches Werk, uns Deutsche, und gewiß durch uns Deutsche auch die andern Nationen mit Leuten in Verständniß zu bringen, die man oft lieben muß indem man über sie zürnt. Wie hat denn Friedrich mit ihnen gelebt? Oder hat er es gar nicht gethan? Ich möchte fast das Letztre glauben. Seiner Sakontala sehe ich mit dem lebendigsten Verlangen entgegen. Bis jetzt haben wir eigentlich doch die schöne Blüthe mehr geahnet als gekannt. Noch mehr aber freue ich mich auf seine Deutsche Geschichte. Laß es ja nicht an Ermahnungen dazu fehlen. Wir hätten alsdann ein recht eigentlich Deutsches Nationalwerk, welches unsre Begebenheiten in unserm Geist und auf unsre Weise ausspräche. Du selbst aber, mein geliebter Freund, läßt uns nur zu lange auf unser erstes romantisches Heldengedicht der neuern Zeit warten. Du hast ja nun eigentlich die Musse, in welcher Du den Tristan [6] vollenden wolltest. Hoffentlich sind schon bedeutende Fortschritte darin geschehn, oder halten Dich die Uebersetzungen noch zurück? Ich habe vor Kurzem wieder den Parcival gelesen, welchen ich ein Sinnbild des ganzen Ritterlebens und der Arturischen Heldenwelt insbesondre nennen möchte. Meine Gedanken darüber suchte ich mir im Niederschreiben deutlicher zu machen, und empfand einen eignen Genuß dabei, wie sich mir das ganze reiche Gewebe in seiner Klarheit und grossen Bedeutung entfaltete. O, unsre überaus herrlichen Sagen! Wie konnte man sie so lange misverstehn? Die ehrwürdigste derselben, das Lied der Nibelungen, scheint an einem Herrn von Hagen in Berlin einen nicht unwürdigen Herausgeber gefunden zu haben. Zu Michaelis, glaube ich, soll das Ganze erscheinen, mit aller geziemenden frommen Scheu behandelt, und nur der heutigen Sprache um soviel genähert, als zum Verständniß unumgänglich nothwendig war. Eine Probe davon in der Eunomia hat mir ziemlich gefallen, noch besser was der Herausgeber über seine ganze Arbeit sagt. Schlimm wäre es indessen, wenn die alten Abtheilungen und Ueberschriften wegblieben wie ich es beinah fürchte. Wie es denn unserm Zeitalter aber nie an unbewußten Lustigmachern fehlt, kommt gleich hinterdrein ein Prediger mit der Verheissung einer förmlichen Uebersetzung, die er in fünffüssigen Jamben liefern will. Der Reim ist ihm fatal und er läßt ihn weg. Ein Andrer räth ihm dagegen die Octave sehr [7] dringend an. – Doch dies sind eigentlich Neuigkeiten aus alten Zeitungen. Ich halte keins der Journale und erfahre daher dergleichen immer nur zufällig und spät. Entschuldige mich daher, wenn ich Dir mit längst bekannten Dingen Langeweile mache. – Einer Deiner Bewundrer, der sich in den Chamissoʼschen Almanachen immer mit: Robert unterzeichnete, hat eine Zauberoper, die Sylphen, geschrieben, die von Himmel componirt, und im vorigen Winter in Berlin aufgeführt worden ist. Ich habe sie nicht gesehn, was ich indeß davon höre, scheint mir recht wohl gemeint. Sie hält eigentlich einen Mittelweg in Hinsicht ihres Erfolgs. Das Publicum hat eben keine rechte Freude daran, aber die Merkelschen Schreier können sie doch nicht ganz vom Theater bringen. – Vor Kurzem hat man ein neues Schauspiel, die Weihe der Kraft, gegeben, mit welchem Erfolg weiß ich noch nicht. Doctor Luther tritt darin auf, und man hat sich vorher den Kopf gewaltig darüber zerbrochen, ob man ihn auf die Bretter bringen dürfte oder nicht. Du kannst denken, mit wie geistreichen Gründen pro et contra gefochten worden ist. – König Lear ist auch auf unserm Theater erschienen, der Schrödersche nämlich, und im letzten Winter oft gespielt worden. Ich erzähle Dir dies nur, um Dich auf die Sünde aufmerksam zu machen, welche Du durch Deine Verzögerung gegen Shakespear begehst. Muß der herrliche Altvater noch in Schröders Hamburgischer Bürgerkleidung unter uns auftreten! Die Entwickler haben übrigens dabei sehr sorgfältig bemerkt, mit welchen Fingern Iffland seinen Mantel angefaßt habe u. s. w. u. s. w. – Die Gedichte des Grafen Moltke, wovon [8] ich Dir letzthin, dem Auftrage Hülsens zu Folge, schrieb, habe ich noch nicht gesehn. Sage mir doch Dein Urtheil darüber, wenn sie Dir zu Gesicht kommen. Und überhaupt, mein inniggeliebter Freund, schreib mir recht bald. Du wirst bemerken, wie ich noch immer reichen Genuß aus Deinem vorigen Briefe finde, sei aber deswegen nicht zu sparsam. Wer weiß zwar, wann diese Bitte Dich erreicht. Du bist wohl schon nach Frankreich abgereist, und liest meine Worte erst bei Deiner Rückkehr. Ich konnte Dir aber den Galmy nicht ehr schicken, und bin auch jetzt noch gezwungen, ein Exemplar auf häßlichem Papier einzulegen, da mit den andern eine Verwirrung eingetreten ist, und mit jedem Posttage weiter hinaus meine Furcht steigt, der Brief könne Dich gänzlich verfehlen. Erreicht er Dich, so laß mich nicht lange in der Ungewißheit.
Von unsern häuslichen Verhältnissen schreibe ich Dir nichts, da der beiliegende Brief meiner Frau alles enthält, was sich darin zugetragen hat. Mir selbst verheißt die Badereise nur wenig Vergnügen. Ich kenne den Ort, wohin wir gehn, und bin überhaupt für das wechselnde unstäte Leben einer Badegesellschaft nicht gemacht. Mir fehlt es an einer gewissen Beweglichkeit für leichte und flüchtige Bekanntschaften. Entweder zeige ich mich zu fremd oder zu innig und da der letztre Fehler mir weniger eigen ist seitdem ich weniger Jüngling bin, werde ich wohl ziemlich einsylbig bleiben. Vier bis fünf Wochen sind jedoch bald vorüber, und meinen Heinrich nehme ich mit, wie auch den lieben frommen Jakob Böhm und Caesars Commentare. So habe ich was mein Herz wünscht, denn auch Dein Brief soll mich begleiten. Lebe wohl, mein theurer Meister und Freund. Ich bin unveränderlich
ganz der Deinige,
Fouqué
[9]
[Beilage:]
Sehr wider Willen muß ich die mir so schmerzhaften Vorfälle, worüber ich Dir auch letzthin ein abgesondertes Blatt schrieb, nochmals berühren. Ich aeusserte nämlich damals, B.[ernhardi] habe Sophieen angeboten, beide Kinder zu behalten, wofern sie nur in seiner Nähe wohne. Dies war, wie ich nachher erfuhr, ein Irrthum. Er wollte die Kinder haben, und sie ihr täglich schicken, oder auch Eins behalten und ihr das Andre lassen, und noch der Anerbietungen mehr. – Die Erklärung dieses Misverständnisses war ich mir selbst und der Wahrheit schuldig. Fortan, hoffe ich, soll ein so unerfreulicher Gegenstand meine Unterhaltung mit Dir nicht wieder trüben.
[10]