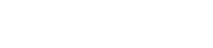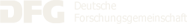Ew. Excellenz bitte ich um Erlaubniß, mit Übergehung eines traurigen Ereignisses, woran ich den herzlichsten Antheil genommen habe, einmal wieder nach einer so langen Zwischenzeit über gelehrte Sachen zu schreiben.
Mein Râm.[âyana] wird hoffentlich bereits in Ew. Excellenz Händen seyn. Ich hätte Ihnen vor Allen ein Exemplar überreicht, wenn Sie mir nicht die Ehre erzeigt hätten, zu subscribiren. Dieß konnte ich unmöglich ablehnen, weil ich nach erlauchten Namen in meiner Subscribenten-Liste geize. Sie ist für jetzt noch so klein, daß ich sie nicht habe drucken lassen, weil ich mich in der That für England schämte.
Ein großer Theil des Textes war Ew. Excellenz bereits bekannt; nun wünsche ich lebhaft meiner Vorrede Ihren Beifall.
Von meiner kritischen Ausgabe des Hitôpadêśa ist nun auch der Text fertig gedruckt. Ein Exemplar davon habe ich bei einem Berichte dem Ministerium eingesandt, und Hrn. Geh. R. Schulze gebeten, dafür zu sorgen, daß es Ew. Excellenz eingehändigt werden möge.
Zu der ersten Abtheilung fehlt nur noch die Vorrede. Die zweite und dritte sollen kritische Anmerkungen von Lassen, und eine Lateinische Übersetzung mit Sacherklärungen von mir enthalten. Für jene müssen wir die kleinen Lettern von Berlin erwarten. Das Ganze wird einen hübschen Quartband ausmachen.
Die Londoner Ausgabe ist ein wahrer Stall des Augias. Wir haben den Text von unzähligen Fehlern gereinigt, und dennoch selten zu Emendationen unsere Zuflucht genommen. Wo das Metrum in allen Lesarten verderbt ist, da bleibt freilich keine andre Wahl übrig. Wir hatten nur zwei Handschriften: aber diese, mit Zuziehung der Serampurer Ausgabe und der beiden Englischen Übersetzungen gaben eine Ausbeute, wie ich sie kaum erwartet hätte. Es versteht sich, Wilkins und Jones haben das Original oft auf die lächerlichste Art misverstanden, aber in vielen Fällen ließ sich doch mit Sicherheit errathen, welche Lesarten sie vor Augen gehabt.
Die Vergleichung der Sprüche in den Original-Schriften, woher sie genommen sind, ist auch ein kritisches Hülfsmittel. Aber freilich reicht dieß bei unsrer jetzigen so äußerst beschränkten Kenntniß nicht weit. Indessen hat Lassen manches aufgetrieben.
Im ganzen ersten Bande des Râm.[âyana] sind nur 38 Emendationen; ich habe auch die unbedeutendsten mitgezählt.
Ew. Excellenz Englischen Aufsatz habe ich mit großer Befriedigung gelesen. Die Schonung gegen meinen würdigen Freund Mackintosh ist gewiß sehr zu billigen; auch würde er schwerlich jetzt jenen Vorschlag so schreiben. Unsern Klaproth aber werden so gelinde Mittel nicht auf bessere Gedanken bringen. Ich habe es ja auch in meiner Correspondenz mit Merian versucht, der doch eigentlich in der Sprachvergleichung sein Orakel ist.
Ungemein sinnreich ist die Zusammenstellung der Englischen Hauptwörter, welche sämtlich Romanischen Ursprungs sind. Nur ein einziges Angelsächsisches hat sich eingeschlichen. Ew. Excellenz scheinen time von temps abgeleitet zu haben; es ist aber ohne Zweifel angelsächsisch. Auch die Schweden sagen timme für Stunde.
Gegen Bopp’s Grammatik habe ich so viele Einwendungen zu machen, daß sie bequem in der Ind.[ischen] Bibl.[iothek] ein Heft ausfüllen würden, wenn ich die Zeit dazu hätte. Ich habe ihm ein paar kleine Proben vorgelegt: ich weiß nicht, ob sie ihm genug gefallen haben werden, um sie Ew. Excellenz mitzutheilen.
Bopp züchtigt immerfort den guten Wilkins, dem wir doch alle viel Dank schuldig sind, mit dem Forster. Es ist wahr, die Grammatik von Wilkins ist voll von Druckfehlern oder wirklichen Versehen, die ich längst am Rande meines Exemplars angezeichnet habe. In der Klarheit und Eleganz hat er ihn lange nicht erreicht. – Nun stellt sich aber natürlich die Frage dar: wenn Forster wieder gefehlt hätte, woraus soll man ihn berichtigen? Ich denke, aus dem Pâńini, und ich habe den Versuch gemacht. Dieß gab Veranlassung zu einigen scherzhaften Distichen, die ich beilege. Die barbarischen Namen, sanskritisirt so gut es gehen will, nehmen sich freilich barock aus. Der meinige ist besonders widerspänstig. Ich habe einen Anklang auf ślâghya gesucht, was mir auch wohl zu gönnen ist.
Das letzte Distichon geht darauf, daß Bopp eine so anmaßende Verschmähung der Indischen Grammatiker in den ersten Zeilen seiner Vorrede ausgesprochen hat, und daß er nicht selten einen zweifelhaften oder ausgemacht falschen Sprachgebrauch durch unbeglaubigte Texte und verderbte Lesarten zu erweisen sucht. – So eben empfängt Dr. Lassen das Schreiben Ew. Excellenz. Ich bin hoch erfreut, daß meine Vorrede Ihren Beifall erworben hat. In Absicht auf die Latinität verdanke ich dem Professor Näke nicht wenig: er hat die Güte gehabt, die letzten Correcturbogen durchzusehen.
Erst eben jetzt habe ich auch den Artikel in den Berlin.[ischen] Jahrbüchern lesen können. Nichts ist erwünschter in wissenschaftlichen Dingen, als die Entwickelung einer der unsrigen entgegengesetzten Meinung mit scharfsinnigen Gründen. Man wird zu einer vielseitigeren Erwägung des Gegenstandes angeregt. Indessen werden Ew. Excellenz Ursache haben, mich eigensinnig zu schelten, da ich offenherzig gestehen muß, daß ich weder theoretisch noch praktisch beitreten kann; daß ich den Vorschlag der durchgängigen Worttrennung weder für zuläßig, noch für ausführbar, noch für nützlich halte.
Theoretisch und im allgemeinen bemerke ich, daß der Grundsatz, in alten Sprachen das uralte, zum Theil vorhistorische Herkommen nach unsern Gewöhnungen und unserer Bequemlichkeit umzumodeln, geradewegs auf Volney’s Methode führt, alle Orientalischen Sprachen mit Lateinischen Buchstaben zu schreiben und sie in dieser Gestalt zu lehren. Volney sagt mit allem Recht: die menschlichen Sprachorgane bewegen sich nach gewissen Gesetzen, die Zahl der articulirten Laute, welche sie möglicher Weise hervorbringen können, ist sehr gering; diese lassen sich ordnen und classificiren, und in einem einzigen Alphabet durch Hülfe gewisser Abzeichen bestimmt ausdrücken.
Diese Methode ist sehr nützlich: wir gebrauchen sie beim Abschreiben der Mspte, womit man sonst niemals fertig würde. Aber läßt sie sich für den Unterricht, und für die Monumentale Aufstellung der alten Werke empfehlen? – Die Arabisten haben mit Nein geantwortet.
Ich sagte dem berühmten Manne bei einer mündlichen Erörterung: die einheimische, Jahrhunderte lang üblich gewesene, der Sprache an- und zugebildete Schrift, sey dem Gewande der Dejanira zu vergleichen; man könne sie nicht wegnehmen, ohne die Haut mit abzureißen.
Ist es wirklich eine allgemeine historische Thatsache, daß in allen gebildeten Sprachen eine große Sorgfalt auf die Worttrennung gewendet worden sey? – Haben die Aegyptier in ihrer demotischen Schrift getrennt? Ich kann wenigstens in den Facsimile’s der Papyrusrollen keine Spur davon bemerken. – Und die Phönicier? Sollte die Worttrennung im Hebräischen nicht bloß ein Werk der Rabbinen seyn? In den Keilschriften will man Trennungszeichen bemerkt haben. Doch die Deutung ist wohl noch sehr problematisch. Und wann haben denn die Griechen angefangen zu trennen? Schon in Alexandria, oder erst in Constantinopel? In den Steinschriften läuft ja alles ununterbrochen fort. Wie war es in der Cursiv? Ich habe eben keine Facsimile’s vor Augen. So viel ich mich erinnere, waren die von Akerblad entzifferten Bleitafeln ohne alle Trennung.
Die Römer haben freilich in ihren Steinschriften die Punkte, die sie von den Etruskern geerbt zu haben scheinen. Häufig dienen jedoch die Punkte als Zeichen der Abbreviatur. In den Iguvinischen Tafeln scheinen sie sogar in der Mitte der Wörter vorzukommen. Aber wie hielten es die Römer im Zeitalter des Cicero mit ihrer Cursiv-Schrift? Der Gebrauch der Wachstäfelchen macht die Trennung unwahrscheinlich. Sie mußten den Raum sehr sparen. Ovidius preiset den Liebhaber glücklich, der von seiner Liebsten die Täfelchen ganz voll gekritzelt zurück erhält.
Odi, quum late splendida cera vacat.
Die Gothen haben durchaus nicht getrennt. Ich beziehe mich auf die Facsimile’s der Palimpsesten bei Mai. Wo ich nicht irre, ist es im Cod. Argent. ebenso. Ich habe leider die Pilgerfahrt nach Upsala versäumt.
Die Provenzalen verbinden auch stark. Ich weiß es genau, da ich über 60 Lieder der Troubadours aus den Handschriften copirt habe. Diese Sprache ist starker Contractionen fähig und erlaubt die Elision der Schlußvocale sogar vor Consonanten. Raynouard hat strenge getrennt, und dadurch Wörter bekommen, welche aus einem einzigen Consonanten bestehen, und wie arme Seelen im Fegefeuer ohne Ruhestätte umherschweifen.
Nach dieser ungefähren und vorläufigen Ansicht glaube ich, bei einer genauen Historischen Untersuchung würde sich ergeben, daß gerade in den gebildetsten und vollkommensten Sprachen die Worttrennung erst aufgekommen sey, als die schöpferische Periode vorüber war, und der analytische Verstand über die concrete Anschauung die Oberhand gewonnen hatte.
Unser Zeitalter ist erfinderisch in Hülfswerkzeugen und allerlei Einrichtungen, die große Erleichterung gewähren, aber vielleicht auf die rüstige und gesunde Entwickelung mancher geistigen und organischen Fähigkeiten nachtheilig einwirken. Niemals hat man gewiß so vortreffliche Brillen und Augengläser verfertigt als im heutigen Europa, aber niemals hat es auch so viele kurz- und blödsichtige gegeben. Unsre Schreibung mit der sorgfältigen Trennung, der Interpunction, dem ganzen typographischen System ist ein solches Hülfsmittel. Die Alten haben sie nicht gehabt und nicht vermißt. Sie haben demungeachtet vortrefflich recitirt, declamirt, und memorirt, die Schauspieler des Sophokles und Aristophanes gewiß ohne ausgeschriebene Rollen, bloß durch das Vorsagen des Dichters. Das soll man einmal mit einer heutigen Schauspielergesellschaft versuchen.
Die modernen Sprachen Europa’s erscheinen mir ebenfalls als solche bequeme Hülfswerkzeuge, Patentkorkzieher für die Gedanken, weswegen ihnen auch der Ökonom Adam Smith entschieden den Vorzug vor den classischen giebt.
Ist es nicht einer von den großen und mannichfaltigen Vortheilen des Jugendunterrichts in den classischen Sprachen, daß die Knaben deren künstlicheren Bau begreifen und sich dabei den Kopf zerbrechen müssen? Ich finde unsre Schulgrammatiken viel zu mechanisch. Die ursprünglichen und wahrhaft organischen Formen werden als Anomalien an den Schluß geschoben. Indessen kann man sagen: das Latein wenigstens, wird zu so vielen praktischen Zwecken gebraucht, daß auch viele mittelmäßige Köpfe es nothdürftig erlernen müssen. Beim Sanskrit findet dieß nicht Statt. Schüler ohne ausgezeichnetes Sprachtalent haben keinen Beruf dazu.
Die erwähnten Worttrennungen im Wolfischen Homer sind mir immer höchst widerwärtig aufgefallen; nicht aus einem verworrenen Gefühl, sondern weil er Wörter mit Consonanten schließt, die keine wahren Final-Buchstaben sind.
Wir trennen im Lateinischen und Griechischen strenge, wir sprechen auch beide Sprachen höchst barbarisch aus. Eine der vielen Ursachen ist auch jene Trennung. Z. B. was eine particula enclitica für das Gehör ist, habe ich erst aus dem Munde gelehrter Neugriechen erfahren.
Die Aussprache des Sanskrit haben wir gar nicht nöthig aufzugeben. Wilkins sagte mir, ich würde mich in Benares recht gut verständlich machen.
Ich bin in meinen Ausgaben dem Europäischen Hange zur Bequemlichkeit so viel möglich entgegengekommen. Mein Verfahren ist ganz consequent, und gründet sich auf die Lehre von den Final-Buchstaben.
Nach der zweiten aufmerksamen Lesung Ihres Schreibens an Hrn. Lassen finde ich nöthig, zu meiner Rechtfertigung, auf diese trockne Materie etwas näher einzugehen.
Wegen der durchgängigen Wechselwirkung im Fluß der Rede lassen sich die wahren Finalbuchstaben im Sanskrit nur am Schluß der Verse und Sätze erkennen. Außer den sämtlichen Vocalen, visarga und anusvâra können da nur folgende Consonanten stehen: k ṭ t p; ṅ ṇ n m. Wenn ein Wort mit den sieben ersten schließt, so trenne ich: denn alsdann kann es ohne Hülfe des folgenden ausgesprochen werden. In den Devanagari-Handschriften wird das anusvâra niemals, in den Bengalischen, so viel ich mich erinnre nur selten, am Schlusse durch ein m ausgedrückt. Ich lasse es deswegen auch stehen; es scheint hier anunâsika zu bleiben, da es hingegen zwischen zwei Vocalen in die reine labiale liquida übergeht. Die Devanagari-Schreiber setzen anusvâra, wo sie nur können; die Bengalischen hingegen verwandeln es meistens in den Buchstaben, welchen der folgende Consonant fodert. Ich habe nun einen Mittelweg eingeschlagen: im Innern eines untheilbaren Wortes ist der Laut wirklich nicht mehr mobil sondern steht fest. Hier also kein anusvâra. Aber am Schlusse der Wörter oder trennbaren Hauptbestandtheile behalte ich es bei.
Die Griechen und Römer haben auch ihr anusvâra gehabt, ihr mobiles v und m, jedoch kein Zeichen dafür. Auch war die Natur des schließenden m im Lateinischen verschieden: zwischen zwei Vocalen schmolz es ganz weg und ließ die synalœphe zu.
Ich kann mir nicht vorstellen wie Hr. Bopp die Krasen ohne Gewaltsamkeit wird zerreißen können. Das beste Mittel zur Bezeichnung wäre wohl der Punkt unter der Linie, den Colebrooke gebraucht hat, und welches ich auch in einem früh geschriebenen Aufsatze empfohlen habe. Als ich aber in Paris die Lettern besorgte, schien es mir nicht mehr nöthig, sonst hätte ich mit ein Dutzend Stempeln leicht die Anstalt dazu treffen können.
Die Erleichterung, welche durch die Worttrennung dem Schüler geschafft werden soll, kann nicht durchgreifend seyn, wenn die Bestandtheile der Composita nicht auch gesondert und etwa durch Striche verbunden werden. Wenn nun aber ein nach dieser Methode an den Ausgaben des Hrn. Bopp unterrichteter Schüler entlassen wird, wenn er hierauf an die künstlichere Poesie, an die wissenschaftlichen Bücher, endlich überhaupt an die Handschriften kommt, so wird er ganz unmündig seyn, und sich weder zu rathen noch zu helfen wissen.
Ich behaupte, daß zwischen meiner bisherigen Schreibung und den Handschriften etwas weißes Papier den ganzen Unterschied macht. Denn bei einem schwierigen saṃyoga wird das virâma besonders von den Bengalischen Schreibern gebraucht. Würde mir aber Halbheit und Inconsequenz vorgeworfen, so ginge ich noch lieber zurück, und schöbe alles zusammen, als [daß] ich mich zu dem entgegengesetzten Äußersten entschließen könnte.
Ich finde kein Bedürfniß einer mehr graduirten Interpunction, als die wir haben. Das Sanskrit erlaubt nicht den künstlichen Periodenbau des Griechischen; dieß ist eben eine seiner Unvollkommenheiten. In der Prosa interpungirt man, so viel man will. Die Herausgeber des Hitôpadêśa sind auch hierin sehr nachläßig gewesen. Ich habe zu großem Vortheile der Deutlichkeit fleißig interpungirt, und zwar nach dem Vorgange der Handschriften.
Die neuen Episoden von Bopp habe ich noch nicht gesehen. Ich möchte aber wohl ausrufen: alaṃ tâvad upâkhyânaiḥ | samasta - mahâbhâratapâṭhum athavâ kasyacit parvaṇaḥ samâptim icchâmaḥ |
Es würde mir unendlich leid thun, der Eifersucht beschuldigt zu werden. Ich will daher meine Meynung im Vertrauen Ew. Excellenz ganz offen darlegen.
Ich bin Hrn. Bopp von jeher mit Anerkennung entgegengekommen. Schon in den Heidelberger Jahrbüchern, dann in der Indischen Bibl.[iothek]. Die Mängel seines Nalus sowohl von Seiten der Kritik als der Interpretation sind durch den damaligen Zustand des Studiums hinlänglich entschuldigt. Aber mich dünkt, er hat seitdem wenig Fortschritte gemacht. Dabei hat er ein zu großes Vertrauen zu seinen Einsichten, und dieß kommt wieder daher, daß er von so vielem schon zugänglichen gar keine Kenntniß genommen hat. In der Grammatik sucht er Originalität, wo sie nicht hingehört. Gern ließe ich es mir gefallen, daß er seine Lieblingshypothesen in Noten beibrächte. Aber er geht weiter. Welche Künsteleien nimmt er z.B. mit dem Schema der Personal-Endungen des Verbums vor, um die Pronomina herauszuzwängen, welches doch nimmermehr gelingen kann! Er hadert mit den Indischen Grammatikern, die er doch nur mittelbar kennt, auf eine unbillige Weise. Z.B. wegen des ṇatvaṣatva an den Wurzeln. Wilkins hatte schon das Wahre und Vernünftige darüber gesagt. Es ist kein anubandha sondern ein upadêśa; ein Kennzeichen, daß der Anlaut unter den bekannten Bedingungen verwandelbar ist. Bopps unglückliche Neuerung ist nun auch in Rosens Wörterbuch übergegangen, und beide sind dadurch in einen großen Irrthum gerathen, indem sie behaupten das na zu Anfange der Wurzeln sey duchgehends verwandelbar. – Seine meisten Neuerungen finde ich entweder gleichgültig und folglich des Aufhebens nicht werth, oder vollends zweckwidrig. Wozu die Umstellung der Personen des Verbums? Ich kann Bopps Schülern nicht helfen: wenn sie zu mir kommen, müssen sie doch wieder 3 und 1 herumdrehen lernen.
Die Indische Anordnung ist in der That weit philosophischer als die Griechische. Die allgemeine Bestimmung der Rede ist Subject und Prädicat zu verbinden, ich und Du bezeichnen bloß colloquiale Verhältnisse, und das Ich voranzustellen ist ein wahres ahaṃkâru.
Wenn man, wie Bopp thut, von den alten Indischen Grammatikern mit Geringschätzung spricht, so möchte man wohl bedenken, daß man es nicht mit einzelnen Schriftstellern zu thun hat, sondern mit Schulen, die Jahrhunderte lang über die Sprache gearbeitet haben, und deren Arbeit durch den Gebrauch von Jahrhunderten sanctionirt worden ist.
Ich habe mich sonst vor dem Pâńini gescheut, und ihn aus der Ferne für so dunkel gehalten, wie die Orakel des Bakis. Jetzt bin ich in dieses abstruse Studium so hineingerathen, daß er mit mir zu Bette geht, und mit mir aufsteht. Vieles verstehe ich schon vollkommen und das übrige hoffe ich nach und nach herauszubringen. Die Sûtra’s sind nicht das schwierigste; der Commentar des Patañjali macht mir größere Noth.
Freilich: kein Wort der Vorerinnerung über die Einrichtung der Ausgabe; der schlechte Druck; und über 40 Seiten eingestandene Druckfehler; das alles ist sehr hart. Aber die erstaunliche Prägnanz der Form hat etwas anziehendes.
Hier nur einige vorläufige Bemerkungen. Diese Leute sind gewiß nirgends mit Willkühr verfahren. Sie haben die Thatsache des Sprachgebrauchs bis in das speciellste mit gewissenhafter Treue aufgefaßt, und zwar in der größten Breite, von den Veda’s bis zum gemeinen Leben. Es erhellet unwidersprechlich, daß in dem Lande und zu der Zeit, wo sie schrieben, das Sanskrit selbst von den untersten Volksclassen correct gesprochen ward. Hier ist also ein historisches Resultat. Sie sind voll von Bemerkungen über den Sprachgebrauch der Veda’s, der Gegensatz von vede und loke, chandasi und bhâṣâyâm ist ihm ganz geläufig. Vieles in der Indischen Grammatik ist uns ohne Zweifel nur darum nicht einleuchtend, weil wir die Accentuation nicht kennen: und darüber ist hier allein Aufschluß zu finden. Dieß dürfte jedoch am schwersten zu verstehen seyn, weil alles ohne Accente gedruckt ist.
Wenn Ew. Excellenz künftig Fragen an den Pâńini zu thun haben, so mache ich auch auf die Ehre Anspruch, damit beauftragt zu werden.
Hr. Lassen wird allernächstens ausführlich antworten, er wollte nur das Vergnügen haben zugleich eine kleine Neuigkeit zu übersenden.
In der Staatszeitung hat ein drolliger Artikel über die Jahres-Sitzung der Asiatischen Gesellschaft in Paris gestanden. Unter andern wurde darin die Hoffnung geäußert, Hr. Lassen werde demnächst den Râmây.[ana] fortsetzen, weil ich ja doch nichts fertig schaffe. Ich kann Ew. Excellenz versichern, daß ich alle Sorgfalt anwende, um meinen Freund Lassen so spät und so wenig als möglich an die Fortsetzung kommen zu lassen. Es scheint auch nicht übel damit zu gelingen: seit langer Zeit habe ich keiner so guten Gesundheit genossen als jetzt.
Ich wünsche von ganzem Herzen das gleiche von Ew. Excellenz zu erfahren. Mit der ausgezeichnetsten Verehrung und unveränderlicher Ergebenheit
Ew. Excellenz
Gehorsamster
AWvSchlegel
d. 28sten Mai
Es ist ganz unschicklich, daß ich, so lange schon Mitglied der Berlin. Akademie, noch keine Abhandlung geliefert habe. Einen Gegenstand habe ich längst ausgewählt: das Homerische Digamma. Aber die Zeit!
Ich sah wegen der oben erörterten historischen Frage die Neapolitanische Ausgabe des Philodemus nach, und finde auch in den Facsimile’s der Herculanischen Rollen keine Spur von Worttrennung. Also 400 Jahre nach dem Aristoteles noch nicht!
[Beilage]
Ich.
Vilkiṃsaṃ bâdhate Bappaḥ Pharstradaṇḍena daṇḍayan |
tasmâd asan punarślâghlât Pâṇinidaṇḍam arhati | |
Lassen.
daṇḍea daṇḍayan daṇḍyam mahadyaśa ihârhasi |
paratra ca namaskâraṃ Pâṇineḥ sapatañjaleḥ | |
Ich.
vyâkaraṇavishiṃ Bappaḥ kupâṭhebhyaḥ vidûṣayan |
âcâryân pṛṣṭhataḥ kṛtvâ vartate saṃskṛtoktiṣu | |