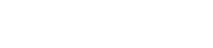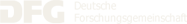Ich war lange stark in Ihrer Schuld, mein verehrtester Herr und Freund, sowohl mit Briefen als mit Sendungen. Endlich habe ich Gelegenheit etwas abzutragen. Ein Ex. vom 1sten Bande des Râmây. für Sie ist in dem Packet an das Ministerium abgegangen; es wird vielleicht bereits oder doch bald in Ihren Händen seyn. Der Text meiner kritischen Ausgabe des Hitôpadêśa ist auch fertig gedruckt; ich habe gebeten, das nach Berlin gesendete Ex. an Hrn. St. M. von Humboldt abzugeben; sobald die Vorrede da ist, werden Sie eines erhalten; in der 2ten u. 3ten Abtheilung werden kritische Anmerkungen u. eine Latein. Uebersetzung folgen, die erstere von Dr. Lassen, die zweite von mir ausgearbeitet. Dazu brauche ich nun die kleinen Lettern, wovon das Ministerium längst der hiesigen Universitäts-Druckerei einen Guß von einem Centner bewilligt hat. Ich sehe, daß Sie seitdem auch die Lettern von mittlerer Größe vollständiger haben anfertigen lassen. Die einfachen gefallen mir zum Theil ganz wohl, aber die unten angefügten Vocale u, û u. rĭ scheinen mir misrathen zu seyn; das rĭ besonders habe ich erst gar nicht erkannt. Um zu sehen, was ich am besten brauchen kann, muß ich ein Probe-Exemplar von jeder Sorte in Händen haben, welches ja wohl vorläufig aus ihrem Setzkasten genommen werden kann. Die verschiedenen Arten, dieselbe Letter zu gießen, müßte mit darunter begriffen seyn. Ich wünsche dieses alles in einem kleinen Kästchen, als Universitäts-Sache an Hrn. Geh. Rath v. Rehfues adressirt u. baldmöglichst zu erhalten. Vermuthlich werde ich die kleinsten zuerst angefertigten Lettern vorziehen, u. dabei nur einige Ergänzungen u. Verbesserungen vorschlagen. Ich schreibe deswegen gleichzeitig an Hrn. Prof. Lichtenstein.
Einer neuen Ausgabe Ihres Nalus sehe ich mit wahrer Freude entgegen. Meine kritischen Bemerkungen werden Ihnen gern dabei zu Dienste stehen, nur mit der Bedingung, bei denen, wovon Sie Gebrauch machen, meinen Namen zu nennen, wie es Haughton gemacht hat. Die nach Berlin mitgenommene Copie ist mir, ich weiß nicht wie, abhanden gekommen. Aber dieß thut nichts, ich habe den ersten Entwurf, auch fällt mir bei meinen Zeichen am Rande alles wieder ein. Ich schicke diese Bemerkungen dann Lateinisch abgefaßt; über einen Hauptpunkt, die unächten Verse, werde ich mich nach der Erklärung in der Vorrede zum Râmây. kürzer fassen können.
Die Wahl des Nalus war die glücklichste von der Welt. Ich gestehe, Ihre übrigen Episoden sind mir zu fragmentarisch, zu sehr aus dem Zusammenhang gerissen. Warum geben Sie uns nicht lieber etwas ganzes, z. B. das erste Buch. Daraus würde man den Gang u. Charakter des Gedichtes besser kennen lernen. Die Weißagung des Dhrítarâshtraʼs ist ja etwas ganz herrliches.
In Ihrer Grammatik habe ich manche feine Bemerkungen, auch einige mir neue gefunden; aber ich habe auch, wie es zu gehen pflegt, gegen Methode u. Inhalt allerlei Einwendungen zu machen. Zuvörderst gegen den Titel: ich glaube, meine Abneigung rührt noch von einer schreckhaften Erinnerung an das weitschweifige u. geistlose Buch von Adelung her. – Ohne Zweifel enthält Ihre Grammatik weit mehr, als für den nächsten praktischen Zweck, den Schülern in der Lesung der alten Epiker u. Gnomiker fortzuhelfen unentbehrlich ist. Die Indischen Grammatiker wollten lehren, wie man die Sprache mit vollkommner Correctheit sprechen u. schreiben soll. Diesen Zweck haben wir nicht; aber ein ausführliches System des Sanskrit sollte doch, denke ich, den kritischen Herausgeber alter Texte in den Stand setzen, in allen Fällen über die grammatische u. orthographische Richtigkeit der Lesearten zu entscheiden. Glauben Sie in der That, daß Ihr Buch dieß leistet? Ich wähle zum Beispiel das ṇatvaṃ. – Sie handeln davon § 94 a), 94 b). – Mit dieser Belehrung gerathe ich gleich bei dem Titel meines râmâyaṇaṃ ins Stocken. Denn warum nicht na? – Doch hierauf wäre in Ihrer Grammatik noch eine Antwort zu finden: ayana soll ein Unâdi-Affix seyn. Meines Erachtens, wenigstens für diesen Fall, ein ungegründetes Vorgeben: der Name würde seine ganze Bedeutsamkeit verlieren. Und was sollen wir mit der Riesin sûrpaṇakhâ anfangen? Was soll ich meinen Schülern aus Ihrem Buche antworten, wenn sie fragen: warum nicht na? Hier ist doch die Composition unläugbar. Schlagen Sie nur den Pânini nach: er handelt die Lehre in 39 Sútras ab; dazu kommen die Nebenbestimmungen der Commentatoren u. die Beispiele: es füllt 20 enggedruckte Seiten. U. doch finde ich über manche Fälle noch keine Entscheidung. Pâniniʼs erstes, zweites u. vierzehntes sûtram erschöpft den ganzen Inhalt Ihrer beiden Paragraphen. – Sie schreiben tṛshṇoti; Wilkins hat es ganz richtig mit n. Es ist ein xubhnâdi, welche Ausnahmen machen. – Ihr Paragraph § 110 enthält einen großen Irrthum. Sie meynen, alle mit n anfangenden Wurzeln seyen der Verwandlung in ṇ unterworfen. Nicht doch! Nur die in den Wurzelverzeichnissen mit ṇ geschrieben. Es bleibt eine gute Anzahl übrig, wobei die Verwandlung nach den bekannten Präpositionen nicht Statt findet, deswegen haben ja eben die Indischen Grammatiker so weislich das natva thatva eingeführt, das dem Gedächtnisse vortreffliche Hülfe leistet.
Sie sagen nach Wilkins u. andern bei saṃskṛta, saṃskâra u.s.w. sei das s des Wohllauts wegen eingeschoben. Es kann hier gar nicht von einer zu vermeidenden Kakophonie die Rede seyn, sonst dürfte man ja nicht saṃkara sagen. Das Wahre ist, daß einige mit k anfangenden Wurzeln, vornämlich kṛ, nach gewissen Präpositionen, in besonders modificirten Bedeutungen ein s vorsetzen. Meistens sind beide Arten der Composition, mit und ohne s vorhanden. Lesen Sie nur den Pânini, Sie werden alles hierüber beisammen, u. vortreffliche Aufschlüsse finden.
Sie äußern die Ueberzeugung, daß das Studium der Indischen Sprache nicht durch Benutzung der einheimischen Grammatiker gefördert werden könne. Ich bin, wie Sie sehen, ganz entgegengesetzter Meynung.
Den guten Wilkins, dem wir doch alle von unsern Lehrjahren her vielen Dank schuldig sind, züchtigen Sie häufig pharshṭradaṇḍena [?], Sie berichtigen ihn durch Forster. Es ist wahr, sogar in den Paradigmen hat er viele Druckfehler. Wenn nun aber einer Ihrer Leser sagte: „Hr. Bopp hat mehr Zutrauen zum Forster, ich aber zum Wilkins; u. ich bleibe dabei.“ – Wie wollten Sie einen solchen Widerspänstigen um Gehorsam bringen? Durch Beispiele? Das dürfte schwer halten, da manche Formen so selten sind. U. dann kommt es auch auf die Richtigkeit der Lesearten an. Es bleibt nichts übrig als die Autorität er alten Grammatiker.
Sie bemühen sich, die Bildung des Sanskrit genetisch zu begreifen. Das ist vortrefflich. Wir haben hiezu ein Hülfsmittel, das den Ind. Grammatikern fehlte: die Sprachvergleichung. Sobald es aber darüber hinausgeht, bleibt doch alles conjectural, ohne eine historische Grundlage. Eine solche ist noch vorhanden: der abweichende Sprachgebrauch der Vedaʼs. Ich kann mich nicht genug verwundern, daß Sie sich um diesen gar nicht bekümmert haben. Im Pânini u. dem Siddhânta-Kaumudi stehen Hunderte von Bemerkungen darüber. – Z. B. Sie stellen als Vermuthung auf, das hi des Imperativs sey ursprünglich dhi gewesen. Dieß ist eine Thatsache: die Verba werden aufgezählt, die es in den Vedaʼs noch haben.
Die Abweichungen der alten Epiker u. Gnomiker sind nur ein Ueberrest aus jener früheren Epoche. Deswegen werden auch vâidika u. ârsha als Synonyme gebraucht. Sie haben einiges dieser Art beigebracht, aber wie mich dünkt, an der unrechten Stelle – denn in das allgemeine Schema gehört es einmal nicht – u. allzu isolirt. Denn es ist dessen so viel, daß es einen starken Abschnitt ausfüllen wird. Sie äußern, den Ind. Grammatikern scheine dieß gänzlich entgangen zu seyn. Schwerlich! falls Ihre Lesearten u. Ihre Erklärungen die richtigen sind. Es sind nicht Leute darnach, sich irgend etwas entgehen zu lassen. Auch ist dergleichen den Commentatoren ganz geläufig. Z. B. aḍabhâva ârsha: |
Nichts ist mißlicher als zu sagen: dieß oder jenes komme nicht vor. Dieser negative Beweis möchte am schwersten zu führen seyn. Das können wir dreist sagen: Es ist mir noch nicht vorgekommen. – Aber dieß bedeutet auch erstaunlich wenig. Unsre ausgebreitetste Lecture ist ja nur ein minimum gegen den unübersehlich reichen Vorrath der Ind. Litteratur. Sie äußern, die verba nominalia seyen selten. Was geben Sie uns, Hrn. Lassen u. mir, für jedes Dutzend Beispiele, das wir Ihnen schaffen?
Sie haben, wie mich dünkt, immer noch zu viel Glauben an die Handschriften. Es liegt ja am Tage, daß die Abschreiber oft nicht verstanden, was Sie schrieben. Deswegen haben einmal eingerissene Corruptionen oft weit um sich gegriffen. Ehemals haben Sie wohl aus der Seramp. Ausgabe des Râm. u. der Londoner des Hitôp. einen zweifelhaften Sprachgebrauch zu erweisen gesucht; jetzt sind Sie dieser Nothbehelfe überhoben. Der Londoner Hitôp. insbesondere ist ein wahrer Stall des Augias; ich habe mit nicht mehr als zwei Mspten eine Unzahl von Fehlern weggeräumt.
Ich schicke Ihnen hier einen ślokas von meiner Fabrik. Er sollte nur zur Erklärung des Titelkupfers dienen, welches sich bei den Exemplaren auf Druckpapier nicht findet.
Leben Sie recht wohl, u. nehmen Sie sich meiner Angelegenheit mit den Drucklettern gütigst an.
Ich wünsche Ihnen von ganzen Herzen vollkommene Gesundheit u. Heiterkeit bei dem thätigen Anbau des Gebietes der Gelehrsamkeit, das wir gemeinschaftlich bearbeiten.
Mit ausgezeichneter Hochachtung
Ihr ergebenster
A. W. v. Schlegel.
N. B. Ich habe aus Versehen diese Seite leer gelassen, u. will sie nun benutzen, um die auf der nächsten angeführten Sûtrâńi [1, 2, 14; 135, 137] abzuschreiben, da Sie den Pâńini vielleicht nicht sogleich zur Hand haben.