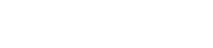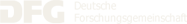Geliebter Bruder, ich will keinen Posttag versäumen, ohne Ihnen zu melden, dass die Nibelungen-Sendung vor 4 Tagen glücklich angelangt ist zur grössten Freude und wahrhaftem Trost. Gelesen ist die Sendung noch nicht, aber höchst willkommen und erwünscht. Wenn die Censur es nicht aufhält, so kömmt es gleich im Juni-Heft. Was Sie und was Friedrich bis jetzt in das ‚Museum‘ gegeben haben, das ist gut, recht, schön, vortrefflich, zur rechten Zeit und kurz so wie es sein soll. Alles andre ist „Futter für Pulver,“ wie Falstaff sagt. Was man über ihren Rudolph sagt, wollen Sie von hier wissen?
Sie beklagen sich darüber, dass Sie abgeschnitten sind von aller deutschen Litteratur, dass Sie nichts bekommen? Was würden Sie erst darüber zu jammern haben, wenn Sie hier wären! Nichts hört man hier darüber, gar nichts, ausser einige lobende Freunde, deren Zufriedenheit wir uns auch wohl denken würden, wenn wir sie auch nicht hörten. Aber ein Urtheil, eine öffentliche Stimme? – nicht daran zu denken! Seit dem ersten Heft, das eine rechte Gährung verursachte (es mochte dem Bösen wohl etwas Kolik gemacht haben) soll man noch das erste Wort darüber hören. Der Buchhändler war vor der Messe zufrieden, die Nachrichten von der [2] Messe lauten aber kläglich, nicht grade des ,Museums‘ halber, sondern überhaupt, und da leidet das ,Museum‘ natürlich mit. Im Februarstück hatte Friedrich einen Meisteraufsatz ‚über nordische Dichtkunst‘, im Märzstück einen Epilog zu den Reden des Curators, des Secretärs &c. der hiesigen Akademie der Künste, im April nichts, im Mai einen Nachtrag zu jenem Aufsatz ‚über nordische Dichtkunst‘, bei Gelegenheit von Tieck’s ‚Altenglisches Theater‘, und im künftigen Monat, denke ich, wird eine von Friedrichs Vorlesungen abgedruckt werden. Sehen Sie, liebster Wilhelm, von allen diesen Sachen, sowie von der ganzen Bemühung hört man kein Wort, weder aus der Nähe noch Ferne. Schlechte Gedichte und schlechte Prosa hingegen kömmt mit jedem Posttage centnerweise zum Einrücken an. Auch wird man die Wirkung wohl in kurzer Zeit an den Folgen spüren: nämlich ganze Schiebkarren voll Bücher werden erscheinen, worinnen man sich mit Euren Federn schmücken wird, und was Ihr mit so grossem Fleisse und solcher Aufopferung an’s Licht bringt, das werden sie sich mir nichts dir nichts, ein jeder in seiner eigenen Terminologie, mit einer solchen liebenswürdigen Leichtigkeit so zu eigen gemacht haben und so wieder anzubringen wissen, dass Ihr zuletzt selber wieder [3] ganz ungewiss werdet, ob Ihr die Urheber seid oder ob die andern. – Nein, sagen Sie mir nichts mehr vom deutschen Publikum, es ist nicht um ein Haar besser als irgend ein anderes.
Adam hat gestern seine Vorlesungen wirklich eröffnet. Er hat einen angenehmen Vortrag, übrigens war es aber ein bischen crême fouettée – Sie wissen wohl, dass man nicht ungern davon speist, besonders die Damen – auch hat er mit grossem Beifall gelesen. So viel Zuhörer wie Friedrich hat er nicht, wenigstens kommen nicht so viel; aber der Erzherzog Maximilian war da und Graf Stadion, dann noch eine seltene Erscheinung bei solcher Angelegenheit war Prince de Ligne. Besonders giebt der Erzherzog ein grosses Relief. Aber er muss sich kurz zusammenfassen, sonst fliegt ihm doch alles davon, denn es ist die Jahrszeit nicht. G. Moritz O’Donell ist sein Freund; der hat ihm alles das zusammengebracht. Ueberhaupt kann er sich Glück wünschen, diesen so gefesselt zu haben, er thut unendlich viel für ihn. Adam hat einen grossen prononcirten Anhang unter dem ersten Adel, doch wohl grösstentheils durch O’Donell. Mir kömmt aber, nach der ersten Vorlesung zu urtheilen, vor: Boas der Reiche hat geerntet, und Ruth hält die Nachlese von dem, [4] was der Ueberflusshabende sorglos liegen liess. Halten Sie mich nicht für hochmüthig und übermüthig? Ich bin es aber doch gewiss nicht; nur verdriessen mich diese Nachlesungen etwas, nicht als ob ich der Ruth nicht diese Ernte gönnte – gewiss von ganzem, ganzem Herzen, ich bin ihm nicht feind, und ich wünschte, es ginge ihm so wohl, als er selber möchte – aber ich fürchte, der Eindruck von Friedrichs Vorlesungen wird durch diese Neuigkeit zu schnell verdrängt, und ich muss es gestehen, dies verdriesst mich, wenn ich die Anstrengung Friedrichs und die Vortrefflichkeit der Vorlesungen selber bedenke, immer mehr und mehr. Es ist mir unerträglich, es sogleich mit meinen Augen sehen zu müssen, wie auf diesen glatten Seelen nichts haftet, wie sie diese goldnen Sprüche der Weisheit, der Gelehrsamkeit, der wahrhaften Gottesliebe so vorüber rauschen lassen wie eine Musik, die man hört, so lange sie ertönt, und dann von einem andern Stückchen verdrängen lässt, das halt auch hübsch klingt. Erlauben Sie daher nur, guter lieber Bruder, dass ich den Friedrich diesesmal mehr als sonst zum Druck der Vorlesungen berede. Sie sollen durchaus nicht so bald vergessen werden. Ihr Einwurf gegen das Druckenlassen als Vorlesungen kann zu einer andern Zeit gegründet sein, diesesmal muss er einer andern Betrachtung nachstehen. [5] Ein Buch daraus zu machen, wie Sie es meinen, das nimmt ihm in der Folge bei grösserer Ruhe und Musse ohnehin kein Mensch, nur jetzt im Gedränge frisch vorauf gerennt, damit wir aus dem Staub kommen.
An Möblenanschaffen konnte bei alle der guten Einnahme noch immer nicht viel gedacht werden. Indessen haben wir Betten, ein Sopha und ein Dutzend Stühle; das Uebrige, wie und wann Gott will. Es ist so theuer hier und die Lebensart jetzt so schwankend und ordnungslos geworden, dass kein Mensch an irgend eine Einrichtung denken kann. Man ist froh, den Tag nur durchzukommen. – Ihre Arbeiten in den Heidelberger Jahrbüchern sind uns noch immer nicht zu Gesicht gekommen. – Müller liest nicht über Aesthetik, sondern über Rhetorik. Das Nähere und Bestimmtere wird Ihnen Friedrich schreiben, wie auch über Ihren Rudolph. Wenn er aber heute nicht und nicht den nächsten Posttag schreibt, so unternehme ich gar nicht mehr, ihn vertheidigen oder entschuldigen zu wollen, ich schicke dann meinen Brief, ohne den seinigen abzuwarten. Er macht es mit der Zeit wie mit dem Gelde und kommt daher auch immer mit beiden nicht aus. Am Morgen früh wird mit einer solchen Gemüthsbreite zu leben angefangen, als würde das Kapital der 16 Stunden bis Schlafengehen gar nicht können zu Ende gelebt werden, dann sind wir immer jedesmal nicht wenig erschrocken, wenn [6] die Zeit nicht reicht, fangen aber richtig am andern Morgen wieder ebenso an. Sich einige Tage oder auch Wochen die ruhigen Betrachtungen und Studien versagen, mit behender Lebhaftigkeit nur erst die alte Schuldenlast der Geschäfte abschütteln, um dann mit erleichtertem Herzen auf’s neue die gewohnte Lieblingsordnung der Zeit wieder einführen und geniessen zu können, das will er noch immer nicht lernen; er will es nicht einmal versuchen und leugnet die Möglichkeit a priori. Sie sehen, ich kann ihn auch anklagen, wenn es sein muss!
Mit Jetten’s Entschluss, das angetragene Amt anzunehmen und die eigne Einrichtung fahren zu lassen, kann ich nach allem, was sie mir darüber schreibt, nicht unzufrieden sein. Wenn ich Ihnen ihre Briefe schicken könnte, wenn Sie die Art sähen, wie man sie behandelt, und wie alles gekommen ist, so würden Sie hoffentlich mit uns einverstanden sein. An Unabhängigkeit hat sie eher gewonnen als verloren. Man ist nicht unabhängig, wenn man immerwährende häusliche Sorgen zieht, die man allein allenfalls gutes Muths erträgt; aber wenn man für andre dabei zu sorgen hat, die das Recht haben, ein angenehmes bequemes Leben von uns zu fordern, so ist man wahrhaft die Sklavin jedes Augenblicks. Experto credo Ruperto! Uebrigens ist man immer leichter, von Einem als von mehreren, vielleicht sich widersprechenden, abhängig.
[7] Die andere Woche reist ein junger Mann von hier nach der Schweiz, der Ihnen Briefe von uns bringen wird. Er bat darum, um Ihre und der Fr. v. St. Bekanntschaft zu machen. Er ist ein Berliner, ein Neffe der Wittwe Levy, geborne Itzig, in Berlin. Er ist getauft, heisst jetzt Herr v. Delmar. Ob er etwas liebt, weiss ich nicht; dass er nichts hofft und nichts glaubt, das weiss ich; aber er fürchtet alles, nichts aber in der Welt fürchtet er mehr, als dass man es ihm anmerken könnte, dass er einst noch anders hiess als Herr v. Delmar. Diese Furcht ist ordentlich eine fixe Idee bei ihm geworden. Es ist ihm immer zu Muthe, als wäre das Christenthum zu dünn bei ihm aufgetragen, und als schimmerte das alte Judenthum noch darunter durch. Aber dem ist gar nicht so, es ist ein recht guter, ganz artiger Mensch, der sich aber gar nicht darüber trösten kann, dass er das Pulver nicht erfunden hat und auch wohl nicht würde erfunden haben. Diesen schicken wir Ihnen nun. Thun Sie ihm, wenn Sie können, etwas zu Gefallen; er war hier sehr artig gegen uns. Ich schreibe Ihnen das im voraus über ihn, weil ich ihm doch einen solchen Bericht über ihn selbst nicht mitgeben will, und wissen mussten Sie es doch, was er uns eigentlich ist, und wie wir zu ihm kamen. Adieu, herzlich geliebter Bruder; alles übrige schreibt Friedrich.
Ihre Dorothea.
Philipp malt hübsch und empfiehlt sich Ihnen.