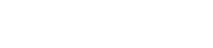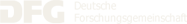[Anfang, 2 Blätter, fehlt.]
... gedacht? Ich habe mir so das Ganze überlegt. Kurz muß er durchaus seyn ‒ höchstens Ein Bogen. Das Stück ist voller Leben, voller Bedeutung, aber doch auch so einfach ‒ es sind keine Räthsel darinn zu lösen. Der Charakter des Mönchs hat Tiefe, ohne Geheimniß. Kein Heiliger, ein würdiger, sanft nachdenkender Alter, ein edel betrachtender Geist, fast erhaben in seiner vertrauten Beschäftigung mit der leblosen Natur, und äußerst anziehend, pickant (wenn Du erlauben willst) durch seine eben so genaue Bekantschaft mit dem menschlichen Herzen. Seine Kentniß deßelben ist mit einer frölichen, ja wizigen Laune gefärbt. Er hat einen schnellen Kopf, sich in den Augenblick zu finden und ihn zu nuzen, muthig in Anschlägen und Entschluß, fühlt er ihre Wichtigkeit mit menschenfreundlichen Ernst. Von seinem Orden scheint er nichts zu haben, als ein wenig Verstellungskunst und physische Furchtsamkeit ‒ er ist frey von Herschsucht, und sezt sich ohne Bedenken aus, um etwas Gutes zu stiften, ist freymüthig und Herr seiner selbst in einer Gefahr, der er nicht mehr entrinnen kan. Es ist sonderbar zu sagen, aber es giebt nichts liebenswürdigres als diesen Mönch, und die erste Szene, in der er auftritt, dient dazu, uns eine achtungswürdige Gewalt in seinem Wesen fühlen zu laßen, die jenen Eindruck durch Verehrung stärkt. Er thut was die jungen Leute haben wollen, aber er scheint uns nicht ihrem Ungestüm, sondern der beynah heiligen Empfindung, der Erfahrung, von dem was Leidenschaft ist, nachzugeben. Er thut an Julien eine Forderung wie an eine Heldin, er mahnt sie zur Standhaftigkeit in der Liebe, wie an eine hohe Tugend, und scheint vorher zu wißen, daß er sich nicht in ihr betrügen wird ‒ in der sich zur Leidenschaft schon die reine gewißenhafte ‒ die fromme Treue der Gattin gesellt. ‒ Julie ist nichts wie Liebe, und doch wär es unmöglich sie nur für ein glühendes Mädchen zu nehmen, das zum erstenmal erwacht, und gleichviel auf welchen Gegenstand verfällt. Diese beyden scheint wirklich ihr guter Geist sich einander zugeführt zu haben ‒ sie treffen sich in einem Blick, und jedes nächste Wort ist wie dieser Blick. Man glaubt mit ihnen, daß hier keine Täuschung stattfinden kan. Selbst Romeos Flatterhaftigkeit giebt uns keinen Zweifel ‒ es ist, als wär seine erste Anhänglichkeit nur ein Gesicht der Zukunft gewesen, ein Traum seiner Fantasie, ihn vorzubereiten. Und ob wir gleich an beyden nichts sehn wie ihre Leidenschaft, so zeigt sie sich doch so, daß sie auf eine edle Bestimtheit der Seele schließen läßt. Zürnt nicht mit Julien, daß sie so leicht gewonnen wird ‒ sie weiß von keiner andern Unschuld als ohne Falsch dem mächtigen Zuge zu folgen. In Romeo kan nichts ihre Zartheit, und die feinen Forderungen eines wahrhaftig von Liebe durchdrungnen Herzens zurück scheuchen und beleidigen. Sie redet frey mit sich und ihm, sie redet nicht mit vorlauten Sinnen ‒ sondern nur laut, was das sittsamste Wesen denken darf. Der heißen Italiänerinn verzeiht man die Lebhaftigkeit der Vorstellung. Von dem Augenblick an, da sie seine Gattin wird, ist ihr Leben an das seinige gefeßelt; sie hat den tiefsten Abscheu gegen alles, was sie abwendig machen will, und scheuet gleich die Gefahr, entweihet oder ihm entrißen zu werden. Da sie gezwungen wird sich zu verstellen, thut sie es mit Standhaftigkeit, und deswegen ohne Gewißenszweifel, weil sie ihre Eltern nach solcher Begegnung nicht sehr achten konte. Ihren Monolog halt ich für einen von Sh. Meisterzügen, die ohne Flecken sind. Erst der Schauer sich allein zu fühlen, fast schon wie im Grabe ‒ das Ermannen ‒ die Überlegung, der so natürliche Argwohn, und wie sie ihn heldenmüthig, mit einer Seele über alles Arge erhaben von sich weißt ‒ größer wie der Held, der wohl nicht ohne Ostentation die Arzney austrank ‒ ‒
[Schluß fehlt.]