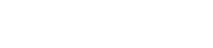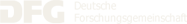Ew. Excellenz habe ich die Ehre zu melden, daß nach langen Prüfungen meiner Geduld das 4te Heft der Indischen Bibliothek endlich ans Licht getreten ist. Ein für Ew. Excellenz bestimmtes Exemplar ist vorgestern durch den Postwagen in einem Packet an den Buchhändler Reimer abgesendet. Die 12 besonders abgedruckten Exemplare der Abhandlung sind etwas später fertig geworden, ich werde sie baldigst nach Berlin fördern. Ihr Herr Bruder wird sie morgen oder übermorgen schon in Händen haben, da gedruckte Sachen sous bandes so schnell wie Briefe, in vier bis fünf Tagen von hier nach Paris gelangen.
Zu meinem Leidwesen hat nur die erste Abtheilung, nämlich § 1–6 inclusive diesem Hefte eingerückt werden können. Ich hatte mich in der Schätzung des Manuscriptes verrechnet. Der Paragraph 7 durfte nicht zerschnitten werden, mit demselben würde das Heft weit über das gewöhnliche Maaß angewachsen seyn, während der Verleger den Preis doch nicht erhöhen durfte. Zudem war dann noch eine neue Verzögerung [2] zu besorgen, da der Vorrath an Papier so weit nicht ausreichte.
Ich habe eine kurze Vorerinnerung beygefügt, von welcher ich von Herzen wünsche, daß sie Ew. Excellenz nicht misfällig seyn möge. Das erste Heft des zweiten Bandes und in diesem die zweite Abtheilung der Abhandlung denke ich recht bald nachfolgen zu lassen.
In diesem Augenblicke empfange ich Ew. Excellenz gütiges Schreiben vom 8ten April, und bin unendlich erfreut von Ihrem Wohlbefinden und Ihren unermüdlich fortgesetzten Studien so willkommne Nachrichten zu erfahren.
So bald der umgedruckte Bogen und die Cartons zum Bhagavad-Gîtâ fertig sind, werde ich den bloßen Text an Ew. Excellenz fördern. Da Sie gesonnen sind, sich mit diesem Buche besonders zu beschäftigen, so wäre es gut, sich die Übersetzung von Wilkins zu verschaffen. Es ist damit ganz anders bewandt wie mit der des Hitôpadesa. – Jene, zwar seine erste Arbeit, hat er in Benares verfertigt, unter der Leitung eines vortrefflichen einheimischen Gelehrten. Es fehlt zwar auch nicht am Nichtverstehen und an positiven Misverständnissen, [3] doch ist sie im ganzen brauchbar. Im Hitôpadesa gehen die Misverständnisse wirklich über die Gränzen des Erlaubten hinaus, und wenn viele Sentenzen im Originale so beschaffen wären, wie sie im Englischen lauten, so möchte man sich billig über den Ruf der Weisheit wundern, wozu das Buch gelangt ist. Bey allem dem suche ich diese Übersetzung dennoch als eine Handschrift zu benutzen, indem ich oft durch das trübe Medium hindurch errathen kann, wie er gelesen haben muß, und zuweilen meine Pariser Lesearten bestätigt finde.
Herrn Bernsteins lithographischen Versuch habe ich noch nicht gesehen, und wäre neugierig darauf: er hätte ihn mir wohl zusenden können. Ich habe schon die Absicht gehabt, etwas auf Übertragungs-Papier zu schreiben, um zu zeigen, daß man es leicht besser machen könne als Othmar Frank. Aber wozu soll man sich mit der Lithographie plagen, da man es mit dem Drucken so bequem hat? Was kann man mehr verlangen, als daß eine große Octavseite von 20 Zeilen, bey der von mir getroffnen Einrichtung der Typen, in anderthalb Stunden gesetzt wird? Dieß kann man im Arabischen nur ohne Vocalzeichen, sobald es punctirt wird, erfodert es viel mehr Zeit. Jeder Bogen [4] des Bhagavad-Gîtâ auf starkem geglätteten Velin, eine Auflage von 300 Exemplaren, kostet mir alles in allem, Satz, Druck und Papier, 25 Thaler. Ein starker Band von 30–32 Bogen wird demnach 800 Thaler kosten. Für einen solchen wäre 10 Thaler gewiß ein mäßiger Preis, und so würde ein Absatz von 100 Exemplaren die Kosten decken. Freylich bey dem jetzt noch so beschränkten Bedarf wird es Zeit erfodern, ehe so viele Exemplare abgehn, wenn ich nicht etwa in England eine Subscription zu Stande bringen kann. Ich hoffe dem Fonds des öffentlichen Unterrichts nicht beschwerlich zu fallen, sondern alles möglichst aus eignen Mitteln zu bestreiten.
Die bisher von Ew. Excellenz befolgte Methode, immer dieselben Stücke wieder zu lesen, ist gewiß die rechte. Ich mache es eben so. Man dringt auf diese Weise in die Sinnesart ein, welche der Bildung der Sprache und des Styls zum Grunde gelegen hat, und spürt mit Freuden, wenn man nach einer Zwischenzeit zu dem oft betrachteten zurückkehrt, daß einem ein neues Licht aufgegangen ist. Indessen denke ich, in der Folge, wenn erst eine gewisse Anzahl bequemer und correcter Ausgaben vorhanden sind, [5] werden Ew. Excellenz den Râmâyana und andre epische Stücke während der Nachmittagsruhe wie die Zeitungen weglesen können.
Ich stelle mir vor, die Jugendgeschichten des Krischnas und seine Liebschaften mit den Hirtinnen in dem Bhagavata-Purâna müssen sehr anmuthig seyn.
Über den Gegensatz, welchen das Indische Epos mit dem Griechischen bildet, bin ich vollkommen einverstanden; indessen finde ich auch große Züge der Ähnlichkeit. Wenn wir jenes erst besser kennen, wird dieß Anlaß zu den anziehendsten Vergleichungen geben. Ungeachtet der völligen Emancipation der Homeriden von der priesterlichen Zucht glaube ich doch im Homer noch Spuren der älteren sacerdotalen Poesie durchschimmern zu sehen. Auf der andern Seite kann ich nicht umhin anzunehmen, daß manche Theile der Indischen Mythologie von den Kschatriya’s und ihren Sängern ausgegangen sind und daß die Brahmanen sie nur nach ihrem Sinne umgestaltet und sich zugeeignet haben. Ein gelehrter Freund machte mir die Bemerkung, man dürfe aus dem Râmâyana nur die Capitel von der Incarnation wegnehmen, [6] so erscheine nachher das Übrige als eine bloß menschliche Heldengeschichte. Soll doch selbst Valmikis der Sage nach nicht einmal ein Brahmane gewesen seyn. Vyâsas freylich war es, aber Vyâsas ist, wie ʻΟμηρος von ὁμη und ἀρω, der Zusammenfüger, und daß bey den Sagengedichten Brahmanen dieses Amt übernommen, kann man gern glauben.
Es freut mich außerordentlich, daß meine Versuche mit Übertragung der Sentenzen Ew. Excellenz nicht misfallen. Hier ist eine artige von Bhartṛi-Hari; ein verliebtes Epigramm:
Bey der Lampe, des Heerds Flamme, bey Mond- Sternen und Sonnenschein,
Fern von des Mädchens Rehaugen liegt die Welt mir in Finsterniß.
Es kommt, wie mich dünkt, hauptsächlich darauf an, daß man am Schluße des ersten Hemistichs den Fuß:
ᴗ – – ͞ᴗ
recht fühlbar mache, und in dem zweiten den jambischen Gang vermeide. Die Gefahr des Holperichten liegt freylich sehr nahe, das haben uns leider die Beyspiele bewiesen. Und wie ist es zu machen, wenn das Sylbenmaaß ein künstlicheres, und wie die lyrischen der Alten von einem Ende zum andern ganz festgesetzt ist? Damit gleichen Schritt zu [7] halten, wird sehr schwierig seyn. Übrigens muß ich mir doch die Freyheit vorbehalten, für die freye Nachbildung epischer Stücke so gelind fließende Hexameter zu machen, als ich nur irgend weiß und kann.
Die beiden von Ew. Excellenz angeordneten Auslassungen in dem letzten Theile der Abhandlung besorge ich sogleich.
In diesem Augenblicke erhalte ich durch eine verbindliche Sendung von Herrn Bernstein seine lithographischen Blätter. Sie gefallen mir ganz ungemein wohl, ja ich freue mich, sie den Frankschen Ungeheuern entgegenstellen zu können, welche uns im Auslande lächerlich machen, und ich werde ihm darüber schreiben.
Freylich sollte man den Apostroph wohl immer setzen, wie alles was zur Deutlichkeit dient, ohne sich von dem ursprünglichen Gebrauche zu entfernen. In dem hitōpadēs͗ōʼyaṃ könnte ja der unerfahrne Schüler das letzte Wort für den Acc. pronom. relat. nehmen. Noch viel unerlaßlicher ist das Zeichen aber, wenn das a privativum wegfällt vor einem sonoren Buchstaben, welcher das visarga auf gleiche Weise verwandelt haben würde. Hier könnte man der Sprache selbst Zweideutigkeit vorwerfen, wenn das a, [8] obschon elidirt, nicht hörbar bliebe, weswegen das Zeichen ʾ ein halbes ă heißt. Dieß bestätigt auch Colebrooke in seiner Abhandlung von der Indischen Poesie von den sämtlichen Synaloephen, so wie Brunck behauptet, dasselbe habe in den dramatischen Versen der Griechen Statt gefunden.
Desto besser, wenn Haughton die Analyse des Hitôpadêṣa nicht gemacht hat. Als er in Paris war, befand ich mich wegen der Krankheit meiner verewigten Freundin in so schweren Bekümmernissen, daß ich seinen Besuch gar nicht benutzen konnte. Chézy hatte aber wegen des verwünschten Verses Hitop. ed. Lond. pag. 2. lin. 21. guṇi p ein Orakel von ihm begehrt, und seine Antwort nicht ganz befriedigend gefunden. Ich glaube einzusehn, daß die Dunkelheit von einem Wortspiele herrührt, bedarf aber dennoch, außer der Seramporer Leseart, einer Conjectur, um einigermaßen herauszukommen.
Die Umstellung eines Verses oder Distichons scheint mir zu den gelinderen Emendationen zu gehören. Der Indische Abschreiber entstellt seine Arbeit nicht gern durch Ausstreichen; wenn er nun die wahre Ordnung verfehlt hat, so macht [9] er vielleicht ein kleines Zeichen dabey, welches übersehen wird, und so kann der Irrthum sich leicht in einer Menge Handschriften verbreiten.
Man schildert mir den Zustand der Sanskritstudien in Paris als nicht sonderlich blühend. Dagegen weiß Remusat den Eifer für das Chinesische zu beleben. Die Asiatische Gesellschaft hat noch keine Anstalt zu Devanagari-Lettern gemacht, und es ist fürs erste noch keine Aussicht dazu da. Ein Privatversuch, meldet man mir, werde angestellt, scheine aber nicht sonderlich auszufallen.
Ich empfehle mich dem wohlwollenden Andenken Ew. Excellenz mit unbegränzter Verehrung.
gehorsamst
AWvSchlegel.
Von dem Unglücke des wackern Wilken wußte ich noch nicht, und beklage es von ganzem Herzen, um so mehr da ich ihn persönlich kennen gelernt habe, und auch an seiner Frau und ihrer Familie freundschaftlich Antheil nehme.
[10]
[11]
[12]