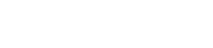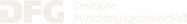Liebe Freundin!
Ich begreife nicht, warum Sie sich beklagen. Ich habe an jedem verabredeten Tage geschrieben und darüber hinaus noch an anderen Posttagen – ich stecke die Briefe stets selbst in den Kasten und sorge dafür, daß es rechtzeitig geschieht. Wir haben nicht verabredet, daß alle Briefe gleich lang sein sollten, im Gegenteil: Sie sagten mir, es sei besser, wenn man zufällig verhindert sei, nur einige Zeilen zu schreiben, als den Brief zu verschieben. Ich habe Ihnen am Sonntag geschrieben, aber, wie ich glaube, unmittelbar nach Genf, und ebenso am Dienstag.
Ich habe mehr Grund zur Unruhe als Sie, wenn Briefe ausbleiben. Sie wissen, daß meine physische und psychische Konstitution nicht zu erschüttern ist; im übrigen ist hier auch kein unangenehmer Zwischenfall zu befürchten – aber über Ihre Gesundheit bin ich unruhig und habe den glühenden Wunsch, daß Sie alles tun, was das Wissen Ihrer Ärzte ausfindig machen kann, und daß Sie ja darauf achten, sich zu pflegen. Sicherlich muß die Kälte Ihnen sehr unangenehm sein – mir auch, aber mir fügt sie keinen weiteren Schaden zu, als daß ich dauernd erkältet bin.
Ich schrieb Ihnen schon, wie der Sekretär von Herrn Schr[aut] den Zeitungsartikel ansieht, der Ihre Aufmerksamkeit geweckt hat. Von Friedrich habe ich einen Brief vom 4. Januar; er erwähnt nichts über die politische Lage, scheint aber ganz davon überzeugt zu sein, daß der augenblickliche Zustand andauern wird. Er bezieht sich auf einen früheren Brief, der verloren gegangen ist. Sein Bedienter wird das Porto in seine Tasche gesteckt haben; er ist nach vielen Betrügereien verschwunden. Wiewohl ich im allgemeinen nicht an verlorene Briefe glaube, so ist es diesmal doch sehr wahrscheinlich, da er sehnlichst wünscht, für seine Zeitschrift etwas von mir zu bekommen, und ich ihm erklärt hatte, sein Schweigen verhindere mich, ihm mehr zu schicken.
Sein Deutsches Museum hat zu erscheinen begonnen; die Ankündigung liegt bei. Das erste Heft hoffe ich bald zu erhalten und lasse es Ihnen dann sofort zugehen. Friedrich hat in diesem Heft einen langen Auszug aus einer neuen Schrift von Jacobi veröffentlicht, ist aber insofern behutsam verfahren, als er ihn Jacobi selbst schickte.
Er wiederholt dringend die Bitte, ob Sie ihm nicht etwas von Ihnen geben wollten, das dann ich oder er selber übersetzen würde. Wenn Sie Ihre geplante Abhandlung über Kleists Selbstmord fertig hätten, so wäre das ausgezeichnet. Friedrich meint, bei Kleist gingen in seinem Leben wie in seinen Schöpfungen Genie und Wahnsinn durcheinander.
Ich muß Goethes Buch, das ich in losen Bogen bekommen habe, erst heften lassen, sonst wäre es für Sie zu unbequem, aber Sie erhalten es bestimmt am Montag; ich bezweifle jedoch, daß es Ihnen so gut wie mir gefallen wird. Es endet mit der Beschreibung einer Krönung, in die hinein eine ziemlich gewöhnliche Liebeständelei spielt. Sonst aber erkenne ich im Kinde sehr gut den späteren Mann. Diejenigen allerdings, die für sein charakteristischstes Werk den Werther halten, werden das nicht finden. Man wird vielleicht in der Folge sehen, daß er diesen Roman nicht als Meister und Führer, sondern nur als passives Werkzeug der zeitgenössischen Empfindsamkeit geschrieben hat.
Friedrich gibt den Kindern des Fürsten Lichtenstein Stunden – ich glaube Geschichtsunterricht; er rühmt die Fürstin sehr.
Ich bitte Sie, Sim[onde de Sismondi] nicht zu sehr zu erbosen und so heftig auf unser Eigentum zu pochen. Ich bin daran gewöhnt, daß man meine Gedanken nimmt, ohne mich zu zitieren. Sobald sie einmal gedruckt sind, sind sie sozusagen juris publici, und das Plagiat läßt sie wenigstens durch die Welt laufen. Mit den Gedanken aber, die man in der Unterhaltung äußert – da ist es etwas anderes. Nur die Freunde haben ein Anrecht darauf, sie zu benutzen. Der gute Sim[onde]! Wie hätten ihm meine 18 Fürstinnen den Kopf verdreht! Der Erfolg seiner puritanischen Vorlesungen beweist nur, wie wenig die Genfer in der Literatur bewandert sind. Aber ich würde ihm nicht raten, den Schauplatz zu verlegen: er hat keine Vorstellung davon, wie man in Paris sprechen muß, um sich Gehör zu verschaffen. Seine Artikel sind wenig elegant redigiert, und was seine Kenntnisse betrifft, so ist ihm Ginguené unendlich überlegen.
Wie kommt nur Pictet darauf, ein so mittelmäßiges und unter einem antiken Kostüm so lächerlich modernes Buch wie den Agathokles zu übersetzen? Wir haben Hunderte von neuen Romanen, die besser sind als dieser. Sie können sicher sein, daß, wenn Sie mir nicht erlauben, den neuen Übersetzer meiner Vorlesungen zu nennen, ich ihn unter allen Umständen ungenannt sein lassen werde. Ich hoffe, Sie haben einen Brief von mir in Händen, in dem ich mich weitläufig hierüber äußere – ich bedaure, immer noch keinen bequemen Kalender gefunden zu haben, um auf ihm alle meine Briefe zu vermerken.
Ich freue mich darüber, daß Sie für die Biographie den Artikel über Camoëns schreiben, aber gern möchte ich bei Ihnen sein, um Ihnen die wenig bekannten Stellen seines Gedichtes zu zeigen, die Stoff zu bedeutsamen Zügen liefern. Schön ist es, daß die letzte Leidenszeit des Dichters mit dem tragischen Untergang König Sebastians eng verbunden ist. Der Sänger des portugiesischen Heldentums trauerte um ihn und starb vielleicht an diesem Gram. Seine Prophezeiungen über das große Schicksal des jungen Königs erfüllten sich nicht.
In der Zeitschrift Europa findet sich ein sehr schöner Artikel meines Bruders über Camoëns und die Lusiaden, ich weiß nicht, in welchem der beiden Bände – ich gebe Cachet den Auftrag, sie Ihnen zu bringen, aber ich bitte Sie, diese Bände und den S[ain]t-Martin wieder in meine Bibliothek stellen zu lassen.
Schicken Sie Ihren Artikel keinesfalls fort, ohne ihn mir gezeigt zu haben. Geben Sie bitte den Auftrag, für meine Rechnung Cachet drei Louisdor zu zahlen. Zum großen Teil hat er sie schon ausgegeben oder wird es noch tun. Tausend Lebewohl, liebe Freundin!