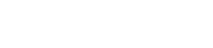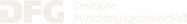Ew. Excellenz haben mich durch Ihren Brief vom 19ten Mai auf die angenehmste Weise von der Welt überrascht. Mich drückte das Gefühl einer lange rückständigen Schuld: ich wußte in der That kaum, wie ich nach einer solchen, freilich unwillkührlichen, Versäumniß vor Ihnen erscheinen sollte. Ich sendete mein drittes Heft als den Vorläufer meiner Entschuldigungen, mit dem festen Vorsatz ihn bald durch einen Brief einzuholen. Nun ist mir die Güte Ew. Excellenz dennoch zuvorgekommen, und es freut mich unendlich, zu sehen, daß mein Bote seinen Auftrag so gut ausgerichtet hat.
Ihr Urtheil ist das erste auswärtige, welches mir zukömmt: das erste und das gültigste. Wenn ich hoffen könnte, in Europa und Asien zehn solche Leser zusammen zu bringen, so wäre meine Mühe reichlich belohnt. Meine Warnung, das Sanskrit nicht als eine flüchtige Liebhaberey zu treiben, gilt nur [für] die Neugierigen, welche es lernen wollen, wie man etwa Indianische Vogelnester auch einmal zu schmecken begierig ist. Ew. Excellenz haben die Proben, welche ich verlangte, hundertfältig abgelegt; und wenn Sie auch eine Sache eben erst anfangen, so sind Sie dennoch kein Anfänger, sondern ein Meister, weil Sie ein gebohrner Meister sind.
Der Lateinische Aufsatz ist schon vor ein paar Jahren geschrieben. Ich sahe wohl, daß vieles darin der Entwickelung und [2] näheren Bestimmung bedürfte, allein dieß hätte mich zu weit geführt: ich habe nichts hinzugefügt, als die Bemerkungen über das Digamma. Bey der Abhandlung über Wilson fiel mir immer das Versprechen ein, das ich den Lesern zu Anfange gegeben, sie sollten in jedem Hefte nur wenige Blätter zu überschlagen finden. Sonst hätte ich weit mehr ins einzelne gehen können, Beyspiele genug hatte ich dazu im Vorrath: doch fiel es mir freylich sehr beschwerlich, weil mein Setzkasten noch nicht in Ordnung war, und ich jeden Devanagari-Buchstaben aus der ganzen Masse einzeln heraussuchen mußte.
Von meiner Grammatik sind zwey Capitel, über die Buchstaben und die Buchstaben-Verbindung völlig ins reine gebracht, die ich auch von meinen Zuhörern abschreiben lasse. In dem letzten schmeichle ich mir ein paar wesentliche Irrthümer von Wilkins berichtigt zu haben. Ich hoffe doch auf alle Weise, daß die Erlernung noch beträchtlich erleichtert werden kann.
Für die mir zugesendete Vorlesung über die Aufgabe des Geschichtschreibers sage ich Ew. Excellenz meinen herzlichsten Dank. Durch die Güte Ihres Herrn Bruders hatte sie mir schon in Paris einen großen Genuß gewährt.
Ich habe schon einmal die Bitte gewagt, mir etwas für meine Indische Bibliothek zu schenken, welche durch einen Beytrag auch nur von wenigen Blättern die schönste Zierde gewinnen würde. Die Bitte wäre [3] sogleich erfüllt, wenn Ew. Excellenz mir gestatten wollten, den wissenschaftlichen Theil Ihres Briefes nur geradezu abzudrucken.
Wiewohl ein Brief von solchem Gehalt zu vielfältiger Erwägung und langem Nachdenken einladet, so will ich doch dießmal sogleich aus dem Stegereif antworten, so gut es gehen mag, um nicht von neuem in das Vertagen hineinzugerathen.
Zuvörderst wünsche ich mir Glück dazu, daß die Ansichten Ew. Excellenz über einige Punkte, namentlich über die Frage von der Ursprünglichkeit der Flexionen, oder ihre Entstehung aus Agglutination, nicht so weit von den meinigen abweichen, als ich besorgt hatte. Ich wurde bedenklich wegen der Durchführung einiger in den Observations aufgestellten Sätze. Mit Bopp gedachte ich zwar schon fertig zu werden, aber wenn Gegner wie Ew. Excellenz oder Abel Remusat ins Feld rücken, so gewinnt die Sache ein andres Ansehen. Remusat neigt sich ebenfalls zu der Lehre von der Agglutination, und mag für seine Tartarischen Sprachen wohl Recht haben. Aber Bopps Versuch, im Griechischen und Sanskrit die Conjugation des Praesens (weiter geht es ja doch nicht) aus den persönlichen Fürwörtern herzuleiten, scheint mir ganz mislungen. Mit der ersten Person auf μι hat es einigen Schein; aber dieser verschwindet schon bey der zweiten auf σι, denn hier würde τι erfodert, weil die Verwandlung von τυ in συ erst sehr spät erfolgt ist, im Jonischen Dialect zu Homers Zeit noch nicht ganz durchgedrungen war, und im Aeolischen und Dorischen niemals ganz durchgedrungen [4] ist. Und nun vollends der Pluralis! Wie lauten die ältesten Formen von wir, ihr? ἀμμε, ὐμμε oder ἀμες, ὐμες. Wenn es nun statt τύπτομες, τύπτετε hieße: τύπταμες, wir schlagen, τύπτυμες, ihr schlagt, so möchte sich die Hypothese hören lassen. Endlich bharati und bharanti, τυπτετε und τυπτοντι; hier ist die Mehrheit bey gleichbleibender Endung durch ein eingeschobenes n angedeutet: wo findet sich aber in diesen Sprachen irgend ein Beyspiel, daß der Plural der nomina oder pronomina durch ein n praefixum ausgedrückt wäre?
Daß eine Sprache, welche die Conjugation besäße, sich ohne pronomina behelfen könnte, läßt sich begreifen; wenn hingegen eine Sprache schon pronomina hätte, aber keine Conjugation, so glaube ich, sie würde immer auf der Stufe des Negerfranzösischen verharren: moi aller, toi aller, lui aller. Psychologisch betrachtet gehören die pronomina überhaupt nicht zu den frühesten Wörtern, wie jeder an den Kindern wahrnehmen kann; sie sind ja Substitutionen. Wenn einmal durchaus das eine aus dem andern erklärt werden soll, so möchte ich noch lieber annehmen, die Pronomina seyen durch Ablösung der Personal-Endungen entstanden, als umgekehrt. Aber nach der Beschaffenheit der Sylben und Buchstaben sehe ich in diesem Kreise von Sprachen keine Möglichkeit hiezu; wiewohl ich nicht abläugnen will, daß das ω statt μι in einer gewissen Beziehung mit ἐγω statt aham stehe.
Daß es auch in alten und ungemischten Sprachen scheinbare Flexionen giebt, welche in der That mit Auxiliaren [5] gebildet sind, gebe ich zu, und behaupte es sogar. Ich meyne aber, diese Formationen wären sämtlich sehr jung im Vergleich mit den ächten Flexionen, sie gehörten einer andern Epoche des menschlichen Geistes an, und ließen sich erkennen, wie die neuen Thon- oder Gips-Schichten, die man über einem Urgebirge gelagert findet. Auch setzt der Gebrauch solcher Auxiliare immer schon das Daseyn der Flexionen voraus. Das erste Futurum im Sanskrit gehört ausgemacht zu dieser Classe, und Bopp hätte darüber gar nicht zweifelhaft reden dürfen. Auch amaveram, amavissem, statt amavi-eram, amavi-essem, (zwar nicht nach der besten Logik) lasse ich mir gefallen; aber amavi aus ama-fui, das ist ganz etwas anders. Denn fürs erste ist hiemit nichts ausgerichtet für die Erklärung von lĕgo, lēgi, iăcio, iēci, curro, cucurri; und hievon hätte doch alles ausgehen müssen, weil die dritte Conjugation im Lateinischen die Grundform ist, während man die übrigen nur wie die verba contracta im Griechischen zu betrachten hat. Ich erkläre amavi ganz anders: amā-i, amaƑi; das Digamma ist bloß eingeschoben, um den Hiatus zu vermeiden, oder vielmehr um den charakteristischen Vocal ohne Verschmelzung in einen Diphthongen rein zu bewahren. Aber ich will einmal ama-fui zugeben, so ist damit noch nichts gewonnen, denn nun muß ich die Entstehung eines Praeteritums fui aus dem Praesens fuo erklären, und hätte ich dieß an einem einzigen Verbum begriffen, so gölte es mir auch für alle übrigen, und ich brauchte das Hypothesen-[6]Gerüste nicht. Es hieß ohne Zweifel vor Alters fufui, wie πέφvα und babhūva. Da haben wir also das augmentum reduplicationis, welches nun doch einmal für allemal nicht durch fremde Zuthaten erklärt werden kann.
Überhaupt scheint es mir ein Grundirrthum von Bopp zu seyn, daß er das verbum substantivum als das erste betrachtet, da es vielmehr als solches, wenigstens in dieser ganzen Familie von Sprachen gewiß, das letzte aller verba war. Denn es ist ja aus der Demonetisation entstanden, aus der Reduction eines concreten Daseyns auf die Existenz überhaupt, und endlich auf die logische Copula. Daß fuo ursprünglich im Lateinischen dasselbe bedeutete wie φύω, daß es erst sehr spät zur Ergänzung des defectiven esse gebraucht ward, erhellet aus einer Menge abgeleiteten Wörtern: foetus, foemen, foemina (gleichsam φυομενα im Sinn des Mediums), endlich aus jenem unanständigen Wort, welches dem Griechischen φυτεύω buchstäblich entspricht, und ohne Zweifel ursprünglich wie dieses ehrbar war, als ein caussativum von fuo: ich säe, pflanze, mache wachsen. Die concrete Bedeutung von ἐσμι ist in den übrigen Sprachen verwittert, im Sanskrit glaube ich sie noch zu erkennen. ās heißt sitzen, und geht nach derselben Conjugation wie ăs seyn: was ist nun natürlicher, als daß durch die Verkürzung des Vocals die Abstraction ausgedrückt wurde? Das Gewicht des Wortes wurde gleichsam erleichtert, wie der Begriff unbestimmter [7] geworden war. Haben doch noch in neueren Zeiten die Romanischen Völker auf gleiche Weise das Stehen zum Seyn umgestempelt.
Den Untergang so mancher Flexionen, die in allen Sprachen dieser Familie gewiß vorhanden waren, erkläre ich mir aus der verwahrlosten Aussprache in unlitterarischen Zeiträumen. Wenn der Unterschied des Activums und Passivums im Sanskrit und im Griechischen auf einem kurzen Vocal oder einem Diphthongen beruhte, so mußten die Lateiner, sobald sie die schließenden Vocale abkniffen und statt amati, amanti sagten amat, amant, ihr Passivum einbüßen. In solchen Fällen half man sich nun nach derselben Methode, welcher die neueren analytischen Sprachen Europaʼs ihr Daseyn verdanken, wie ich in der Schrift über das Provenzalische gezeigt habe. Da die Lateiner doch ein passivum brauchten, so bildeten sie es durch Agglutination der Partikel re, welche die Rückwirkung ausdrückte, mit dem Activum. Das einzige legimini steht seltsam fremdartig dazwischen. Ich möchte es für den Plural des passiven Participiums halten: legimini, λεγόμενοι. Daß in Vertumnus, auctumnus, alumnus, columna u. s. w. die alte Conjugation des Passivums noch hervorblickt, hat schon Lanzi bemerkt. Die Lateiner haben sich noch leidlich aus dem Handel gezogen, wiewohl die vielen r ein übles Schnarren verursachen. Ist nicht das Schwedische passivum auf s auf ähnliche Weise entstanden wie man im Italiänischen sagt si dice für dicitur? Den Untergang des organischen [8] Passivums im Deutschen haben wir ja so zu sagen erlebt. Denn im Ulfilas findet es sich noch, und zwar, was selbst Grimm übersehen hat, nach einer doppelten Hauptform. Die zu der zweiten gehörigen verba stehen in Grimms D. Gr. p. 441 beysammen. Er hat merkwürdige Beyspiele gegeben, wie man in der Fränkischen Zeit, da das passivum verloren war, das activum geradezu dafür gesetzt, weil man sich noch nicht zu den Auxiliaren entschlossen hatte. Mit dem Agglutiniren hat es in der Deutschen Sprache wegen der Sprödigkeit des Stoffes, seitdem wir die schöne Vielsylbigkeit der Gothen verloren hatten, niemals recht gelingen wollen.
Im Angelsächsischen ist allerdings durch die Aussprache eines Küsten- und Nebellandes manches abgestumpft worden, aber den Geschlechts-Unterschied an dem Artikel oder demonstrativen Pronomen the hat erst die Normännische Eroberung ausgelöscht: der Angelsächsische nom. sing. in den drey Geschlechtern ist noch ganz dem Gothischen ähnlich.
Zu einer grammatischen Übereinstimmung, woraus Verwandtschaft der Völker erwiesen werden soll, halte ich alle die drey Stücke für erfoderlich, welche von Ew. Excellenz so lichtvoll unterschieden werden: die psychologische Richtung, die technische Methode, und endlich das hörbare Material. Aber meines Erachtens [9] braucht die Übereinstimmung nicht allgemein und durchgängig zu seyn, sondern eine theilweise Statt findende Einerleyheit reicht völlig hin. Ja je specieller der Fall, desto stärker der Beweis, weswegen die Anomalien am besten zu brauchen sind. ZB. das Verbum vid (Classe 2), wissen, hat die Eigenheit, daß das praet. perf. statt des praesens gebraucht wird. Eben dasselbe gilt von dem entsprechenden Griechischen εἴδω, und von unserm wissen bis auf den heutigen Tag. Ich weiß ist ausgemacht das praet. perf. der starken Conjugation: die Einsylbigkeit, die Einerleyheit der ersten und dritten pers. sing., das Anwachsen im Plural beweisen dieß unwiderleglich. Allein die meisten Deutschen wissen dieß nicht, weswegen die Schwaben niemals ermangeln zu sagen er weißt. Grimm hat ganz richtig gezeigt, daß die Anomalie einiger Deutscher verba bloß darin besteht, daß das praet. perf. der starken Form als praesens gebraucht wird, und nachher ein neues praeteritum der schwachen Form gebildet worden. (D. Gramm. p. 435, 36.)
Nun lauten die paradigmata folgendergestalt.
Sanskrit. Griechisch. Gothisch.
Sing. 1. vēda ƑΟΙΔΑ vait
2. vettha ƑΟΙΔΑΣ vaist
3. vēda ƑΟΙΔΕ vait
Sanskrit. Griechisch. Gothisch.
Plur. 1. vidma ƑΟΙΔΑΜΕΣ vitum
2. vida ƑΟΙΔΑΤΕ vituth
3. viduh ƑΟΙΔΑΣΙ vitun
Ich habe im Griechischen die alte und ächte Form hergestellt. Vgl. Matthiae Gramm. p. 315. Was in den gewöhnlichen Grammatiken als der dual. und plur. von οἶδα aufgeführt wird, gehört gar nicht hieher. Was ist nun gegen eine solche zugleich materielle [10] und formale Übereinstimmung einzuwenden? Ich gestehe, für mich hat sie die Stärke eines geometrischen Beweises, daß die Vorfahren der Indier, der Griechen und der Germanier irgend einmal ein einziges Volk ausmachten, und daß die letzten beiden die Anomalie schon aus ihren Asiatischen Ursitzen mitgebracht. Ich sehe wohl einen psychologischen Grund ein, warum gerade bey diesem verbum das praeteritum für das praesens gilt: wissen ist nämlich gesehn oder erfahren haben; aber dieß schwächt die Beweiskraft nur wenig.
Aristoteles wirft die Frage auf, ob die Sprache der Natur oder der Übereinkunft ihren Ursprung verdanke? und entscheidet sich nach der Erfahrung von der unübersehlichen Verschiedenheit der Sprachen für das letzte. Das Dilemma des großen Denkers war, dünkt mich, nicht recht gestellt. Wenn man die beiden Begriffe Natur und Übereinkunft übersetzt durch Nothwendigkeit und Willkühr, so sieht man gleich, daß noch ein drittes in der Mitte liegt, nämlich die menschliche Freyheit, die sich nach naturgemäßen Gründen selbst bestimmt. Es war eine Einladung, nicht eine Nöthigung der Natur. Hier liegt das große Gebiet der edleren Sprachbildung, das Symbolische. Es konnten für denselben Begriff verschiedene Zeichen gewählt werden, die doch alle treffend und ähnlich waren. Ich glaube daher, daß auch solche Übereinstimmungen in den grammatischen Formen, welche psychologisch erklärbar sind, zum Beweise der genealogischen Verwandtschaft, in Verbindung mit andern, gebraucht werden [11] können.
Wenn wir nun sehen, daß verwandte Sprachen solche kleine Anomalien, und andre Eigenthümlichkeiten, mit unglaublicher Tenacität Jahrtausende hindurch behauptet haben, und daß sie auf der andern Seite so unendlich weit auseinandergegangen sind, ohne daß man plötzliche Zerrüttungen und Mischungen vermuthen dürfte, so führt dieß auf das geschichtlich unendlich wichtige Resultat von der langen Trennung der Völker und dem hohen Alter des Menschengeschlechtes.
Die Verschiedenheit muß auf zweierley Art erklärt werden: durch das Vergessen des Alten und das Erfinden von etwas neuem. Das erste spielt aber dabey bey weitem die größte Rolle. Haben wir nicht an unsrer eignen Sprache das vierzehnhundertjährige Schauspiel des allmählichen Unterganges der tönendsten Mannigfaltigkeit der Formen bis zum beinahe gänzlichen Verstummen, ohne andern Ersatz als den der Surrogate für den logischen Bedarf?
Die Deutsche Sprache hat von jeher, so lange wir sie kennen, kein Futurum gehabt, und ermangelt dessen bis auf den heutigen Tag. Haben nun die Germanier ihr altes Futurum vergessen, oder haben die Stammväter der Griechen und Indier das ihrige erst seit der Trennung von jenen erfunden? Das erste ist mir wahrscheinlicher, weil die Bildungsweise durch Einschiebung des Zischlautes zwischen die Wurzel und die Personen-Endungen des praesens im Griechischen und im Sanskrit dieselbe ist. Dazu kommen noch die Spuren im Lateinischen: facso u. s. w.; [12] vermuthlich hieß amabo ehemals amaso. Legam, leges ist ein Surrogat für λεγσω, entlehnt von dem conj. praes. Bopp will auch hier wieder ein Auxiliar-Verbum wittern, aber vergeblich. – Wie dem auch sey, die alten Deutschen fragten wohl nicht viel nach der Zukunft, oder sie betrachteten sie rüstig, als wäre sie wirklich schon gegenwärtig. Wiewohl der Gebrauch des praesens für das Futurum, wie wir ihn noch im Notker sehen, unaufhörliche Misverständnisse verursachen mußte, haben sie sich über sechs Jahrhunderte so beholfen, ehe sie sich entschieden zu den Auxiliaren bequemten; so eingefleischt war ihre Abneigung vor jenem Zusammenbacken der Begriffe zum Ausdruck einer einfachen Thatsache, welches Bopp zum Grundprincip unsrer und der sämtlichen verwandten Sprachen erheben will.
Ew.Excellenz unterscheiden vortrefflich bey dem intellectuellen Geschäft der Sprachbildung das logisch-mechanische und das genialische. Man könnte jenes auch das Discursive, dieses das Intuitive nennen. Ich meyne nur, wo sich das Genialische spüren läßt, sey es das ältere, und gehe in eine Vorzeit zurück, welche von unserer Geschichte nicht erreicht wird, während die mechanische Sprachbildung durch alle Zeitalter fortgehen kann. Ew. Excellenz reden in einem unendlich interessanten Briefe über die Erfindung der Buchstabenschrift, woraus mir mein Freund Welcker eine Stelle mitgetheilt hat, von geistigen Trieben, welche erwachen mußten, wenn es dazu kommen sollte. Ich meyne, bey [13] einem Theile des ältesten Menschengeschlechts wären jene geistigen Triebe ursprünglich wach gewesen, und erst nachher durch den Druck des irdischen Lebens eingeschlafen, als schon alle Grundlagen des gesitteten Lebens gesichert waren. Bey manchen Völkern dürften jene Triebe nur durch fremde Mittheilung erwecklich seyn. Ich kann die ganze Menschengeschichte nicht begreifen, ohne die Annahme jener Platonischen Gesetzgeber, eines Menschengeschlechts, das ursprünglich erleuchtet war, dem eine divinatorische Erkenntniß einwohnte, welche nicht aus der Erfahrung geschöpft war, sondern ihr vorauseilte. Die Erziehung der Völker war auch eine von den genialischen Künsten der Vorwelt, welche sich durch Überlieferung noch bis in den Zeitraum unsrer Geschichte hinein fortgepflanzt hat, der neueren Welt aber ganz ausgegangen ist. Freylich ließen sich nicht alle Unterschiede aufheben, weil sie physiologisch bedingt und erblich sind. In Absicht auf die Culturfähigkeit kann ich nicht weniger als drey Stufen annehmen: die ursprünglich selbstthätigen, die für fremde Anregung empfänglichen, und endlich die ganz tellurischen Menschen, bey denen der himmlische Funken niemals zünden konnte. Remusat mag zum Lobe seiner Chinesen sagen was er will: ihre Sprache, ihre Sitten, ihre Schrift, ihre Kunst, ihre Wissenschaft, ihre Moral, wie fein und spitzfindig das alles seyn mag, liefert doch nur den traurigen Beweis, daß auch die höchste Cultur, deren eine apokryphische Menschenart fähig war, ewig einen [14] mühseligen, geist- und gemüthlosen Charakter behalten muß.
In den edleren Sprachen nun scheint mir der genialische Bildungstrieb gleich vom Anfange an rege gewesen zu seyn, und alle wahrhaft fruchtbaren Principien der Entwicklung schreibe ich der entferntesten Urzeit zu. Hingegen das Zusammenflicken mit dem Verstande, wo die ursprüngliche Einheit der Anschauung verloren war, die Surrogate, die Misbildungen und Fehlgeburten des grammatischen Instinkts sind das Machwerk späterer Zeiten; und dieß wird sich oft historisch nachweisen lassen. Ich kann die Einflüsse der Zeit nicht unbedingt als günstig für die Entwickelung der Sprachen betrachten, am wenigsten nach einem chronologischen Maaßstabe. Die schöpferische Sprachbildung erscheint wie ein Moment; dann folgten oft lange Zeiträume der Vergessenheit und Verwahrlosung, und endlich die späte Nachhülfe, um sich ein brauchbares Werkzeug zur Handhabung der Erfahrungswelt zu verschaffen. Ich kann daher nicht umhin zu glauben, daß die gemeinschaftliche Muttersprache des Indischen, Persischen, Griechischen, Lateinischen und Germanischen eine unendliche Fülle von intuitiven und imaginativen Reichthümern in Wörtern und Formen besessen haben muß, wenn sie auch dialectisch noch ganz unangebaut war. Die großen Vorzüge des Sanskrit scheinen mir zu seyn, daß die Verwilderung nur in geringem Grade Statt gefunden, und daher aus der Urzeit am meisten gerettet worden; dann [15] daß es Jahrtausende lang das Organ einer begeisterten Philosophie und Poesie gewesen, welche sich an jene ältere Phase des Menschengeschlechts anschlossen. Die Mängel rühren daher, daß die Sprache durch geheiligte Auctoritäten fixirt worden ist, ehe man darauf bedacht gewesen war, für alle Bedürfnisse des analytischen Verstandes Einrichtungen zu treffen.
Wenn jene Platonischen Gesetzgeber ihre höhere Eingebung besonders dadurch bewährten, daß ihre Bezeichnungsweise dem Wesen der Dinge entsprach, so mußten sie auch dasjenige, was in der Natur kein selbstständiges Daseyn hat, sondern nur an den Substanzen und wirkenden Kräften in stetem Wechsel zum Vorschein kommt, mit einem Worte die Verhältnisse, bildlich eben so wandelbar und wiederum anhängend bezeichnen, durch schwebende Wörter, geeignet sich überall anzufügen, die aber, um bedeutsam hörbar zu werden, immer eine Unterlage bedurften. Solche Wörter waren die ursprünglichen Flexionen. Die Entstehung aus der Agglutination setzt einen gewissen Grad von Analyse und Abstraction voraus, und das Intuitive geht doch immer dem Discursiven voran.
Ich habe mich so weit verstiegen, daß Ew. Excellenz es schon längst überdrüssig geworden seyn werden, mir zu folgen. Es ist Zeit einzulenken, um noch einige einzelne grammatische Punkte zu erörtern.
Ich redete p. 332 von den Präpositionen im allgemeinen, nach der angenommenen Lehre; ich wollte die Ausnahmen, die mir allerdings gegenwärtig waren, nicht [16] erwähnen, weil mich dieß zu einer Beweisführung genöthigt haben würde, und sie doch nur von geringem Umfange sind. Mit der Bemerkung Ew. Excellenz über prati hat es seine vollkommne Richtigkeit: es regiert, für sich allein stehend, den Accusativ, und wird diesem immer nachgesetzt. Bey besserer Muße werden sich leicht Beispiele sammeln lassen: aber die von Ihnen angeführten sind vollkommen gültig. Im Ramayana L. 1. Sect. III. sl. 39. hat die Ausgabe von Serampore, wie so oft, eine falsche Leseart, die ich dießmal aus einer Parisischen Handschrift verbessern kann:
apratijṇā cha rāmasya gamanē kōsalān prati.
Nun ist alles deutlich: „Und die Weigerung des Ramas wegen des Hingehens pp.“ Die zweite Verschiedenheit der Leseart, der acc. plur. masc. statt des acc. sing. fem. könnte eine kleine Modification in der Bedeutung herbeiführen: Die Weigerung gegen die Kosaler p statt; die Weigerung nach Kosalâ hinzugehen. Die Erzählung muß dieß ausweisen. Die Wirkung der Präposition bleibt aber dieselbe. – Es giebt noch eine Ausnahme mit der Präposition ā, sie wird dem Substantiv vorgesetzt, damit zusammengeschrieben, und regiert den Ablativ oder Genitiv, dieß habe ich noch nicht ausmitteln können. Ramayana L. I, Sect. V, sl. 2:
āmanōḥ puṇyakīrtīnāṃ rājṇāmamitatējasāṃ.
Regum virtute celebratorum a Manue inde, der nämlich ihr Stammvater war. Ein andres Beispiel steht in den Versen, die Wilson in seiner Vorrede p. XVIII. anführt:
[17] āsētōrātusārādrēḥ, a ponte inde,
nämlich, von der Brücke des Ramas an bis zu dem Schneegebirge. Wilson hat irrig das visarga ganz weggelassen statt es in r verwandelt über das nächste Wort zu setzen. Der terminus ad quem steht also auch in demselben Casus. Doch ich glaube, man muß es lieber so fassen: von der Brücke an, auf der einen Seite, von dem Schneegebirge an auf der andern.
Dieß ist also ein wirklicher Anfang des Griechischen und Lateinischen Sprachgebrauchs, jedoch ein sehr geringer. Daß in diesen und den verwandten Sprachen aus Adverbien nicht nur, sondern aus Adjectiven, Substantiven, Participien, wahre Präpositionen geworden, ist nicht zu läugnen; von den Beispielen im Sanskrit aber, wo ein Adverbium einen Casus zu regieren scheint, kann ich kein einziges gelten lassen. tām ritē fasse ich wie: diese ausgenommen, hanc excipiendo. In tvatkṛitê ist der erste Bestandtheil nicht der Ablativ, sondern der status absolutus. Ich kann mich nicht erinnern, denjenigen status absolutus, der über den Paradigmen steht, jemals in der Composition gefunden zu haben: die Grammatiker haben ihn wohl nur von dem Casus 5 plur. entlehnt, um die anomale Declination einigermaßen zu construiren. Häufig ist hingegen mat und tvat; Wilson’s Artikel über das letzte ist durchaus irrig; in dem Artikel über mat aber ist die Sache richtig gefaßt, und das dort gesagte darf nur auf die zweite Person übertragen werden. tvatkṛitê ist ein Compositum, gerade wie deinetwegen. Hingegen in tasyâh kṛitê ist das erste nichts anders als der gewöhnliche [18] Genitiv der Abhängigkeit von einem andern Sustantiv: huius puellae gratiâ. Wenn Adverbia der Gemeinschaft mit dem Casus 3 stehen, so ist dieß gerade wie der Engländer sagt: together with him; saha têna; was dort die Präposition, drückt hier der Casus aus. Drücken wir doch auch im Deutschen sowohl das Werkzeug als die Gemeinschaft durch mit aus. Wenn Ew. Excellenz es dem Sanskrit zum Vorwurf machen, daß die casus zuweilen auf seltsame Art gebraucht werden, so will ich dieß nicht ganz abläugnen: doch bitte ich zu bemerken, daß die Benennung der casus nur von Einer Hauptbestimmung hergenommen werden konnte. Wie würde es ablaufen, wenn man im Griechischen und Lateinischen den Gebrauch der Casus, auch ohne Präposition, nach ihren Namen zergliedern wollte? Es wäre wohl überhaupt an der Zeit, statt der üblichen Benennungen mehr philosophische, jedoch gleichfalls Lateinische einzuführen. Ich schlage vor:
Subiectivus statt Nominativus,
Obiectivus – Accusativus,
Inclinativus – Dativus,
Egressivus – Ablativus,
Relativus – Genitivus.
Dieß letzte hat schon Colebrooke in seiner Grammatik. Die Namen, welche Wilkins den beiden eigenthümlichen Casus des Sanskrit ertheilt, Instrumentalis und Locativus, gefallen mir auch nicht; der erste nicht, weil er aus der Analogie herausgeht, der zweite nicht, wegen der speciellen Bedeutung des Wortes. [19] Den ersten könnte man effectivus nennen (Colebrooke hat: caussativus); den zweiten commorativus oder Immanentivus.
Ich hatte bey p. 283 das Unwesen im Sinne, welches Pezron, Court de Gebelin, Le Brigant pp mit dem Niederbretonischen getrieben. Daß in dem Bau und den Wörtern noch irgend eine, wiewohl sehr entstellte, Celtische Grundlage aufgesucht werden könne, bin ich nicht gesonnen zu läugnen. Aber was ist zu machen? Den Celtomanen ist ja in keiner Sylbe zu trauen. Ew. Excellenz würden mich sehr verbinden, wenn Sie mir nachweisen wollten, wo ich einen vernünftigen Unterricht über die Grammtik dieser Sprache finden kann. Uns wäre geholfen, wenn wir darüber eine kritische Arbeit hätten, wie die Ihrige über das Baskische. Wann hat man angefangen, in dieser Sprache zu schreiben, und was ist an zusammenhängenden, ächten, nicht zum Behuf einer Hypothese ersonnenen Texten gedruckt vorhanden? Ein Französischer Antiquar, de la Rue wo ich nicht irre, glaubte eine Spur Niederbretonischer Poesie aus dem 12ten Jahrhundert in der Provenzalischen Erwähnung eines lai Breton zu finden. Aber dieß ist ein Misverständniß: lai Breton heißt ein Lied in Nordfranzösischer Sprache. Wie hätte ein Troubadour wohl an dem unverständlichen Kauderwelsch Gefallen finden sollen! Der Gesang der Nachkommen Ossians in Hochschottland ist auch ein Gejauze, wodurch alle Katzen in die Flucht gejagt werden; ein junger Genfer, [20] der die Hebriden bereist hat, konnte es zum Todtlachen nachahmen.
Um das Historische des Nieder-Bretonischen habe ich mich sehr genau bekümmert: ich wollte in einem Essai sur la formation de la langue françoise ausführlich davon handeln. Daß das südliche Britannien von Gallien aus bevölkert worden, sehe ich als gewiß an; es fragt sich nur, ob dieß vor oder nach der Einwanderung der Deutschen Völkerschaften in Belgien geschehen? Das Belgische war doch vermuthlich eine Mischsprache, nicht bloß eine verschiedene Mundart des mittleren Celtischen: Julius Caesar hätte sich schwerlich so ausgedrückt, wie er thut, wenn er nicht dort einen andern Dollmetscher nöthig gehabt hätte. Aber gesetzt auch, die in Britannien eingewanderten wären reine Celten gewesen, so konnte dennoch auf andre Weise eine Mischung erfolgen: denn Tacitus hält die westlichen Britten für Iberier, und sein Zeugniß hierüber ist von besonderm Gewicht. Die nahe Verwandtschaft des Alt-Brittischen mit dem Celtischen geht indessen aus manchen Städtenamen und andern unwidersprechlich hervor. Nun aber haben die Britten mehr als dreihundert Jahre unter Römischer Herrschaft gestanden. Es ist ein Wunder, daß die Lateinische Sprache nicht ganz herrschend geworden, was in Gallien durch die garnisonirenden Truppen, durch die überall verbreiteten Latinisirten Sklaven, durch die Colonien, die negotiatores, durch alle Militär- Civil- und Polizey-Anstalten der Römer unglaublich schnell erfolgte. [21] Daß sich der Brittischen Sprache schon damals viel Lateinisch eingemischt, davon werden sich die Spuren vielleicht im Angelsächsischen nachweisen lassen. Nun ging ein Theil der Britten, vor den Sachsen flüchtend, nach der Mitte des 5ten Jahrhunderts auf die Gallische Westspitze hinüber. Hier lebten sie, außer der beständigen Nähe der Franken und Romanischen Einwohner, eingeklemmt zwischen zwey Sächsischen Colonien, wovon in der Merovingischen Zeit die eine bey Bayeux die andre bey Nantes saß; nachher hatten sie die Normannen zu Nachbarn. Was ist aus allem diesem zu folgern? Daß, wenn man im Nieder-Bretonischen Wörter findet, die Lateinischen und Deutschen ähnlich sind, diese als späte Einmischungen betrachtet werden müssen, daß man nicht umgekehrt das Lateinische und Deutsche aus dem Bas-Breton ableiten darf, wie es die Celtomanen wollen, und wie sichs leider auch Wachter und zum Theil Leibniz haben weiß machen lassen. Den grammatischen Typus mag man mit dem Wälschen, Hochschottischen und Irischen vergleichen, wenn sie einen haben. Ich kann die Stelle jetzt nicht auffinden, aber ich bin gewiß beym Nennius, einem Brittischen Geschichtschreiber des 9ten Jahrhunderts gelesen zu haben, daß die zurückgebliebenen Britten ihren Brüdern jenseit des Meeres einen Namen gaben, welcher bedeutete confuse loquentes. Welche Fortschritte in der Confusion mögen sie nun erst in den seitdem verflossenen tausend Jahren [22] gemacht haben!
Ich hatte noch ein artiges Capitel über den Imperativ, wozu ich auf Veranlassung eines frühern Briefes gesammelt hatte. Aber dieser Brief muß endlich ein Ende nehmen, sonst möchte es meinen Gönner gereuen, sich so anregend und belehrend mit mir unterhalten zu haben.
Ew. Excellenz haben die Angabe des Ortes vergessen; auf dem Umschlage stand der Stempel von Eisleben, ich vermuthe also, daß Sie sich auf einem Landgute in der Nähe befinden. In der Ungewißheit muß ich jedoch diese Blätter den Umweg über Berlin nehmen lassen.
Ich bitte Ew. Excellenz, mein auf alle Weise nachlässiges Geschreibe zu entschuldigen; ich empfehle mich und meine Arbeiten Ihrer ferneren geneigten Theilnahme, und habe die Ehre mit den ehrerbietigsten und dankbarsten Gesinnungen zu seyn
Ew. Excellenz
gehorsamster
AWvSchlegeIchl.
[23]
[24]
Ich vergaß Ew. Excellenz für die Anfrage bey Herrn Niebuhr meinen Dank zu sagen. Ich vermuthe, in der Propaganda wird sich mehr finden, denn schwerlich hätte man doch wohl unternommen, auch nur eine Probe von Devanagari-Schrift im Druck zu liefern, wenn man nicht Muster vor Augen gehabt hätte. Freilich ist sie sehr schlecht ausgefallen.
Remusats chinesische Grammatik ist mir mit größtem Lobe angekündigt worden. Er hat sie mir zugesendet, aber sie ist noch unterwegs.
Von der Asiatischen Gesellschaft in Paris, einer Privat-Association, werden Ew. Excellenz wohl in den Zeitungen gelesen [haben]. Sie giebt eine Zeitschrift heraus, wovon ich die erste Nummer erwarte. Firmin Didot hat unternommen Devanagari-Schrift zu verfertigen. Der Graf Lasteyrie hatte immer die Lithographie im Kopfe, und mein Freund Fauriel hatte Muster zu einigen Proben geliefert: ich suchte es diesem aber auszureden, und wie es scheint, hat man den Gedanken gänzlich fahren lassen. Die Lithographischen Blätter von Othmar Frank sind ein warnendes Beyspiel.
Bonn den 4ten Junius 1822.