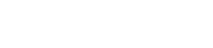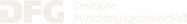So ist es denn wahr, mein liebster Freund? Sie haben uns recht glücklich und froh gemacht. Ihren Freunden blieb bisher kein ander Mittel übrig, als nur an Sie allein, nicht an Ihre Zukunft zu denken, und Sie hatten uns auch oft alle Sorge verbeten. Ich nahm das selbst so an ‒ gegen die, die uns lieb sind, ist man so leicht gelehrig und gehorsam. Nie habe ich Sie gefragt, wie wird sich der Knoten lösen? kann das so bleiben? Kaum habe ich mich selbst gefragt. Ich war ruhig im Glauben ‒ denn ich habe doch am Ende mehr Glauben als Ihr alle ‒ nicht daß es gerade so kommen würde, oder daß sich an irgendeiner Brust die Spannung brechen müßte, und das Himmlische mit dem Irdischen vermählen. Was Sie Scheidung zwischen beiden nennen, ist doch Verschmelzung. Warum soll es nicht? Ist das Irdische nicht auch wahrhaft himmlisch? Nennen Sie es aber, wie Sie wollen, genug, Sie sind glücklich. Ihr Brief ist eigentlich voll Wonne, und wie auf Flügeln zu mir gekommen. ‒ Ich freue mich jetzt ‒ wie Sie sich freuen werden ‒ daran zu denken, wie dies so sich machen mußte. Nur in dieser fast öden Einsamkeit, durch das Band der süßen Gewohnheit konnten Sie allmählich gewonnen werden. Wie weise und artig setzten Sie uns einmal auseinander, daß dies alles keine Gefahr habe. Gefahr nicht, aber Folgen doch. Soll das Liebenswürdige umsonst sein? Wie doppelt leid tut es mir, Julien nicht gesehen zu haben. Es war meine Schuld nicht, die Ihrige auch wohl nicht. ‒ Sehn Sie, liebster Hardenberg, das könnte mich doch traurig machen, wenn Sie nicht unser blieben, wenn Ihre Frau nicht unsre Freundin durch sich selber würde, aus eigner Neigung. Kommen Sie nur, wir schwatzen mehr darüber. Es ist fast wahrscheinlich, daß Sie um Ostern uns hier finden und wir erst um Pfingsten reisen.
Charlotten haben Sie gewiß aufs Leben verboten, uns nichts zu sagen, denn ich errate nun, sie hat es um Weihnachten erfahren, aber geschwiegen über alle Maßen. Sie schreibt mir eben, daß sie Charpentier und Sie zusammen hofft bei sich zu sehn. Ein Glück, daß sie nicht gern schreibt; gesagt hätte sie mirs doch. Friedrich verrät auch eine Ahndung ‒ ich habe ihm Gewißheit gegeben.
Sehr möglich, daß ein Dach uns alle noch in diesem Jahr versammelt. Friedrich bleibt den Sommer in Berlin, was mir lieb ist. Im Winter wünscht er herzukommen. Sie leben in Weißenfels. Sie könnten wohl auch einmal eine Zeitlang hier leben. ‒ Mit Ihrem Vater ist wohl alles überlegt und es stehn Ihnen keine Schwierigkeiten im Wege? Er wird nur froh sein, Sie froh zu wissen. Muß sich Thielmann nicht unendlich freuen! Ihren andern Schwager abandonnieren wir Fichten.
Es ist kein Zweifel, wenn Fichte sich ganz von R[einhard]s Mitwirkung überzeugen könnte, so würd er ihn zum zweiten Götz machen. Er will’s noch nicht glauben, oder vielmehr, er wünscht Tatsachen, um den Glauben in der Hand zu haben. Mit der letzten Post hat er R. selbst geschrieben, ihm seine Schrift geschickt und ihn zum Wehe über das Pfaffentum aufgefordert. Er will abwarten, was er darauf erwidert. Schreiben Sie mir nur, ob Sie es gewiß wissen. Ich zweifle nicht einen Augenblick daran, aber schwerlich hat er doch offen genug gehandelt, daß man Tatsachen von ihm anführen könnte. Fichten ist sehr daran gelegen übrigens. Ich habe ihm den größten Teil Ihres Briefes mitgeteilt ‒ ja, weil er Sie so liebt ‒ auch das, was Sie angeht und worüber er sich innig gefreut hat. ‒ Daß man in Preußen honett verfahren ist, werden Sie nun wissen.
Bald, bald kommt das 3. Stück „Athenäum“. Hier ist indessen etwas andres. Was werden Sie zu dieser „Lucinde“ sagen? Uns ist das Fragment im „Lyzeum“ eingefallen, das sich so anfängt: „Sapphische Gedichte müssen wachsen oder gefunden werden.“ Lesen Sie es nach. ‒ Ich halte noch zur Zeit diesen Roman nicht mehr für einen Roman als Jean Pauls Sachen ‒ mit denen ich es übrigens nicht vergleiche. – Es ist weit phantastischer, als wir uns eingebildet haben. Sagen Sie mir nun, wie es Ihnen zusagt. Rein ist der Eindruck freilich nicht, wenn man einem Verfasser so nahe steht. Ich halte immer seine verschlossene Persönlichkeit mit dieser Unbändigkeit zusammen und sehe, wie die harte Schale aufbricht ‒ mir kann ganz bange dabei werden, und wenn ich seine Geliebte wäre, so hätte es nicht gedruckt werden dürfen. Dies alles ist indes keine Verdammnis. Es gibt Dinge, die nicht zu verdammen, nicht zu tadeln, nicht wegzuwünschen, nicht zu ändern sind, und was Friedrich tut, gehört gemeiniglich dahin.
Wilhelm hat die Elegie geendigt. Eine Abschrift hat Goethe, der hier ist, die andre Friedrich. Sie müssen also warten. Der eigentliche Körper des Gedichts ist didaktisch zu nennen und sollte es auch sein nach W[ilhelm]s Meinung. Die Ausmalung des Einzelnen ist vortrefflich ‒ das Ganze vielleicht zu umfassend, um als Eins in die Seele aufgenommen zu werden, wenigstens erfordert dies eine gesammelte Stimmung. Sie sollen es hier lesen. Es kommt in das 4. Stück.
Wenn Sie herkommen, so treten Sie doch gleich bei uns ab, wenn Sie keine Ursach weiter haben es nicht zu tun. An Ihrem Verkehr mit Schiller hindert es Sie ganz und gar nicht. In der Mitte des April kommt der vollständige „Wallenstein“ auf das Theater. Wollen Sie ihn nicht sehn?
Goethe ist sehr mit Optik für die „Propyläen“ beschäftigt und an keinem öffentlichen Ort sichtbar.
Leben Sie wohl, Bester, ich muß noch an Charlotten schreiben.
Julie ist uns gegrüßt!
Teilen Sie Charlotten die „Lucinde“ mit.
[Nachschrift von A. W. Schlegel:]
Nur mit einem Worte wenigstens muß ich meine herzlichste brüderlichste Freude über das bezeugen, was Sie Karol[inen] geschrieben haben. Ich freue mich nun doppelt der Hoffnung Sie wiederzusehen. Es ist ein Grund mehr, die Berliner Reise später in den Frühling hinein zu verlegen, was wahrscheinlich die dortigen theatral[ischen] Angelegenheiten ratsam machen werden. Die Elegie habe ich eben von Goethe wiederbekommen, allein Sie müssen sich gedulden. Im 3. Stück „Athenäum“ ist Ihnen leider nichts mehr neu ‒ im 4. sollen Sie womöglich überrascht werden.