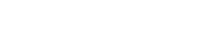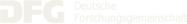Notice (8): Undefined offset: 0 [APP/View/Letters/view.ctp, line 329]
Code Context
/version-01-20/letters/view/3164" data-language=""></ul></div><div id="zoomImage" style="height:695px" class="open-sea-dragon" data-src="<?php echo $this->Html->url($dzi_imagesHand[0]) ?>" data-language="<?=$this->Session->read('Config.language')?>"></div>
$viewFile = '/var/www/awschlegel/version-01-20/app/View/Letters/view.ctp' $dataForView = array( 'html' => 'Bonn den 20sten Junius 1824.<br>Ew. Excellenz bitte ich, die verspätete Beantwortung Ihres so belehrenden und aufmunternden Schreibens vom 15ten April gütigst zu entschuldigen. Ich gebe diesen Sommer Vorlesungen, die mir viel Zeit kosten, und mich auch in meinen Brahmanischen Studien nicht so viel thun lassen, als ich wohl wünschte.<br>Die Nachricht von einem Augenübel, das Ew. Excellenz erlitten, hat meine lebhafteste Theilnahme erregt. Ich hoffe und wünsche von ganzem Herzen, daß Sie vollkommen und dauerhaft hergestellt seyn mögen. Zu meiner Freude bestätigt ein Zeitungsartikel diese Hoffnung. Es wird aus Berlin gemeldet, daß Ew. Excellenz sich viel mit den neuerworbenen Papyrus-Rollen beschäftigen, und dazu gehören doch gewiß ganz gesunde Augen.<br>Die meinigen leisten mir immer gute Dienste, wiewohl sie nun schon Veteranen der Manuscripte sind. Nur bei meinem letzten Aufenthalt in Paris litt ich an einem Augenübel. Mein Zustand wurde ängstlich, ich wandte mich an einen berühmten Oculisten, kam aber, wie es zu gehen pflegt, aus dem Regen in die Traufe. Er schrieb mir Einspritzungen durch den Thränenpunkt vor, eine äußerst peinliche Operation, die ich länger als einen Monat ertragen habe. Als ich zurückkam misbilligte mein vortrefflicher Freund von Walther diese Behandlung höchlich, und wünschte mir Glück, daß mir kein unheilbarer Schaden daraus erwachsen sei. Er versprach mir ein Augenwasser, vergaß es aber, und ich mahnte ihn darum in einigen Lateinischen Versen, die ich beilege. Völlig genesen kann Ew. Excellenz dieser Scherz, die Klage eines Leidensgenossen, vielleicht einige Augenblicke unterhalten.<br>Ich bitte recht sehr, die Exemplare von dem letzten Hefte der Indischen Bibliothek doch ja nicht zu schonen. Wir haben deren in Vorrath, und ich weiß keinen besseren Gebrauch dafür. Gerade dieser Theil der mir geschenkten Abhandlung muß für die Hellenisten besonders interessant seyn. Herr Welcker war erstaunt über die vertraute Bekanntschaft mit den Griechischen Grammatikern, welche sich darin kund giebt. Den Berliner Philologen habe ich Exemplare geschickt, auch einigen andern. Aber es stehen immer noch mehrere zu Befehl.<br>Leider ist noch kein neues Heft unter der Presse, wie es nach meinem guten Willen längst schon seyn sollte. Wenn ich einmal beim Schreiben bin, so macht es mir großes Vergnügen, aber es geht langsam, und das Anfangen fodert immer einen großen Entschluß. Ich habe allerlei kleine Aufsätze im Sinn.<br>Ew. Excellenz Vorschlag wegen des Bhagavad Gita erfodert reifliche Erwägung. Wenn ich nur das Glück haben könnte, mich mit Ihnen darüber zu besprechen, so würde ich es vielleicht besser anzugreifen wissen.<br>Ich bin sehr erfreut, Ihren Namen auf meiner Subscribentenliste für den Râmâyana zu haben. Es geht mit der Subscription doch einigermaßen vorwärts, und meine Wünsche und Foderungen sind mäßig. Doch brauche ich wenigstens 120 Subscribenten, um die Kosten zu decken. Es haben sich noch neue Hülfsmittel gefunden. Ein so eben aus Indien zurückgekommener Englischer Militär, der mir auch ein paar Handschriften zum Geschenke gesendet, wiewohl ich ihn nicht persönlich kenne, vertraut meinem Schüler ein sehr seltnes Manuscript des Râmâyana zur Benutzung an. Dieses, zum Theil beträchtlich alt, mit Bildern verziert, hat dem Fürsten von Odeypore (Udayapura) gehört. Es schreibt sich demnach aus der Raj-putana her, einem Lande, woher wir überhaupt noch wenig Handschriften haben. Ich besitze nun schon eine große Anzahl von Varianten des ersten Buches, und glaube in der Geschichte des Textes schon einigermaßen Licht zu sehen. Freilich wird es nöthig seyn, zuweilen das Geschäft des Diaskeuasten mit dem des Kritikers zu verbinden, aber ich hoffe dabei möglichst alle Willkühr zu vermeiden.<br><br><span class="weight-bold ">den 26sten Junius</span>. So geht es mir: diesen vor sechs Tagen angefangenen unbedeutenden Brief habe ich unter mancherlei Störungen immer noch nicht beendigen können. Gestern empfing ich nun Ew. Excellenz Sendung vom 24sten Mai. Ich bemerke ausdrücklich, daß sie einen vollen Monat unterwegs gewesen: denn wäre sie mir so schnell zugekommen, als wir das meiste aus Berlin zu erhalten pflegen, so wäre die lange Versäumniß meiner besten Danksagungen unverzeihlich. Ich habe die Abhandlung sogleich gelesen, aber eine erste Lesung ist wenig für eine so durchdachte Schrift. Der wesentliche Unterschied der Sprachen scheint mir vortrefflich auseinandergesetzt zu seyn. Die Ursprünglichkeit der Flexionen ist freilich der Punkt, über den wir nicht ganz einverstanden sind. Ich möchte beinahe sagen: um so besser! Dieß fodert zu neuer Prüfung auf. Bei so disputabeln Gegenständen muß man auf Widerspruch gefaßt seyn, und wie könnte ich mir einen bessern Gegner wünschen? Ich hatte schon früher den Gedanken, Ew. Excellenz um Erlaubniß zu bitten, einen Brief oder eine Reihe von Briefen über diese Gegenstände an Sie richten und in die Indische Bibliothek einrücken zu dürfen. Vielleicht gäbe dieß dann Ew. Excellenz Veranlassung, mir eine Antwort als neuen Beitrag zu schenken. Nicht alle Sätze meines Bruders möchte ich behaupten, wiewohl seine Forschungen mir die erste Anregung gegeben haben. Meine Ansichten entwickelten sich zuerst bei dem Studium der Geschichte unsrer Sprache vom Gothischen an, und der Entstehungsweise der Romanischen Sprachen; dann kam das Sanskrit hinzu. Ich habe sie bisher immer nur beiläufig zu berühren Gelegenheit gehabt: in der Schrift über das Provenzalische, und neuerdings wieder in der Indischen Bibliothek. Freilich stehe ich dadurch sehr im Nachtheil, daß meine Kenntniß auf eine einzige Familie von Sprachen beschränkt ist; und so gern ich auch das Solonische:<br><span class="slant-italic ">γηράσκω δʼ αἰεὶ πολλὰ διδασκόμενος</span>,<br>zu meinem Wahlspruch mache, so fand ich doch immer noch keine Muße, um das Hebräische wieder anzufrischen, und wenigstens die Anfangsgründe des Arabischen zu erlernen. <br>Ew. Excellenz Bemerkung über meine Übersetzung des Bh. G. II, 70 ist vollkommen gegründet. Ich weiß nicht, wo ich die Augen gehabt haben muß, da ich ein langes <span class="slant-italic ">a</span> für ein kurzes nahm, wiewohl ich es richtig abgedruckt, und auch in meiner Abschrift von diesem Capitel des Commentars kein Versehen gemacht hatte. Die Übersetzung des <span class="slant-italic ">achalapratiṣṭhaṃ</span> muß ich aber in Schutz nehmen, vermöge einer besseren Auctorität als die meinige ist. Sie drückt wörtlich die Erklärung des Srîdharaswâmin aus: <span class="slant-italic ">anatikrāntamaryādaṃ</span>. Ich lege die ganze Stelle des Commentars zu <span class="slant-italic ">sl</span>. 70 auf einem besondern Blatte bei. Die Übersetzung wäre nun etwa so zu berichtigen: <span class="slant-italic ">Continuo sese explenti, nec tamen ultra terminos suos redundanti Oceano etc</span>. Ich bitte Ew. Excellenz, mir doch ja alle Fehler, die Sie bemerken, anzuzeigen. Mit Herrn Bopp’s Beurtheilung in den Göttingischen Anzeigen habe ich Ursache sehr zufrieden zu seyn; nur kann ich ihm schwerlich zugeben, daß in dem Hemistichium <span class="slant-italic ">sukhaṃduḥ</span> <span class="slant-italic ">swaṃbhawō bhāwō</span> vor dem letzten Worte ein <span class="slant-italic ">a privativum</span> ausgefallen, und daß die beiden letzten Wörter als für sich bestehende Begriffe einander entgegengesetzt seyen. Dieß scheint mir die verschiedene Quantität nicht zu erlauben.<br>So eben empfange ich zu meiner großen Freude Herrn Bopps Episoden aus dem Maha Bharata. Der Berliner Guß ist ja recht schön ausgefallen. Dieß ist nun also der zweite Sanskrit-Text, den wir Deutsche binnen Jahresfrist ans Licht fördern. In England sind zwischen dem Hitôpadêsa und dem jetzt zur Erscheinung bald fertigen Gesetzbuch des Manus 14 Jahre verflossen.<br>Nächst dem Râmâyana ist mein Absehen immer noch auf den Hitôpadêsa gerichtet. Nur fehlt es in Europa leider gar sehr an Manuscripten. Der Baron Schilling von Canstadt aus St. Petersburg besitzt eins aus der Verlassenschaft eines Russen, der schon einmal eine Sanskrit-Grammatik geschrieben. Er brachte im vorigen Herbst einige Tage bei mir zu, versprach mir den Gebrauch des Manuscripts für die Folge, nahm es aber nach Paris mit. Nun ist er, wie ich höre, nach Rom gereist, ohne Zweifel wegen der tibetanischen Handschriften in der Propaganda.<br>Sehr hübsch wäre es, wenn man die artigen Mährchenbücher vom Papagei, von den dreißig Statuen am Thron des Vikramâdityas u. s. w. ans Licht stellen könnte. Aber die Handschriften, bei solchen Unterhaltungsbüchern unwissenden Abschreibern anheim gefallen, scheinen in einem heillosen Zustande zu seyn. Ich gedenke nächstens den Satz auszuführen, daß alle eigentlichen Feenmährchen aus Indien herkommen, und daß die Perser (vielleicht schon von der Zeit der Sassaniden her) nichts erfunden, sondern nur manirirte Übertragungen geliefert haben.<br>Ich bitte Ew. Excellenz, mich meine Langsamkeit im Briefschreiben nicht entgelten zu lassen, und bin mit der aufrichtigsten Verehrung und unveränderlich ergebenen Gesinnungen<br>Ew. Excellenz<br>gehorsamster<br>AWvSchlegel.<br><br>Ew. Excellenz haben mich sehr angenehm überrascht durch die günstige Erwähnung meines Calderon, eines ehemaligen Lieblingsdichters, den ich seit langer Zeit so ganz aus den Augen verlor, daß ich nicht einmal die Übersetzungen meiner Nachfolger, der Herren Gries und von Malsburg gelesen. Das Publicum scheint der Meynung zu seyn, daß sie es wenigstens eben so gut machen wie ich, wogegen ich auch nicht viel einzuwenden habe. Nur hat mir bei einem flüchtigen Anblick [geschienen], es fehle dann und wann an Klarheit. Ein gewisser <span class="slant-italic ">Culteranismo</span> im Stil des Calderon ist nicht abzuläugnen; dieß muß freilich ausgedrückt werden, wenn das Bild ähnlich seyn soll. Will man es aber zu ängstlich nachbilden, so entsteht leicht ein völliger Galimathias daraus.<br><br><span class="slant-italic ">Ad. V. Cl. Philippum a Walther.<br>Te vates medicum poscit collyria lippus.<br>Phoebus amat vates; is pater est medicis.<br>Te genitor flectat, flectant communia sacra:<br>Si vis, e lippo Lyncea me efficies.<br>Demodocus, Thamyris, caecus fuit ipse et Homerus;<br>Non tanti est laurus: carmina iam valeant.<br>Sed veterum ad seras evolvere scripta lucernas,<br>Et dictis sapientum invigilare iuvat.<br>Tunc mihi ne doleant lacrimantia lumina, cura: <br>Pro vate haud renuent munera Pierides.</span>', 'isaprint' => true, 'isnewtranslation' => false, 'statemsg' => 'betamsg15', 'cittitle' => '', 'description' => 'August Wilhelm von Schlegel an Wilhelm von Humboldt am 20.06.1824 bis 26.06.1824, Bonn', 'adressatort' => 'Unknown', 'absendeort' => 'Bonn <a class="gndmetadata" target="_blank" href="http://d-nb.info/gnd/1001909-1">GND</a>', 'date' => '20.06.1824 bis 26.06.1824', 'adressat' => array( (int) 2949 => array( 'ID' => '2949', 'project' => '1', 'timecreate' => '2013-10-17 13:02:22', 'timelastchg' => '2018-01-11 15:52:48', 'key' => 'AWS-ap-00av', 'docTyp' => array( [maximum depth reached] ), '39_name' => 'Humboldt, Wilhelm von', '39_geschlecht' => 'm', '39_gebdatum' => '1767-06-22', '39_toddatum' => '1835-04-08', '39_pdb' => 'GND', '39_dbid' => '118554727', '39_quellen' => 'NDB@https://www.deutsche-biographie.de/gnd118554727.html#ndbcontent@ ADB@https://www.deutsche-biographie.de/gnd118554727.html#adbcontent@ WBIS@http://db.saur.de/WBIS/basicSearch.jsf@J023-835-2@ Wikipedia@https://de.wikipedia.org/wiki/Wilhelm_von_Humboldt@', '39_geburtsort' => array( [maximum depth reached] ), '39_sterbeort' => array( [maximum depth reached] ), '39_lebenwirken' => 'Politiker, Sprachforscher, Publizist, Philosoph Wilhelm von Humboldt wuchs auf Schloss Tegel auf, dem Familienbesitz der Humboldts. Ab 1787 studierte Wilhelm zusammen mit seinem Bruder Alexander an der Universität in Frankfurt (Oder) Rechtswissenschaften. Ein Jahr später wechselte er an die Universität Göttingen, wo er den gleichfalls dort studierenden AWS kennenlernte. 1789 führte ihn eine Reise in das revolutionäre Paris. Anfang 1790 trat er nach Beendigung des Studiums in den Staatsdienst und erhielt eine Anstellung im Justizdepartement. 1791 heiratete er Caroline von Dacheröden, die Tochter eines preußischen Kammergerichtsrates. Im selben Jahr schied er aus dem Staatsdienst aus, um auf den Gütern der Familie von Dacheröden seine Studien der altgriechischen Sprache, Kultur, Kunst und Philosophie fortzusetzen. 1794 zog er nach Jena. Humboldt fungierte als konstruktiver Kritiker und gelehrter Ratgeber für die Protagonisten der Weimarer Klassik. Ab November 1797 lebte er in Paris, um seine Studien fortzuführen. Ausgiebige Reisen nach Spanien dienten auch der Erforschung der baskischen Kultur und Sprache. Von 1802 bis 1808 agierte Humboldt als preußischer Gesandter beim Heiligen Stuhl in Rom. Mit der Aufgabe der konsularischen Vertretung war Humboldt zeitlich nicht überfordert, so dass er genug Gelegenheit hatte, seine Studien weiter zu betreiben und sein Domizil zu einem gesellschaftlichen Mittelpunkt zu machen. 1809 wurde er Sektionschef für Kultus und Unterricht im Ministerium des Innern in Berlin. Humboldt galt als liberaler Bildungsreformer. Zu seinen Leistungen gehören ein neu gegliedertes Bildungssystem, das allen Schichten die Möglichkeit des Zugangs zu Bildung zusichern sollte, und die Vereinheitlichung der Abschlussprüfungen. Als weiterer Meilenstein kann Humboldts Beteiligung bei der Gründung der Universität Berlin gelten; zahlreiche renommierte Wissenschaftler konnten für die Lehrstühle gewonnen werden. Die Eröffnung der Universität im Oktober 1810 fand allerdings ohne Humboldt statt. Nach Auseinandersetzungen verließ er den Bildungssektor und ging als preußischer Gesandter nach Wien, später nach London. In dieser Funktion war er am Wiener Kongress beteiligt. 1819 schied er aus dem Staatsdienst aus und beschäftigte sich weiter mit sprachwissenschaftlichen Forschungen, darunter auch dem Sanskrit und dem Kâwi, der Sprache der indonesischen Insel Java. Wilhelms Bruder Alexander von Humboldt war ein bedeutender Naturforscher, die Brüder Humboldt gelten als die „preußischen Dioskuren“.', '39_namevar' => 'Humboldt, Friedrich Wilhelm Christian Karl Ferdinand von Humboldt, Carl W. von Humboldt, Wilhelm F. von Humboldt, Guillaume de Humboldt, Karl W. von Humboldt, Carl Wilhelm von Humboldt, G. de', '39_beziehung' => 'AWS kannte Wilhelm von Humboldt schon aus Göttinger Studentenzeiten, in Jena begegneten sie sich wieder. Schlegel war 1805 Gast Humboldts in Rom, zur Zeit von dessen preußischer Gesandtschaft. Humboldt und AWS korrespondierten auch über ihre sprachwissenschaftlichen Studien, von großer Kenntnis Humboldts zeugen die ausführlichen brieflichen Diskussionen über das Sanskrit. Humboldt steuerte Aufsätze zu Schlegels „Indischer Bibliothek“ bei. Beide Gelehrte begegneten sich mit großem Respekt, auch wenn sie nicht in allen fachlichen Überzeugungen übereinstimmten.', '39_status_person' => 'Vollständig', '39_sourcename0' => 'AWS-ap-00av-0.jpg', 'folders' => array( [maximum depth reached] ), '_label' => '', '_descr' => '', '_model' => 'Person', '_model_title' => 'Person', '_model_titles' => 'People', '_url' => '' ) ), 'adrCitation' => 'Wilhelm von Humboldt', 'absender' => array(), 'absCitation' => 'August Wilhelm von Schlegel', 'percount' => (int) 1, 'notabs' => false, 'tabs' => array( 'text' => array( 'content' => 'Volltext Druck', 'exists' => '1' ), 'druck' => array( 'exists' => '1', 'content' => 'Digitalisat Druck' ) ), 'parallelview' => array( (int) 0 => '1', (int) 1 => '1' ), 'dzi_imagesHand' => array(), 'dzi_imagesDruck' => array( (int) 0 => '/cake_fud/files/temp/images/dzi/AWS-aw-0230-0.jpg.xml', (int) 1 => '/cake_fud/files/temp/images/dzi/AWS-aw-0230-1.jpg.xml', (int) 2 => '/cake_fud/files/temp/images/dzi/AWS-aw-0230-2.jpg.xml', (int) 3 => '/cake_fud/files/temp/images/dzi/AWS-aw-0230-3.jpg.xml', (int) 4 => '/cake_fud/files/temp/images/dzi/AWS-aw-0230-4.jpg.xml', (int) 5 => '/cake_fud/files/temp/images/dzi/AWS-aw-0230-5.jpg.xml', (int) 6 => '/cake_fud/files/temp/images/dzi/AWS-aw-0230-6.jpg.xml' ), 'indexesintext' => array(), 'right' => '', 'left' => 'text', 'handschrift' => array(), 'druck' => array( 'Bibliographische Angabe' => 'Briefwechsel zwischen Wilhelm von Humboldt und August Wilhelm Schlegel. Hg. v. Albert Leitzmann. Halle 1908, S. 170‒176.', 'Incipit' => '„Bonn den 20sten Junius 1824.<br>Ew. Excellenz bitte ich, die verspätete Beantwortung Ihres so belehrenden und aufmunternden Schreibens vom 15ten April gütigst [...]“' ), 'docmain' => array( 'ID' => '3164', 'project' => '1', 'timecreate' => '2013-11-12 08:42:32', 'timelastchg' => '2019-10-11 12:48:12', 'key' => 'AWS-aw-0230', 'docTyp' => array( 'name' => 'Brief', 'id' => '36' ), '36_html' => 'Bonn den 20sten Junius 1824.<br>Ew. Excellenz bitte ich, die verspätete Beantwortung Ihres so belehrenden und aufmunternden Schreibens vom 15ten April gütigst zu entschuldigen. Ich gebe diesen Sommer Vorlesungen, die mir viel Zeit kosten, und mich auch in meinen Brahmanischen Studien nicht so viel thun lassen, als ich wohl wünschte.<br>Die Nachricht von einem Augenübel, das Ew. Excellenz erlitten, hat meine lebhafteste Theilnahme erregt. Ich hoffe und wünsche von ganzem Herzen, daß Sie vollkommen und dauerhaft hergestellt seyn mögen. Zu meiner Freude bestätigt ein Zeitungsartikel diese Hoffnung. Es wird aus Berlin gemeldet, daß Ew. Excellenz sich viel mit den neuerworbenen Papyrus-Rollen beschäftigen, und dazu gehören doch gewiß ganz gesunde Augen.<br>Die meinigen leisten mir immer gute Dienste, wiewohl sie nun schon Veteranen der Manuscripte sind. Nur bei meinem letzten Aufenthalt in Paris litt ich an einem Augenübel. Mein Zustand wurde ängstlich, ich wandte mich an einen berühmten Oculisten, kam aber, wie es zu gehen pflegt, aus dem Regen in die Traufe. Er schrieb mir Einspritzungen durch den Thränenpunkt vor, eine äußerst peinliche Operation, die ich länger als einen Monat ertragen habe. Als ich zurückkam misbilligte mein vortrefflicher Freund von Walther diese Behandlung höchlich, und wünschte mir Glück, daß mir kein unheilbarer Schaden daraus erwachsen sei. Er versprach mir ein Augenwasser, vergaß es aber, und ich mahnte ihn darum in einigen Lateinischen Versen, die ich beilege. Völlig genesen kann Ew. Excellenz dieser Scherz, die Klage eines Leidensgenossen, vielleicht einige Augenblicke unterhalten.<br>Ich bitte recht sehr, die Exemplare von dem letzten Hefte der Indischen Bibliothek doch ja nicht zu schonen. Wir haben deren in Vorrath, und ich weiß keinen besseren Gebrauch dafür. Gerade dieser Theil der mir geschenkten Abhandlung muß für die Hellenisten besonders interessant seyn. Herr Welcker war erstaunt über die vertraute Bekanntschaft mit den Griechischen Grammatikern, welche sich darin kund giebt. Den Berliner Philologen habe ich Exemplare geschickt, auch einigen andern. Aber es stehen immer noch mehrere zu Befehl.<br>Leider ist noch kein neues Heft unter der Presse, wie es nach meinem guten Willen längst schon seyn sollte. Wenn ich einmal beim Schreiben bin, so macht es mir großes Vergnügen, aber es geht langsam, und das Anfangen fodert immer einen großen Entschluß. Ich habe allerlei kleine Aufsätze im Sinn.<br>Ew. Excellenz Vorschlag wegen des Bhagavad Gita erfodert reifliche Erwägung. Wenn ich nur das Glück haben könnte, mich mit Ihnen darüber zu besprechen, so würde ich es vielleicht besser anzugreifen wissen.<br>Ich bin sehr erfreut, Ihren Namen auf meiner Subscribentenliste für den Râmâyana zu haben. Es geht mit der Subscription doch einigermaßen vorwärts, und meine Wünsche und Foderungen sind mäßig. Doch brauche ich wenigstens 120 Subscribenten, um die Kosten zu decken. Es haben sich noch neue Hülfsmittel gefunden. Ein so eben aus Indien zurückgekommener Englischer Militär, der mir auch ein paar Handschriften zum Geschenke gesendet, wiewohl ich ihn nicht persönlich kenne, vertraut meinem Schüler ein sehr seltnes Manuscript des Râmâyana zur Benutzung an. Dieses, zum Theil beträchtlich alt, mit Bildern verziert, hat dem Fürsten von Odeypore (Udayapura) gehört. Es schreibt sich demnach aus der Raj-putana her, einem Lande, woher wir überhaupt noch wenig Handschriften haben. Ich besitze nun schon eine große Anzahl von Varianten des ersten Buches, und glaube in der Geschichte des Textes schon einigermaßen Licht zu sehen. Freilich wird es nöthig seyn, zuweilen das Geschäft des Diaskeuasten mit dem des Kritikers zu verbinden, aber ich hoffe dabei möglichst alle Willkühr zu vermeiden.<br><br><span class="weight-bold ">den 26sten Junius</span>. So geht es mir: diesen vor sechs Tagen angefangenen unbedeutenden Brief habe ich unter mancherlei Störungen immer noch nicht beendigen können. Gestern empfing ich nun Ew. Excellenz Sendung vom 24sten Mai. Ich bemerke ausdrücklich, daß sie einen vollen Monat unterwegs gewesen: denn wäre sie mir so schnell zugekommen, als wir das meiste aus Berlin zu erhalten pflegen, so wäre die lange Versäumniß meiner besten Danksagungen unverzeihlich. Ich habe die Abhandlung sogleich gelesen, aber eine erste Lesung ist wenig für eine so durchdachte Schrift. Der wesentliche Unterschied der Sprachen scheint mir vortrefflich auseinandergesetzt zu seyn. Die Ursprünglichkeit der Flexionen ist freilich der Punkt, über den wir nicht ganz einverstanden sind. Ich möchte beinahe sagen: um so besser! Dieß fodert zu neuer Prüfung auf. Bei so disputabeln Gegenständen muß man auf Widerspruch gefaßt seyn, und wie könnte ich mir einen bessern Gegner wünschen? Ich hatte schon früher den Gedanken, Ew. Excellenz um Erlaubniß zu bitten, einen Brief oder eine Reihe von Briefen über diese Gegenstände an Sie richten und in die Indische Bibliothek einrücken zu dürfen. Vielleicht gäbe dieß dann Ew. Excellenz Veranlassung, mir eine Antwort als neuen Beitrag zu schenken. Nicht alle Sätze meines Bruders möchte ich behaupten, wiewohl seine Forschungen mir die erste Anregung gegeben haben. Meine Ansichten entwickelten sich zuerst bei dem Studium der Geschichte unsrer Sprache vom Gothischen an, und der Entstehungsweise der Romanischen Sprachen; dann kam das Sanskrit hinzu. Ich habe sie bisher immer nur beiläufig zu berühren Gelegenheit gehabt: in der Schrift über das Provenzalische, und neuerdings wieder in der Indischen Bibliothek. Freilich stehe ich dadurch sehr im Nachtheil, daß meine Kenntniß auf eine einzige Familie von Sprachen beschränkt ist; und so gern ich auch das Solonische:<br><span class="slant-italic ">γηράσκω δʼ αἰεὶ πολλὰ διδασκόμενος</span>,<br>zu meinem Wahlspruch mache, so fand ich doch immer noch keine Muße, um das Hebräische wieder anzufrischen, und wenigstens die Anfangsgründe des Arabischen zu erlernen. <br>Ew. Excellenz Bemerkung über meine Übersetzung des Bh. G. II, 70 ist vollkommen gegründet. Ich weiß nicht, wo ich die Augen gehabt haben muß, da ich ein langes <span class="slant-italic ">a</span> für ein kurzes nahm, wiewohl ich es richtig abgedruckt, und auch in meiner Abschrift von diesem Capitel des Commentars kein Versehen gemacht hatte. Die Übersetzung des <span class="slant-italic ">achalapratiṣṭhaṃ</span> muß ich aber in Schutz nehmen, vermöge einer besseren Auctorität als die meinige ist. Sie drückt wörtlich die Erklärung des Srîdharaswâmin aus: <span class="slant-italic ">anatikrāntamaryādaṃ</span>. Ich lege die ganze Stelle des Commentars zu <span class="slant-italic ">sl</span>. 70 auf einem besondern Blatte bei. Die Übersetzung wäre nun etwa so zu berichtigen: <span class="slant-italic ">Continuo sese explenti, nec tamen ultra terminos suos redundanti Oceano etc</span>. Ich bitte Ew. Excellenz, mir doch ja alle Fehler, die Sie bemerken, anzuzeigen. Mit Herrn Bopp’s Beurtheilung in den Göttingischen Anzeigen habe ich Ursache sehr zufrieden zu seyn; nur kann ich ihm schwerlich zugeben, daß in dem Hemistichium <span class="slant-italic ">sukhaṃduḥ</span> <span class="slant-italic ">swaṃbhawō bhāwō</span> vor dem letzten Worte ein <span class="slant-italic ">a privativum</span> ausgefallen, und daß die beiden letzten Wörter als für sich bestehende Begriffe einander entgegengesetzt seyen. Dieß scheint mir die verschiedene Quantität nicht zu erlauben.<br>So eben empfange ich zu meiner großen Freude Herrn Bopps Episoden aus dem Maha Bharata. Der Berliner Guß ist ja recht schön ausgefallen. Dieß ist nun also der zweite Sanskrit-Text, den wir Deutsche binnen Jahresfrist ans Licht fördern. In England sind zwischen dem Hitôpadêsa und dem jetzt zur Erscheinung bald fertigen Gesetzbuch des Manus 14 Jahre verflossen.<br>Nächst dem Râmâyana ist mein Absehen immer noch auf den Hitôpadêsa gerichtet. Nur fehlt es in Europa leider gar sehr an Manuscripten. Der Baron Schilling von Canstadt aus St. Petersburg besitzt eins aus der Verlassenschaft eines Russen, der schon einmal eine Sanskrit-Grammatik geschrieben. Er brachte im vorigen Herbst einige Tage bei mir zu, versprach mir den Gebrauch des Manuscripts für die Folge, nahm es aber nach Paris mit. Nun ist er, wie ich höre, nach Rom gereist, ohne Zweifel wegen der tibetanischen Handschriften in der Propaganda.<br>Sehr hübsch wäre es, wenn man die artigen Mährchenbücher vom Papagei, von den dreißig Statuen am Thron des Vikramâdityas u. s. w. ans Licht stellen könnte. Aber die Handschriften, bei solchen Unterhaltungsbüchern unwissenden Abschreibern anheim gefallen, scheinen in einem heillosen Zustande zu seyn. Ich gedenke nächstens den Satz auszuführen, daß alle eigentlichen Feenmährchen aus Indien herkommen, und daß die Perser (vielleicht schon von der Zeit der Sassaniden her) nichts erfunden, sondern nur manirirte Übertragungen geliefert haben.<br>Ich bitte Ew. Excellenz, mich meine Langsamkeit im Briefschreiben nicht entgelten zu lassen, und bin mit der aufrichtigsten Verehrung und unveränderlich ergebenen Gesinnungen<br>Ew. Excellenz<br>gehorsamster<br>AWvSchlegel.<br><br>Ew. Excellenz haben mich sehr angenehm überrascht durch die günstige Erwähnung meines Calderon, eines ehemaligen Lieblingsdichters, den ich seit langer Zeit so ganz aus den Augen verlor, daß ich nicht einmal die Übersetzungen meiner Nachfolger, der Herren Gries und von Malsburg gelesen. Das Publicum scheint der Meynung zu seyn, daß sie es wenigstens eben so gut machen wie ich, wogegen ich auch nicht viel einzuwenden habe. Nur hat mir bei einem flüchtigen Anblick [geschienen], es fehle dann und wann an Klarheit. Ein gewisser <span class="slant-italic ">Culteranismo</span> im Stil des Calderon ist nicht abzuläugnen; dieß muß freilich ausgedrückt werden, wenn das Bild ähnlich seyn soll. Will man es aber zu ängstlich nachbilden, so entsteht leicht ein völliger Galimathias daraus.<br><br><span class="slant-italic ">Ad. V. Cl. Philippum a Walther.<br>Te vates medicum poscit collyria lippus.<br>Phoebus amat vates; is pater est medicis.<br>Te genitor flectat, flectant communia sacra:<br>Si vis, e lippo Lyncea me efficies.<br>Demodocus, Thamyris, caecus fuit ipse et Homerus;<br>Non tanti est laurus: carmina iam valeant.<br>Sed veterum ad seras evolvere scripta lucernas,<br>Et dictis sapientum invigilare iuvat.<br>Tunc mihi ne doleant lacrimantia lumina, cura: <br>Pro vate haud renuent munera Pierides.</span>', '36_xml' => '<p>Bonn den 20sten Junius 1824.<lb/>Ew. Excellenz bitte ich, die verspätete Beantwortung Ihres so belehrenden und aufmunternden Schreibens vom 15ten April gütigst zu entschuldigen. Ich gebe diesen Sommer Vorlesungen, die mir viel Zeit kosten, und mich auch in meinen Brahmanischen Studien nicht so viel thun lassen, als ich wohl wünschte.<lb/>Die Nachricht von einem Augenübel, das Ew. Excellenz erlitten, hat meine lebhafteste Theilnahme erregt. Ich hoffe und wünsche von ganzem Herzen, daß Sie vollkommen und dauerhaft hergestellt seyn mögen. Zu meiner Freude bestätigt ein Zeitungsartikel diese Hoffnung. Es wird aus Berlin gemeldet, daß Ew. Excellenz sich viel mit den neuerworbenen Papyrus-Rollen beschäftigen, und dazu gehören doch gewiß ganz gesunde Augen.<lb/>Die meinigen leisten mir immer gute Dienste, wiewohl sie nun schon Veteranen der Manuscripte sind. Nur bei meinem letzten Aufenthalt in Paris litt ich an einem Augenübel. Mein Zustand wurde ängstlich, ich wandte mich an einen berühmten Oculisten, kam aber, wie es zu gehen pflegt, aus dem Regen in die Traufe. Er schrieb mir Einspritzungen durch den Thränenpunkt vor, eine äußerst peinliche Operation, die ich länger als einen Monat ertragen habe. Als ich zurückkam misbilligte mein vortrefflicher Freund von Walther diese Behandlung höchlich, und wünschte mir Glück, daß mir kein unheilbarer Schaden daraus erwachsen sei. Er versprach mir ein Augenwasser, vergaß es aber, und ich mahnte ihn darum in einigen Lateinischen Versen, die ich beilege. Völlig genesen kann Ew. Excellenz dieser Scherz, die Klage eines Leidensgenossen, vielleicht einige Augenblicke unterhalten.<lb/>Ich bitte recht sehr, die Exemplare von dem letzten Hefte der Indischen Bibliothek doch ja nicht zu schonen. Wir haben deren in Vorrath, und ich weiß keinen besseren Gebrauch dafür. Gerade dieser Theil der mir geschenkten Abhandlung muß für die Hellenisten besonders interessant seyn. Herr Welcker war erstaunt über die vertraute Bekanntschaft mit den Griechischen Grammatikern, welche sich darin kund giebt. Den Berliner Philologen habe ich Exemplare geschickt, auch einigen andern. Aber es stehen immer noch mehrere zu Befehl.<lb/>Leider ist noch kein neues Heft unter der Presse, wie es nach meinem guten Willen längst schon seyn sollte. Wenn ich einmal beim Schreiben bin, so macht es mir großes Vergnügen, aber es geht langsam, und das Anfangen fodert immer einen großen Entschluß. Ich habe allerlei kleine Aufsätze im Sinn.<lb/>Ew. Excellenz Vorschlag wegen des Bhagavad Gita erfodert reifliche Erwägung. Wenn ich nur das Glück haben könnte, mich mit Ihnen darüber zu besprechen, so würde ich es vielleicht besser anzugreifen wissen.<lb/>Ich bin sehr erfreut, Ihren Namen auf meiner Subscribentenliste für den Râmâyana zu haben. Es geht mit der Subscription doch einigermaßen vorwärts, und meine Wünsche und Foderungen sind mäßig. Doch brauche ich wenigstens 120 Subscribenten, um die Kosten zu decken. Es haben sich noch neue Hülfsmittel gefunden. Ein so eben aus Indien zurückgekommener Englischer Militär, der mir auch ein paar Handschriften zum Geschenke gesendet, wiewohl ich ihn nicht persönlich kenne, vertraut meinem Schüler ein sehr seltnes Manuscript des Râmâyana zur Benutzung an. Dieses, zum Theil beträchtlich alt, mit Bildern verziert, hat dem Fürsten von Odeypore (Udayapura) gehört. Es schreibt sich demnach aus der Raj-putana her, einem Lande, woher wir überhaupt noch wenig Handschriften haben. Ich besitze nun schon eine große Anzahl von Varianten des ersten Buches, und glaube in der Geschichte des Textes schon einigermaßen Licht zu sehen. Freilich wird es nöthig seyn, zuweilen das Geschäft des Diaskeuasten mit dem des Kritikers zu verbinden, aber ich hoffe dabei möglichst alle Willkühr zu vermeiden.<lb/><lb/><hi rend="weight:bold">den 26sten Junius</hi>. So geht es mir: diesen vor sechs Tagen angefangenen unbedeutenden Brief habe ich unter mancherlei Störungen immer noch nicht beendigen können. Gestern empfing ich nun Ew. Excellenz Sendung vom 24sten Mai. Ich bemerke ausdrücklich, daß sie einen vollen Monat unterwegs gewesen: denn wäre sie mir so schnell zugekommen, als wir das meiste aus Berlin zu erhalten pflegen, so wäre die lange Versäumniß meiner besten Danksagungen unverzeihlich. Ich habe die Abhandlung sogleich gelesen, aber eine erste Lesung ist wenig für eine so durchdachte Schrift. Der wesentliche Unterschied der Sprachen scheint mir vortrefflich auseinandergesetzt zu seyn. Die Ursprünglichkeit der Flexionen ist freilich der Punkt, über den wir nicht ganz einverstanden sind. Ich möchte beinahe sagen: um so besser! Dieß fodert zu neuer Prüfung auf. Bei so disputabeln Gegenständen muß man auf Widerspruch gefaßt seyn, und wie könnte ich mir einen bessern Gegner wünschen? Ich hatte schon früher den Gedanken, Ew. Excellenz um Erlaubniß zu bitten, einen Brief oder eine Reihe von Briefen über diese Gegenstände an Sie richten und in die Indische Bibliothek einrücken zu dürfen. Vielleicht gäbe dieß dann Ew. Excellenz Veranlassung, mir eine Antwort als neuen Beitrag zu schenken. Nicht alle Sätze meines Bruders möchte ich behaupten, wiewohl seine Forschungen mir die erste Anregung gegeben haben. Meine Ansichten entwickelten sich zuerst bei dem Studium der Geschichte unsrer Sprache vom Gothischen an, und der Entstehungsweise der Romanischen Sprachen; dann kam das Sanskrit hinzu. Ich habe sie bisher immer nur beiläufig zu berühren Gelegenheit gehabt: in der Schrift über das Provenzalische, und neuerdings wieder in der Indischen Bibliothek. Freilich stehe ich dadurch sehr im Nachtheil, daß meine Kenntniß auf eine einzige Familie von Sprachen beschränkt ist; und so gern ich auch das Solonische:<lb/><hi rend="slant:italic">γηράσκω δʼ αἰεὶ πολλὰ διδασκόμενος</hi>,<lb/>zu meinem Wahlspruch mache, so fand ich doch immer noch keine Muße, um das Hebräische wieder anzufrischen, und wenigstens die Anfangsgründe des Arabischen zu erlernen. <lb/>Ew. Excellenz Bemerkung über meine Übersetzung des Bh. G. II, 70 ist vollkommen gegründet. Ich weiß nicht, wo ich die Augen gehabt haben muß, da ich ein langes <hi rend="slant:italic">a</hi> für ein kurzes nahm, wiewohl ich es richtig abgedruckt, und auch in meiner Abschrift von diesem Capitel des Commentars kein Versehen gemacht hatte. Die Übersetzung des <hi rend="slant:italic">achalapratiṣṭhaṃ</hi> muß ich aber in Schutz nehmen, vermöge einer besseren Auctorität als die meinige ist. Sie drückt wörtlich die Erklärung des Srîdharaswâmin aus: <hi rend="slant:italic">anatikrāntamaryādaṃ</hi>. Ich lege die ganze Stelle des Commentars zu <hi rend="slant:italic">sl</hi>. 70 auf einem besondern Blatte bei. Die Übersetzung wäre nun etwa so zu berichtigen: <hi rend="slant:italic">Continuo sese explenti, nec tamen ultra terminos suos redundanti Oceano etc</hi>. Ich bitte Ew. Excellenz, mir doch ja alle Fehler, die Sie bemerken, anzuzeigen. Mit Herrn Bopp’s Beurtheilung in den Göttingischen Anzeigen habe ich Ursache sehr zufrieden zu seyn; nur kann ich ihm schwerlich zugeben, daß in dem Hemistichium <hi rend="slant:italic">sukhaṃduḥ</hi> <hi rend="slant:italic">swaṃbhawō bhāwō</hi> vor dem letzten Worte ein <hi rend="slant:italic">a privativum</hi> ausgefallen, und daß die beiden letzten Wörter als für sich bestehende Begriffe einander entgegengesetzt seyen. Dieß scheint mir die verschiedene Quantität nicht zu erlauben.<lb/>So eben empfange ich zu meiner großen Freude Herrn Bopps Episoden aus dem Maha Bharata. Der Berliner Guß ist ja recht schön ausgefallen. Dieß ist nun also der zweite Sanskrit-Text, den wir Deutsche binnen Jahresfrist ans Licht fördern. In England sind zwischen dem Hitôpadêsa und dem jetzt zur Erscheinung bald fertigen Gesetzbuch des Manus 14 Jahre verflossen.<lb/>Nächst dem Râmâyana ist mein Absehen immer noch auf den Hitôpadêsa gerichtet. Nur fehlt es in Europa leider gar sehr an Manuscripten. Der Baron Schilling von Canstadt aus St. Petersburg besitzt eins aus der Verlassenschaft eines Russen, der schon einmal eine Sanskrit-Grammatik geschrieben. Er brachte im vorigen Herbst einige Tage bei mir zu, versprach mir den Gebrauch des Manuscripts für die Folge, nahm es aber nach Paris mit. Nun ist er, wie ich höre, nach Rom gereist, ohne Zweifel wegen der tibetanischen Handschriften in der Propaganda.<lb/>Sehr hübsch wäre es, wenn man die artigen Mährchenbücher vom Papagei, von den dreißig Statuen am Thron des Vikramâdityas u. s. w. ans Licht stellen könnte. Aber die Handschriften, bei solchen Unterhaltungsbüchern unwissenden Abschreibern anheim gefallen, scheinen in einem heillosen Zustande zu seyn. Ich gedenke nächstens den Satz auszuführen, daß alle eigentlichen Feenmährchen aus Indien herkommen, und daß die Perser (vielleicht schon von der Zeit der Sassaniden her) nichts erfunden, sondern nur manirirte Übertragungen geliefert haben.<lb/>Ich bitte Ew. Excellenz, mich meine Langsamkeit im Briefschreiben nicht entgelten zu lassen, und bin mit der aufrichtigsten Verehrung und unveränderlich ergebenen Gesinnungen<lb/>Ew. Excellenz<lb/>gehorsamster<lb/>AWvSchlegel.<lb/><lb/>Ew. Excellenz haben mich sehr angenehm überrascht durch die günstige Erwähnung meines Calderon, eines ehemaligen Lieblingsdichters, den ich seit langer Zeit so ganz aus den Augen verlor, daß ich nicht einmal die Übersetzungen meiner Nachfolger, der Herren Gries und von Malsburg gelesen. Das Publicum scheint der Meynung zu seyn, daß sie es wenigstens eben so gut machen wie ich, wogegen ich auch nicht viel einzuwenden habe. Nur hat mir bei einem flüchtigen Anblick [geschienen], es fehle dann und wann an Klarheit. Ein gewisser <hi rend="slant:italic">Culteranismo</hi> im Stil des Calderon ist nicht abzuläugnen; dieß muß freilich ausgedrückt werden, wenn das Bild ähnlich seyn soll. Will man es aber zu ängstlich nachbilden, so entsteht leicht ein völliger Galimathias daraus.<lb/><lb/><hi rend="slant:italic">Ad. V. Cl. Philippum a Walther.<lb/>Te vates medicum poscit collyria lippus.<lb/>Phoebus amat vates; is pater est medicis.<lb/>Te genitor flectat, flectant communia sacra:<lb/>Si vis, e lippo Lyncea me efficies.<lb/>Demodocus, Thamyris, caecus fuit ipse et Homerus;<lb/>Non tanti est laurus: carmina iam valeant.<lb/>Sed veterum ad seras evolvere scripta lucernas,<lb/>Et dictis sapientum invigilare iuvat.<lb/>Tunc mihi ne doleant lacrimantia lumina, cura: <lb/>Pro vate haud renuent munera Pierides.</hi></p>', '36_xml_standoff' => 'Bonn den 20sten Junius 1824.<lb/>Ew. Excellenz bitte ich, die verspätete Beantwortung Ihres so belehrenden und aufmunternden Schreibens vom 15ten April gütigst zu entschuldigen. Ich gebe diesen Sommer Vorlesungen, die mir viel Zeit kosten, und mich auch in meinen Brahmanischen Studien nicht so viel thun lassen, als ich wohl wünschte.<lb/>Die Nachricht von einem Augenübel, das Ew. Excellenz erlitten, hat meine lebhafteste Theilnahme erregt. Ich hoffe und wünsche von ganzem Herzen, daß Sie vollkommen und dauerhaft hergestellt seyn mögen. Zu meiner Freude bestätigt ein Zeitungsartikel diese Hoffnung. Es wird aus Berlin gemeldet, daß Ew. Excellenz sich viel mit den neuerworbenen Papyrus-Rollen beschäftigen, und dazu gehören doch gewiß ganz gesunde Augen.<lb/>Die meinigen leisten mir immer gute Dienste, wiewohl sie nun schon Veteranen der Manuscripte sind. Nur bei meinem letzten Aufenthalt in Paris litt ich an einem Augenübel. Mein Zustand wurde ängstlich, ich wandte mich an einen berühmten Oculisten, kam aber, wie es zu gehen pflegt, aus dem Regen in die Traufe. Er schrieb mir Einspritzungen durch den Thränenpunkt vor, eine äußerst peinliche Operation, die ich länger als einen Monat ertragen habe. Als ich zurückkam misbilligte mein vortrefflicher Freund von Walther diese Behandlung höchlich, und wünschte mir Glück, daß mir kein unheilbarer Schaden daraus erwachsen sei. Er versprach mir ein Augenwasser, vergaß es aber, und ich mahnte ihn darum in einigen Lateinischen Versen, die ich beilege. Völlig genesen kann Ew. Excellenz dieser Scherz, die Klage eines Leidensgenossen, vielleicht einige Augenblicke unterhalten.<lb/>Ich bitte recht sehr, die Exemplare von dem letzten Hefte der Indischen Bibliothek doch ja nicht zu schonen. Wir haben deren in Vorrath, und ich weiß keinen besseren Gebrauch dafür. Gerade dieser Theil der mir geschenkten Abhandlung muß für die Hellenisten besonders interessant seyn. Herr Welcker war erstaunt über die vertraute Bekanntschaft mit den Griechischen Grammatikern, welche sich darin kund giebt. Den Berliner Philologen habe ich Exemplare geschickt, auch einigen andern. Aber es stehen immer noch mehrere zu Befehl.<lb/>Leider ist noch kein neues Heft unter der Presse, wie es nach meinem guten Willen längst schon seyn sollte. Wenn ich einmal beim Schreiben bin, so macht es mir großes Vergnügen, aber es geht langsam, und das Anfangen fodert immer einen großen Entschluß. Ich habe allerlei kleine Aufsätze im Sinn.<lb/>Ew. Excellenz Vorschlag wegen des Bhagavad Gita erfodert reifliche Erwägung. Wenn ich nur das Glück haben könnte, mich mit Ihnen darüber zu besprechen, so würde ich es vielleicht besser anzugreifen wissen.<lb/>Ich bin sehr erfreut, Ihren Namen auf meiner Subscribentenliste für den Râmâyana zu haben. Es geht mit der Subscription doch einigermaßen vorwärts, und meine Wünsche und Foderungen sind mäßig. Doch brauche ich wenigstens 120 Subscribenten, um die Kosten zu decken. Es haben sich noch neue Hülfsmittel gefunden. Ein so eben aus Indien zurückgekommener Englischer Militär, der mir auch ein paar Handschriften zum Geschenke gesendet, wiewohl ich ihn nicht persönlich kenne, vertraut meinem Schüler ein sehr seltnes Manuscript des Râmâyana zur Benutzung an. Dieses, zum Theil beträchtlich alt, mit Bildern verziert, hat dem Fürsten von Odeypore (Udayapura) gehört. Es schreibt sich demnach aus der Raj-putana her, einem Lande, woher wir überhaupt noch wenig Handschriften haben. Ich besitze nun schon eine große Anzahl von Varianten des ersten Buches, und glaube in der Geschichte des Textes schon einigermaßen Licht zu sehen. Freilich wird es nöthig seyn, zuweilen das Geschäft des Diaskeuasten mit dem des Kritikers zu verbinden, aber ich hoffe dabei möglichst alle Willkühr zu vermeiden.<lb/><lb/><hi rend="weight:bold">den 26sten Junius</hi>. So geht es mir: diesen vor sechs Tagen angefangenen unbedeutenden Brief habe ich unter mancherlei Störungen immer noch nicht beendigen können. Gestern empfing ich nun Ew. Excellenz Sendung vom 24sten Mai. Ich bemerke ausdrücklich, daß sie einen vollen Monat unterwegs gewesen: denn wäre sie mir so schnell zugekommen, als wir das meiste aus Berlin zu erhalten pflegen, so wäre die lange Versäumniß meiner besten Danksagungen unverzeihlich. Ich habe die Abhandlung sogleich gelesen, aber eine erste Lesung ist wenig für eine so durchdachte Schrift. Der wesentliche Unterschied der Sprachen scheint mir vortrefflich auseinandergesetzt zu seyn. Die Ursprünglichkeit der Flexionen ist freilich der Punkt, über den wir nicht ganz einverstanden sind. Ich möchte beinahe sagen: um so besser! Dieß fodert zu neuer Prüfung auf. Bei so disputabeln Gegenständen muß man auf Widerspruch gefaßt seyn, und wie könnte ich mir einen bessern Gegner wünschen? Ich hatte schon früher den Gedanken, Ew. Excellenz um Erlaubniß zu bitten, einen Brief oder eine Reihe von Briefen über diese Gegenstände an Sie richten und in die Indische Bibliothek einrücken zu dürfen. Vielleicht gäbe dieß dann Ew. Excellenz Veranlassung, mir eine Antwort als neuen Beitrag zu schenken. Nicht alle Sätze meines Bruders möchte ich behaupten, wiewohl seine Forschungen mir die erste Anregung gegeben haben. Meine Ansichten entwickelten sich zuerst bei dem Studium der Geschichte unsrer Sprache vom Gothischen an, und der Entstehungsweise der Romanischen Sprachen; dann kam das Sanskrit hinzu. Ich habe sie bisher immer nur beiläufig zu berühren Gelegenheit gehabt: in der Schrift über das Provenzalische, und neuerdings wieder in der Indischen Bibliothek. Freilich stehe ich dadurch sehr im Nachtheil, daß meine Kenntniß auf eine einzige Familie von Sprachen beschränkt ist; und so gern ich auch das Solonische:<lb/><hi rend="slant:italic">γηράσκω δʼ αἰεὶ πολλὰ διδασκόμενος</hi>,<lb/>zu meinem Wahlspruch mache, so fand ich doch immer noch keine Muße, um das Hebräische wieder anzufrischen, und wenigstens die Anfangsgründe des Arabischen zu erlernen. <lb/>Ew. Excellenz Bemerkung über meine Übersetzung des Bh. G. II, 70 ist vollkommen gegründet. Ich weiß nicht, wo ich die Augen gehabt haben muß, da ich ein langes <hi rend="slant:italic">a</hi> für ein kurzes nahm, wiewohl ich es richtig abgedruckt, und auch in meiner Abschrift von diesem Capitel des Commentars kein Versehen gemacht hatte. Die Übersetzung des <hi rend="slant:italic">achalapratiṣṭhaṃ</hi> muß ich aber in Schutz nehmen, vermöge einer besseren Auctorität als die meinige ist. Sie drückt wörtlich die Erklärung des Srîdharaswâmin aus: <hi rend="slant:italic">anatikrāntamaryādaṃ</hi>. Ich lege die ganze Stelle des Commentars zu <hi rend="slant:italic">sl</hi>. 70 auf einem besondern Blatte bei. Die Übersetzung wäre nun etwa so zu berichtigen: <hi rend="slant:italic">Continuo sese explenti, nec tamen ultra terminos suos redundanti Oceano etc</hi>. Ich bitte Ew. Excellenz, mir doch ja alle Fehler, die Sie bemerken, anzuzeigen. Mit Herrn Bopp’s Beurtheilung in den Göttingischen Anzeigen habe ich Ursache sehr zufrieden zu seyn; nur kann ich ihm schwerlich zugeben, daß in dem Hemistichium <hi rend="slant:italic">sukhaṃduḥ</hi> <hi rend="slant:italic">swaṃbhawō bhāwō</hi> vor dem letzten Worte ein <hi rend="slant:italic">a privativum</hi> ausgefallen, und daß die beiden letzten Wörter als für sich bestehende Begriffe einander entgegengesetzt seyen. Dieß scheint mir die verschiedene Quantität nicht zu erlauben.<lb/>So eben empfange ich zu meiner großen Freude Herrn Bopps Episoden aus dem Maha Bharata. Der Berliner Guß ist ja recht schön ausgefallen. Dieß ist nun also der zweite Sanskrit-Text, den wir Deutsche binnen Jahresfrist ans Licht fördern. In England sind zwischen dem Hitôpadêsa und dem jetzt zur Erscheinung bald fertigen Gesetzbuch des Manus 14 Jahre verflossen.<lb/>Nächst dem Râmâyana ist mein Absehen immer noch auf den Hitôpadêsa gerichtet. Nur fehlt es in Europa leider gar sehr an Manuscripten. Der Baron Schilling von Canstadt aus St. Petersburg besitzt eins aus der Verlassenschaft eines Russen, der schon einmal eine Sanskrit-Grammatik geschrieben. Er brachte im vorigen Herbst einige Tage bei mir zu, versprach mir den Gebrauch des Manuscripts für die Folge, nahm es aber nach Paris mit. Nun ist er, wie ich höre, nach Rom gereist, ohne Zweifel wegen der tibetanischen Handschriften in der Propaganda.<lb/>Sehr hübsch wäre es, wenn man die artigen Mährchenbücher vom Papagei, von den dreißig Statuen am Thron des Vikramâdityas u. s. w. ans Licht stellen könnte. Aber die Handschriften, bei solchen Unterhaltungsbüchern unwissenden Abschreibern anheim gefallen, scheinen in einem heillosen Zustande zu seyn. Ich gedenke nächstens den Satz auszuführen, daß alle eigentlichen Feenmährchen aus Indien herkommen, und daß die Perser (vielleicht schon von der Zeit der Sassaniden her) nichts erfunden, sondern nur manirirte Übertragungen geliefert haben.<lb/>Ich bitte Ew. Excellenz, mich meine Langsamkeit im Briefschreiben nicht entgelten zu lassen, und bin mit der aufrichtigsten Verehrung und unveränderlich ergebenen Gesinnungen<lb/>Ew. Excellenz<lb/>gehorsamster<lb/>AWvSchlegel.<lb/><lb/>Ew. Excellenz haben mich sehr angenehm überrascht durch die günstige Erwähnung meines Calderon, eines ehemaligen Lieblingsdichters, den ich seit langer Zeit so ganz aus den Augen verlor, daß ich nicht einmal die Übersetzungen meiner Nachfolger, der Herren Gries und von Malsburg gelesen. Das Publicum scheint der Meynung zu seyn, daß sie es wenigstens eben so gut machen wie ich, wogegen ich auch nicht viel einzuwenden habe. Nur hat mir bei einem flüchtigen Anblick [geschienen], es fehle dann und wann an Klarheit. Ein gewisser <hi rend="slant:italic">Culteranismo</hi> im Stil des Calderon ist nicht abzuläugnen; dieß muß freilich ausgedrückt werden, wenn das Bild ähnlich seyn soll. Will man es aber zu ängstlich nachbilden, so entsteht leicht ein völliger Galimathias daraus.<lb/><lb/><hi rend="slant:italic">Ad. V. Cl. Philippum a Walther.<lb/>Te vates medicum poscit collyria lippus.<lb/>Phoebus amat vates; is pater est medicis.<lb/>Te genitor flectat, flectant communia sacra:<lb/>Si vis, e lippo Lyncea me efficies.<lb/>Demodocus, Thamyris, caecus fuit ipse et Homerus;<lb/>Non tanti est laurus: carmina iam valeant.<lb/>Sed veterum ad seras evolvere scripta lucernas,<lb/>Et dictis sapientum invigilare iuvat.<lb/>Tunc mihi ne doleant lacrimantia lumina, cura: <lb/>Pro vate haud renuent munera Pierides.</hi>', '36_briefid' => 'Leitzmann1908_AWSanWvHumboldt_2026061824', '36_absender' => array( (int) 0 => array( [maximum depth reached] ) ), '36_adressat' => array( (int) 0 => array( [maximum depth reached] ) ), '36_datumvon' => '1824-06-20', '36_datumbis' => '1824-06-26', '36_sprache' => array( (int) 0 => 'Deutsch', (int) 1 => 'Griechisch', (int) 2 => 'Lateinisch' ), '36_absenderort' => array( (int) 0 => array( [maximum depth reached] ) ), '36_leitd' => 'Briefwechsel zwischen Wilhelm von Humboldt und August Wilhelm Schlegel. Hg. v. Albert Leitzmann. Halle 1908, S. 170‒176.', '36_status' => 'Einmal kollationierter Druckvolltext ohne Registerauszeichnung', '36_Datum' => '1824-06-20', '36_facet_absender' => array( (int) 0 => 'August Wilhelm von Schlegel' ), '36_facet_absender_reverse' => array( (int) 0 => 'Schlegel, August Wilhelm von' ), '36_facet_adressat' => array( (int) 0 => 'Wilhelm von Humboldt' ), '36_facet_adressat_reverse' => array( (int) 0 => 'Humboldt, Wilhelm von' ), '36_facet_absenderort' => array( (int) 0 => 'Bonn' ), '36_facet_adressatort' => '', '36_facet_status' => 'Einmal kollationierter Druckvolltext ohne Registerauszeichnung', '36_facet_datengeberhand' => '', '36_facet_sprache' => array( (int) 0 => 'Deutsch', (int) 1 => 'Griechisch', (int) 2 => 'Lateinisch' ), '36_facet_korrespondenten' => array( (int) 0 => 'Wilhelm von Humboldt' ), '36_Digitalisat_Druck_Server' => array( (int) 0 => 'AWS-aw-0230-0.jpg', (int) 1 => 'AWS-aw-0230-1.jpg', (int) 2 => 'AWS-aw-0230-2.jpg', (int) 3 => 'AWS-aw-0230-3.jpg', (int) 4 => 'AWS-aw-0230-4.jpg', (int) 5 => 'AWS-aw-0230-5.jpg', (int) 6 => 'AWS-aw-0230-6.jpg' ), '_label' => '', '_descr' => '', '_model' => 'Letter', '_model_title' => 'Letter', '_model_titles' => 'Letters', '_url' => '' ), 'doctype_name' => 'Letters', 'captions' => array( '36_dummy' => '', '36_absender' => 'Absender/Verfasser', '36_absverif1' => 'Verfasser Verifikation', '36_absender2' => 'Verfasser 2', '36_absverif2' => 'Verfasser 2 Verifikation', '36_absbrieftyp2' => 'Verfasser 2 Brieftyp', '36_absender3' => 'Verfasser 3', '36_absverif3' => 'Verfasser 3 Verifikation', '36_absbrieftyp3' => 'Verfasser 3 Brieftyp', '36_adressat' => 'Adressat/Empfänger', '36_adrverif1' => 'Empfänger Verifikation', '36_adressat2' => 'Empfänger 2', '36_adrverif2' => 'Empfänger 2 Verifikation', '36_adressat3' => 'Empfänger 3', '36_adrverif3' => 'Empfänger 3 Verifikation', '36_adressatfalsch' => 'Empfänger_falsch', '36_absenderort' => 'Ort Absender/Verfasser', '36_absortverif1' => 'Ort Verfasser Verifikation', '36_absortungenau' => 'Ort Verfasser ungenau', '36_absenderort2' => 'Ort Verfasser 2', '36_absortverif2' => 'Ort Verfasser 2 Verifikation', '36_absenderort3' => 'Ort Verfasser 3', '36_absortverif3' => 'Ort Verfasser 3 Verifikation', '36_adressatort' => 'Ort Adressat/Empfänger', '36_adrortverif' => 'Ort Empfänger Verifikation', '36_datumvon' => 'Datum von', '36_datumbis' => 'Datum bis', '36_altDat' => 'Datum/Datum manuell', '36_datumverif' => 'Datum Verifikation', '36_sortdatum' => 'Datum zum Sortieren', '36_wochentag' => 'Wochentag nicht erzeugen', '36_sortdatum1' => 'Briefsortierung', '36_fremddatierung' => 'Fremddatierung', '36_typ' => 'Brieftyp', '36_briefid' => 'Brief Identifier', '36_purl_web' => 'PURL web', '36_status' => 'Bearbeitungsstatus', '36_anmerkung' => 'Anmerkung (intern)', '36_anmerkungextern' => 'Anmerkung (extern)', '36_datengeber' => 'Datengeber', '36_purl' => 'OAI-Id', '36_leitd' => 'Druck 1:Bibliographische Angabe', '36_druck2' => 'Druck 2:Bibliographische Angabe', '36_druck3' => 'Druck 3:Bibliographische Angabe', '36_internhand' => 'Zugehörige Handschrift', '36_datengeberhand' => 'Datengeber', '36_purlhand' => 'OAI-Id', '36_purlhand_alt' => 'OAI-Id (alternative)', '36_signaturhand' => 'Signatur', '36_signaturhand_alt' => 'Signatur (alternative)', '36_h1prov' => 'Provenienz', '36_h1zahl' => 'Blatt-/Seitenzahl', '36_h1format' => 'Format', '36_h1besonder' => 'Besonderheiten', '36_hueberlieferung' => 'Ãœberlieferung', '36_infoinhalt' => 'Verschollen/erschlossen: Information über den Inhalt', '36_heditor' => 'Editor/in', '36_hredaktion' => 'Redakteur/in', '36_interndruck' => 'Zugehörige Druck', '36_band' => 'KFSA Band', '36_briefnr' => 'KFSA Brief-Nr.', '36_briefseite' => 'KFSA Seite', '36_incipit' => 'Incipit', '36_textgrundlage' => 'Textgrundlage Sigle', '36_uberstatus' => 'Ãœberlieferungsstatus', '36_gattung' => 'Gattung', '36_korrepsondentds' => 'Korrespondent_DS', '36_korrepsondentfs' => 'Korrespondent_FS', '36_ermitteltvon' => 'Ermittelt von', '36_metadatenintern' => 'Metadaten (intern)', '36_beilagen' => 'Beilage(en)', '36_abszusatz' => 'Verfasser Zusatzinfos', '36_adrzusatz' => 'Empfänger Zusatzinfos', '36_absortzusatz' => 'Verfasser Ort Zusatzinfos', '36_adrortzusatz' => 'Empfänger Ort Zusatzinfos', '36_datumzusatz' => 'Datum Zusatzinfos', '36_' => '', '36_KFSA Hand.hueberleiferung' => 'Ãœberlieferungsträger', '36_KFSA Hand.harchiv' => 'Archiv', '36_KFSA Hand.hsignatur' => 'Signatur', '36_KFSA Hand.hprovenienz' => 'Provenienz', '36_KFSA Hand.harchivlalt' => 'Archiv_alt', '36_KFSA Hand.hsignaturalt' => 'Signatur_alt', '36_KFSA Hand.hblattzahl' => 'Blattzahl', '36_KFSA Hand.hseitenzahl' => 'Seitenzahl', '36_KFSA Hand.hformat' => 'Format', '36_KFSA Hand.hadresse' => 'Adresse', '36_KFSA Hand.hvollstaendig' => 'Vollständigkeit', '36_KFSA Hand.hzusatzinfo' => 'H Zusatzinfos', '36_KFSA Druck.drliteratur' => 'Druck in', '36_KFSA Druck.drsigle' => 'Sigle', '36_KFSA Druck.drbandnrseite' => 'Bd./Nr./S.', '36_KFSA Druck.drfaksimile' => 'Faksimile', '36_KFSA Druck.drvollstaendig' => 'Vollständigkeit', '36_KFSA Druck.dzusatzinfo' => 'D Zusatzinfos', '36_KFSA Doku.dokliteratur' => 'Dokumentiert in', '36_KFSA Doku.doksigle' => 'Sigle', '36_KFSA Doku.dokbandnrseite' => 'Bd./Nr./S.', '36_KFSA Doku.dokfaksimile' => 'Faksimile', '36_KFSA Doku.dokvollstaendig' => 'Vollständigkeit', '36_KFSA Doku.dokzusatzinfo' => 'A Zusatzinfos', '36_Link Druck.url_titel_druck' => 'Titel/Bezeichnung', '36_Link Druck.url_image_druck' => 'Link zu Online-Dokument', '36_Link Hand.url_titel_hand' => 'Titel/Bezeichnung', '36_Link Hand.url_image_hand' => 'Link zu Online-Dokument', '36_preasentation' => 'Nicht in die Präsentation', '36_verlag' => 'Verlag', '36_anhang_tite0' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename0' => 'Image', '36_anhang_tite1' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename1' => 'Image', '36_anhang_tite2' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename2' => 'Image', '36_anhang_tite3' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename3' => 'Image', '36_anhang_tite4' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename4' => 'Image', '36_anhang_tite5' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename5' => 'Image', '36_anhang_tite6' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename6' => 'Image', '36_anhang_tite7' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename7' => 'Image', '36_anhang_tite8' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename8' => 'Image', '36_anhang_tite9' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename9' => 'Image', '36_anhang_titea' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcenamea' => 'Image', '36_anhang_titeb' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcenameb' => 'Image', '36_anhang_titec' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcenamec' => 'Image', '36_anhang_tited' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcenamed' => 'Image', '36_anhang_titee' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcenamee' => 'Image', '36_anhang_titeu' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcenameu' => 'Image', '36_anhang_titev' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcenamev' => 'Image', '36_anhang_titew' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcenamew' => 'Image', '36_anhang_titex' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcenamex' => 'Image', '36_anhang_titey' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcenamey' => 'Image', '36_anhang_titez' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcenamez' => 'Image', '36_anhang_tite10' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename10' => 'Image', '36_anhang_tite11' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename11' => 'Image', '36_anhang_tite12' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename12' => 'Image', '36_anhang_tite13' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename13' => 'Image', '36_anhang_tite14' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename14' => 'Image', '36_anhang_tite15' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename15' => 'Image', '36_anhang_tite16' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename16' => 'Image', '36_anhang_tite17' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename17' => 'Image', '36_anhang_tite18' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename18' => 'Image', '36_h_preasentation' => 'Nicht in die Präsentation', '36_anhang_titef' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcenamef' => 'Image', '36_anhang_titeg' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcenameg' => 'Image', '36_anhang_titeh' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcenameh' => 'Image', '36_anhang_titei' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcenamei' => 'Image', '36_anhang_titej' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcenamej' => 'Image', '36_anhang_titek' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcenamek' => 'Image', '36_anhang_titel' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcenamel' => 'Image', '36_anhang_titem' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcenamem' => 'Image', '36_anhang_titen' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcenamen' => 'Image', '36_anhang_titeo' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcenameo' => 'Image', '36_anhang_titep' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcenamep' => 'Image', '36_anhang_titeq' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcenameq' => 'Image', '36_anhang_titer' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcenamer' => 'Image', '36_anhang_tites' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcenames' => 'Image', '36_anhang_titet' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcenamet' => 'Image', '36_anhang_tite19' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename19' => 'Image', '36_anhang_tite20' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename20' => 'Image', '36_anhang_tite21' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename21' => 'Image', '36_anhang_tite22' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename22' => 'Image', '36_anhang_tite23' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename23' => 'Image', '36_anhang_tite24' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename24' => 'Image', '36_anhang_tite25' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename25' => 'Image', '36_anhang_tite26' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename26' => 'Image', '36_anhang_tite27' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename27' => 'Image', '36_anhang_tite28' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename28' => 'Image', '36_anhang_tite29' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename29' => 'Image', '36_anhang_tite30' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename30' => 'Image', '36_anhang_tite31' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename32' => 'Image', '36_anhang_tite33' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename33' => 'Image', '36_anhang_tite34' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename34' => 'Image', '36_Relationen.relation_art' => 'Art', '36_Relationen.relation_link' => 'Interner Link', '36_volltext' => 'Brieftext (Digitalisat Leitdruck oder Transkript Handschrift)', '36_History.hisbearbeiter' => 'Bearbeiter', '36_History.hisschritt' => 'Bearbeitungsschritt', '36_History.hisdatum' => 'Datum', '36_History.hisnotiz' => 'Notiz', '36_personen' => 'Personen', '36_werke' => 'Werke', '36_orte' => 'Orte', '36_themen' => 'Themen', '36_briedfehlt' => 'Fehlt', '36_briefbestellt' => 'Bestellt', '36_intrans' => 'Transkription', '36_intranskorr1' => 'Transkription Korrektur 1', '36_intranskorr2' => 'Transkription Korrektur 2', '36_intranscheck' => 'Transkription Korr. geprüft', '36_intranseintr' => 'Transkription Korr. eingetr', '36_inannotcheck' => 'Auszeichnungen Reg. geprüft', '36_inkollation' => 'Auszeichnungen Kollationierung', '36_inkollcheck' => 'Auszeichnungen Koll. geprüft', '36_himageupload' => 'H/h Digis hochgeladen', '36_dimageupload' => 'D Digis hochgeladen', '36_stand' => 'Bearbeitungsstand (Webseite)', '36_stand_d' => 'Bearbeitungsstand (Druck)', '36_timecreate' => 'Erstellt am', '36_timelastchg' => 'Zuletzt gespeichert am', '36_comment' => 'Kommentar(intern)', '36_accessid' => 'Access ID', '36_accessidalt' => 'Access ID-alt', '36_digifotos' => 'Digitalisat Fotos', '36_imagelink' => 'Imagelink', '36_vermekrbehler' => 'Notizen Behler', '36_vermekrotto' => 'Anmerkungen Otto', '36_vermekraccess' => 'Bearb-Vermerke Access', '36_zeugenbeschreib' => 'Zeugenbeschreibung', '36_sprache' => 'Sprache', '36_accessinfo1' => 'Archiv H (+ Signatur)', '36_korrekturbd36' => 'Korrekturen Bd. 36', '36_druckbd36' => 'Druckrelevant Bd. 36', '36_digitalisath1' => 'Digitalisat_H', '36_digitalisath2' => 'Digitalisat_h', '36_titelhs' => 'Titel_Hs', '36_accessinfo2' => 'Archiv H (+ Signatur)', '36_accessinfo3' => 'Sigle (Dokumentiert in + Bd./Nr./S.)', '36_accessinfo4' => 'Sigle (Druck in + Bd./Nr./S.)', '36_KFSA Hand.hschreibstoff' => 'Schreibstoff', '36_Relationen.relation_anmerkung' => null, '36_anhang_tite35' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename35' => 'Image', '36_anhang_tite36' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename36' => 'Image', '36_anhang_tite37' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename37' => 'Image', '36_anhang_tite38' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename38' => 'Image', '36_anhang_tite39' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename39' => 'Image', '36_anhang_tite40' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename40' => 'Image', '36_anhang_tite41' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename41' => 'Image', '36_anhang_tite42' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename42' => 'Image', '36_anhang_tite43' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename43' => 'Image', '36_anhang_tite44' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename44' => 'Image', '36_anhang_tite45' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename45' => 'Image', '36_anhang_tite46' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename46' => 'Image', '36_anhang_tite47' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename47' => 'Image', '36_anhang_tite48' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename48' => 'Image', '36_anhang_tite49' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename49' => 'Image', '36_anhang_tite50' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename50' => 'Image', '36_anhang_tite51' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename51' => 'Image', '36_anhang_tite52' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename52' => 'Image', '36_anhang_tite53' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename53' => 'Image', '36_anhang_tite54' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename54' => 'Image', '36_KFSA Hand.hbeschreibung' => 'Beschreibung', '36_KFSA Kritanhang.krit_infotyp' => 'Infotyp', '36_KFSA Kritanhang.krit_infotext' => 'Infotext', '36_datumspezif' => 'Datum Spezifikation', 'index_orte_10' => 'Orte', 'index_orte_10.content' => 'Orte', 'index_orte_10.comment' => 'Orte (Kommentar)', 'index_personen_11' => 'Personen', 'index_personen_11.content' => 'Personen', 'index_personen_11.comment' => 'Personen (Kommentar)', 'index_werke_12' => 'Werke', 'index_werke_12.content' => 'Werke', 'index_werke_12.comment' => 'Werke (Kommentar)', 'index_periodika_13' => 'Periodika', 'index_periodika_13.content' => 'Periodika', 'index_periodika_13.comment' => 'Periodika (Kommentar)', 'index_sachen_14' => 'Sachen', 'index_sachen_14.content' => 'Sachen', 'index_sachen_14.comment' => 'Sachen (Kommentar)', 'index_koerperschaften_15' => 'Koerperschaften', 'index_koerperschaften_15.content' => 'Koerperschaften', 'index_koerperschaften_15.comment' => 'Koerperschaften (Kommentar)', 'index_zitate_16' => 'Zitate', 'index_zitate_16.content' => 'Zitate', 'index_zitate_16.comment' => 'Zitate (Kommentar)', 'index_korrespondenzpartner_17' => 'Korrespondenzpartner', 'index_korrespondenzpartner_17.content' => 'Korrespondenzpartner', 'index_korrespondenzpartner_17.comment' => 'Korrespondenzpartner (Kommentar)', 'index_archive_18' => 'Archive', 'index_archive_18.content' => 'Archive', 'index_archive_18.comment' => 'Archive (Kommentar)', 'index_literatur_19' => 'Literatur', 'index_literatur_19.content' => 'Literatur', 'index_literatur_19.comment' => 'Literatur (Kommentar)', 'index_kunstwerke_kfsa_20' => 'Kunstwerke KFSA', 'index_kunstwerke_kfsa_20.content' => 'Kunstwerke KFSA', 'index_kunstwerke_kfsa_20.comment' => 'Kunstwerke KFSA (Kommentar)', 'index_druckwerke_kfsa_21' => 'Druckwerke KFSA', 'index_druckwerke_kfsa_21.content' => 'Druckwerke KFSA', 'index_druckwerke_kfsa_21.comment' => 'Druckwerke KFSA (Kommentar)', '36_fulltext' => 'XML Volltext', '36_html' => 'HTML Volltext', '36_publicHTML' => 'HTML Volltext', '36_plaintext' => 'Volltext', 'transcript.text' => 'Transkripte', 'folders' => 'Mappen', 'notes' => 'Notizen', 'notes.title' => 'Notizen (Titel)', 'notes.content' => 'Notizen', 'notes.category' => 'Notizen (Kategorie)', 'key' => 'FuD Schlüssel' ) ) $html = 'Bonn den 20sten Junius 1824.<br>Ew. Excellenz bitte ich, die verspätete Beantwortung Ihres so belehrenden und aufmunternden Schreibens vom 15ten April gütigst zu entschuldigen. Ich gebe diesen Sommer Vorlesungen, die mir viel Zeit kosten, und mich auch in meinen Brahmanischen Studien nicht so viel thun lassen, als ich wohl wünschte.<br>Die Nachricht von einem Augenübel, das Ew. Excellenz erlitten, hat meine lebhafteste Theilnahme erregt. Ich hoffe und wünsche von ganzem Herzen, daß Sie vollkommen und dauerhaft hergestellt seyn mögen. Zu meiner Freude bestätigt ein Zeitungsartikel diese Hoffnung. Es wird aus Berlin gemeldet, daß Ew. Excellenz sich viel mit den neuerworbenen Papyrus-Rollen beschäftigen, und dazu gehören doch gewiß ganz gesunde Augen.<br>Die meinigen leisten mir immer gute Dienste, wiewohl sie nun schon Veteranen der Manuscripte sind. Nur bei meinem letzten Aufenthalt in Paris litt ich an einem Augenübel. Mein Zustand wurde ängstlich, ich wandte mich an einen berühmten Oculisten, kam aber, wie es zu gehen pflegt, aus dem Regen in die Traufe. Er schrieb mir Einspritzungen durch den Thränenpunkt vor, eine äußerst peinliche Operation, die ich länger als einen Monat ertragen habe. Als ich zurückkam misbilligte mein vortrefflicher Freund von Walther diese Behandlung höchlich, und wünschte mir Glück, daß mir kein unheilbarer Schaden daraus erwachsen sei. Er versprach mir ein Augenwasser, vergaß es aber, und ich mahnte ihn darum in einigen Lateinischen Versen, die ich beilege. Völlig genesen kann Ew. Excellenz dieser Scherz, die Klage eines Leidensgenossen, vielleicht einige Augenblicke unterhalten.<br>Ich bitte recht sehr, die Exemplare von dem letzten Hefte der Indischen Bibliothek doch ja nicht zu schonen. Wir haben deren in Vorrath, und ich weiß keinen besseren Gebrauch dafür. Gerade dieser Theil der mir geschenkten Abhandlung muß für die Hellenisten besonders interessant seyn. Herr Welcker war erstaunt über die vertraute Bekanntschaft mit den Griechischen Grammatikern, welche sich darin kund giebt. Den Berliner Philologen habe ich Exemplare geschickt, auch einigen andern. Aber es stehen immer noch mehrere zu Befehl.<br>Leider ist noch kein neues Heft unter der Presse, wie es nach meinem guten Willen längst schon seyn sollte. Wenn ich einmal beim Schreiben bin, so macht es mir großes Vergnügen, aber es geht langsam, und das Anfangen fodert immer einen großen Entschluß. Ich habe allerlei kleine Aufsätze im Sinn.<br>Ew. Excellenz Vorschlag wegen des Bhagavad Gita erfodert reifliche Erwägung. Wenn ich nur das Glück haben könnte, mich mit Ihnen darüber zu besprechen, so würde ich es vielleicht besser anzugreifen wissen.<br>Ich bin sehr erfreut, Ihren Namen auf meiner Subscribentenliste für den Râmâyana zu haben. Es geht mit der Subscription doch einigermaßen vorwärts, und meine Wünsche und Foderungen sind mäßig. Doch brauche ich wenigstens 120 Subscribenten, um die Kosten zu decken. Es haben sich noch neue Hülfsmittel gefunden. Ein so eben aus Indien zurückgekommener Englischer Militär, der mir auch ein paar Handschriften zum Geschenke gesendet, wiewohl ich ihn nicht persönlich kenne, vertraut meinem Schüler ein sehr seltnes Manuscript des Râmâyana zur Benutzung an. Dieses, zum Theil beträchtlich alt, mit Bildern verziert, hat dem Fürsten von Odeypore (Udayapura) gehört. Es schreibt sich demnach aus der Raj-putana her, einem Lande, woher wir überhaupt noch wenig Handschriften haben. Ich besitze nun schon eine große Anzahl von Varianten des ersten Buches, und glaube in der Geschichte des Textes schon einigermaßen Licht zu sehen. Freilich wird es nöthig seyn, zuweilen das Geschäft des Diaskeuasten mit dem des Kritikers zu verbinden, aber ich hoffe dabei möglichst alle Willkühr zu vermeiden.<br><br><span class="weight-bold ">den 26sten Junius</span>. So geht es mir: diesen vor sechs Tagen angefangenen unbedeutenden Brief habe ich unter mancherlei Störungen immer noch nicht beendigen können. Gestern empfing ich nun Ew. Excellenz Sendung vom 24sten Mai. Ich bemerke ausdrücklich, daß sie einen vollen Monat unterwegs gewesen: denn wäre sie mir so schnell zugekommen, als wir das meiste aus Berlin zu erhalten pflegen, so wäre die lange Versäumniß meiner besten Danksagungen unverzeihlich. Ich habe die Abhandlung sogleich gelesen, aber eine erste Lesung ist wenig für eine so durchdachte Schrift. Der wesentliche Unterschied der Sprachen scheint mir vortrefflich auseinandergesetzt zu seyn. Die Ursprünglichkeit der Flexionen ist freilich der Punkt, über den wir nicht ganz einverstanden sind. Ich möchte beinahe sagen: um so besser! Dieß fodert zu neuer Prüfung auf. Bei so disputabeln Gegenständen muß man auf Widerspruch gefaßt seyn, und wie könnte ich mir einen bessern Gegner wünschen? Ich hatte schon früher den Gedanken, Ew. Excellenz um Erlaubniß zu bitten, einen Brief oder eine Reihe von Briefen über diese Gegenstände an Sie richten und in die Indische Bibliothek einrücken zu dürfen. Vielleicht gäbe dieß dann Ew. Excellenz Veranlassung, mir eine Antwort als neuen Beitrag zu schenken. Nicht alle Sätze meines Bruders möchte ich behaupten, wiewohl seine Forschungen mir die erste Anregung gegeben haben. Meine Ansichten entwickelten sich zuerst bei dem Studium der Geschichte unsrer Sprache vom Gothischen an, und der Entstehungsweise der Romanischen Sprachen; dann kam das Sanskrit hinzu. Ich habe sie bisher immer nur beiläufig zu berühren Gelegenheit gehabt: in der Schrift über das Provenzalische, und neuerdings wieder in der Indischen Bibliothek. Freilich stehe ich dadurch sehr im Nachtheil, daß meine Kenntniß auf eine einzige Familie von Sprachen beschränkt ist; und so gern ich auch das Solonische:<br><span class="slant-italic ">γηράσκω δʼ αἰεὶ πολλὰ διδασκόμενος</span>,<br>zu meinem Wahlspruch mache, so fand ich doch immer noch keine Muße, um das Hebräische wieder anzufrischen, und wenigstens die Anfangsgründe des Arabischen zu erlernen. <br>Ew. Excellenz Bemerkung über meine Übersetzung des Bh. G. II, 70 ist vollkommen gegründet. Ich weiß nicht, wo ich die Augen gehabt haben muß, da ich ein langes <span class="slant-italic ">a</span> für ein kurzes nahm, wiewohl ich es richtig abgedruckt, und auch in meiner Abschrift von diesem Capitel des Commentars kein Versehen gemacht hatte. Die Übersetzung des <span class="slant-italic ">achalapratiṣṭhaṃ</span> muß ich aber in Schutz nehmen, vermöge einer besseren Auctorität als die meinige ist. Sie drückt wörtlich die Erklärung des Srîdharaswâmin aus: <span class="slant-italic ">anatikrāntamaryādaṃ</span>. Ich lege die ganze Stelle des Commentars zu <span class="slant-italic ">sl</span>. 70 auf einem besondern Blatte bei. Die Übersetzung wäre nun etwa so zu berichtigen: <span class="slant-italic ">Continuo sese explenti, nec tamen ultra terminos suos redundanti Oceano etc</span>. Ich bitte Ew. Excellenz, mir doch ja alle Fehler, die Sie bemerken, anzuzeigen. Mit Herrn Bopp’s Beurtheilung in den Göttingischen Anzeigen habe ich Ursache sehr zufrieden zu seyn; nur kann ich ihm schwerlich zugeben, daß in dem Hemistichium <span class="slant-italic ">sukhaṃduḥ</span> <span class="slant-italic ">swaṃbhawō bhāwō</span> vor dem letzten Worte ein <span class="slant-italic ">a privativum</span> ausgefallen, und daß die beiden letzten Wörter als für sich bestehende Begriffe einander entgegengesetzt seyen. Dieß scheint mir die verschiedene Quantität nicht zu erlauben.<br>So eben empfange ich zu meiner großen Freude Herrn Bopps Episoden aus dem Maha Bharata. Der Berliner Guß ist ja recht schön ausgefallen. Dieß ist nun also der zweite Sanskrit-Text, den wir Deutsche binnen Jahresfrist ans Licht fördern. In England sind zwischen dem Hitôpadêsa und dem jetzt zur Erscheinung bald fertigen Gesetzbuch des Manus 14 Jahre verflossen.<br>Nächst dem Râmâyana ist mein Absehen immer noch auf den Hitôpadêsa gerichtet. Nur fehlt es in Europa leider gar sehr an Manuscripten. Der Baron Schilling von Canstadt aus St. Petersburg besitzt eins aus der Verlassenschaft eines Russen, der schon einmal eine Sanskrit-Grammatik geschrieben. Er brachte im vorigen Herbst einige Tage bei mir zu, versprach mir den Gebrauch des Manuscripts für die Folge, nahm es aber nach Paris mit. Nun ist er, wie ich höre, nach Rom gereist, ohne Zweifel wegen der tibetanischen Handschriften in der Propaganda.<br>Sehr hübsch wäre es, wenn man die artigen Mährchenbücher vom Papagei, von den dreißig Statuen am Thron des Vikramâdityas u. s. w. ans Licht stellen könnte. Aber die Handschriften, bei solchen Unterhaltungsbüchern unwissenden Abschreibern anheim gefallen, scheinen in einem heillosen Zustande zu seyn. Ich gedenke nächstens den Satz auszuführen, daß alle eigentlichen Feenmährchen aus Indien herkommen, und daß die Perser (vielleicht schon von der Zeit der Sassaniden her) nichts erfunden, sondern nur manirirte Übertragungen geliefert haben.<br>Ich bitte Ew. Excellenz, mich meine Langsamkeit im Briefschreiben nicht entgelten zu lassen, und bin mit der aufrichtigsten Verehrung und unveränderlich ergebenen Gesinnungen<br>Ew. Excellenz<br>gehorsamster<br>AWvSchlegel.<br><br>Ew. Excellenz haben mich sehr angenehm überrascht durch die günstige Erwähnung meines Calderon, eines ehemaligen Lieblingsdichters, den ich seit langer Zeit so ganz aus den Augen verlor, daß ich nicht einmal die Übersetzungen meiner Nachfolger, der Herren Gries und von Malsburg gelesen. Das Publicum scheint der Meynung zu seyn, daß sie es wenigstens eben so gut machen wie ich, wogegen ich auch nicht viel einzuwenden habe. Nur hat mir bei einem flüchtigen Anblick [geschienen], es fehle dann und wann an Klarheit. Ein gewisser <span class="slant-italic ">Culteranismo</span> im Stil des Calderon ist nicht abzuläugnen; dieß muß freilich ausgedrückt werden, wenn das Bild ähnlich seyn soll. Will man es aber zu ängstlich nachbilden, so entsteht leicht ein völliger Galimathias daraus.<br><br><span class="slant-italic ">Ad. V. Cl. Philippum a Walther.<br>Te vates medicum poscit collyria lippus.<br>Phoebus amat vates; is pater est medicis.<br>Te genitor flectat, flectant communia sacra:<br>Si vis, e lippo Lyncea me efficies.<br>Demodocus, Thamyris, caecus fuit ipse et Homerus;<br>Non tanti est laurus: carmina iam valeant.<br>Sed veterum ad seras evolvere scripta lucernas,<br>Et dictis sapientum invigilare iuvat.<br>Tunc mihi ne doleant lacrimantia lumina, cura: <br>Pro vate haud renuent munera Pierides.</span>' $isaprint = true $isnewtranslation = false $statemsg = 'betamsg15' $cittitle = '' $description = 'August Wilhelm von Schlegel an Wilhelm von Humboldt am 20.06.1824 bis 26.06.1824, Bonn' $adressatort = 'Unknown' $absendeort = 'Bonn <a class="gndmetadata" target="_blank" href="http://d-nb.info/gnd/1001909-1">GND</a>' $date = '20.06.1824 bis 26.06.1824' $adressat = array( (int) 2949 => array( 'ID' => '2949', 'project' => '1', 'timecreate' => '2013-10-17 13:02:22', 'timelastchg' => '2018-01-11 15:52:48', 'key' => 'AWS-ap-00av', 'docTyp' => array( 'name' => 'Person', 'id' => '39' ), '39_name' => 'Humboldt, Wilhelm von', '39_geschlecht' => 'm', '39_gebdatum' => '1767-06-22', '39_toddatum' => '1835-04-08', '39_pdb' => 'GND', '39_dbid' => '118554727', '39_quellen' => 'NDB@https://www.deutsche-biographie.de/gnd118554727.html#ndbcontent@ ADB@https://www.deutsche-biographie.de/gnd118554727.html#adbcontent@ WBIS@http://db.saur.de/WBIS/basicSearch.jsf@J023-835-2@ Wikipedia@https://de.wikipedia.org/wiki/Wilhelm_von_Humboldt@', '39_geburtsort' => array( 'ID' => '2275', 'content' => 'Potsdam', 'bemerkung' => 'GND:4046948-7', 'LmAdd' => array([maximum depth reached]) ), '39_sterbeort' => array( 'ID' => '10056', 'content' => 'Tegel', 'bemerkung' => 'GND:5007835-5', 'LmAdd' => array([maximum depth reached]) ), '39_lebenwirken' => 'Politiker, Sprachforscher, Publizist, Philosoph Wilhelm von Humboldt wuchs auf Schloss Tegel auf, dem Familienbesitz der Humboldts. Ab 1787 studierte Wilhelm zusammen mit seinem Bruder Alexander an der Universität in Frankfurt (Oder) Rechtswissenschaften. Ein Jahr später wechselte er an die Universität Göttingen, wo er den gleichfalls dort studierenden AWS kennenlernte. 1789 führte ihn eine Reise in das revolutionäre Paris. Anfang 1790 trat er nach Beendigung des Studiums in den Staatsdienst und erhielt eine Anstellung im Justizdepartement. 1791 heiratete er Caroline von Dacheröden, die Tochter eines preußischen Kammergerichtsrates. Im selben Jahr schied er aus dem Staatsdienst aus, um auf den Gütern der Familie von Dacheröden seine Studien der altgriechischen Sprache, Kultur, Kunst und Philosophie fortzusetzen. 1794 zog er nach Jena. Humboldt fungierte als konstruktiver Kritiker und gelehrter Ratgeber für die Protagonisten der Weimarer Klassik. Ab November 1797 lebte er in Paris, um seine Studien fortzuführen. Ausgiebige Reisen nach Spanien dienten auch der Erforschung der baskischen Kultur und Sprache. Von 1802 bis 1808 agierte Humboldt als preußischer Gesandter beim Heiligen Stuhl in Rom. Mit der Aufgabe der konsularischen Vertretung war Humboldt zeitlich nicht überfordert, so dass er genug Gelegenheit hatte, seine Studien weiter zu betreiben und sein Domizil zu einem gesellschaftlichen Mittelpunkt zu machen. 1809 wurde er Sektionschef für Kultus und Unterricht im Ministerium des Innern in Berlin. Humboldt galt als liberaler Bildungsreformer. Zu seinen Leistungen gehören ein neu gegliedertes Bildungssystem, das allen Schichten die Möglichkeit des Zugangs zu Bildung zusichern sollte, und die Vereinheitlichung der Abschlussprüfungen. Als weiterer Meilenstein kann Humboldts Beteiligung bei der Gründung der Universität Berlin gelten; zahlreiche renommierte Wissenschaftler konnten für die Lehrstühle gewonnen werden. Die Eröffnung der Universität im Oktober 1810 fand allerdings ohne Humboldt statt. Nach Auseinandersetzungen verließ er den Bildungssektor und ging als preußischer Gesandter nach Wien, später nach London. In dieser Funktion war er am Wiener Kongress beteiligt. 1819 schied er aus dem Staatsdienst aus und beschäftigte sich weiter mit sprachwissenschaftlichen Forschungen, darunter auch dem Sanskrit und dem Kâwi, der Sprache der indonesischen Insel Java. Wilhelms Bruder Alexander von Humboldt war ein bedeutender Naturforscher, die Brüder Humboldt gelten als die „preußischen Dioskuren“.', '39_namevar' => 'Humboldt, Friedrich Wilhelm Christian Karl Ferdinand von Humboldt, Carl W. von Humboldt, Wilhelm F. von Humboldt, Guillaume de Humboldt, Karl W. von Humboldt, Carl Wilhelm von Humboldt, G. de', '39_beziehung' => 'AWS kannte Wilhelm von Humboldt schon aus Göttinger Studentenzeiten, in Jena begegneten sie sich wieder. Schlegel war 1805 Gast Humboldts in Rom, zur Zeit von dessen preußischer Gesandtschaft. Humboldt und AWS korrespondierten auch über ihre sprachwissenschaftlichen Studien, von großer Kenntnis Humboldts zeugen die ausführlichen brieflichen Diskussionen über das Sanskrit. Humboldt steuerte Aufsätze zu Schlegels „Indischer Bibliothek“ bei. Beide Gelehrte begegneten sich mit großem Respekt, auch wenn sie nicht in allen fachlichen Überzeugungen übereinstimmten.', '39_status_person' => 'Vollständig', '39_sourcename0' => 'AWS-ap-00av-0.jpg', 'folders' => array( (int) 0 => 'Personen', (int) 1 => 'Personen' ), '_label' => '', '_descr' => '', '_model' => 'Person', '_model_title' => 'Person', '_model_titles' => 'People', '_url' => '' ) ) $adrCitation = 'Wilhelm von Humboldt' $absender = array() $absCitation = 'August Wilhelm von Schlegel' $percount = (int) 2 $notabs = false $tabs = array( 'text' => array( 'content' => 'Volltext Druck', 'exists' => '1' ), 'druck' => array( 'exists' => '1', 'content' => 'Digitalisat Druck' ) ) $parallelview = array( (int) 0 => '1', (int) 1 => '1' ) $dzi_imagesHand = array() $dzi_imagesDruck = array( (int) 0 => '/cake_fud/files/temp/images/dzi/AWS-aw-0230-0.jpg.xml', (int) 1 => '/cake_fud/files/temp/images/dzi/AWS-aw-0230-1.jpg.xml', (int) 2 => '/cake_fud/files/temp/images/dzi/AWS-aw-0230-2.jpg.xml', (int) 3 => '/cake_fud/files/temp/images/dzi/AWS-aw-0230-3.jpg.xml', (int) 4 => '/cake_fud/files/temp/images/dzi/AWS-aw-0230-4.jpg.xml', (int) 5 => '/cake_fud/files/temp/images/dzi/AWS-aw-0230-5.jpg.xml', (int) 6 => '/cake_fud/files/temp/images/dzi/AWS-aw-0230-6.jpg.xml' ) $indexesintext = array() $right = '' $left = 'text' $handschrift = array() $druck = array( 'Bibliographische Angabe' => 'Briefwechsel zwischen Wilhelm von Humboldt und August Wilhelm Schlegel. Hg. v. Albert Leitzmann. Halle 1908, S. 170‒176.', 'Incipit' => '„Bonn den 20sten Junius 1824.<br>Ew. Excellenz bitte ich, die verspätete Beantwortung Ihres so belehrenden und aufmunternden Schreibens vom 15ten April gütigst [...]“' ) $docmain = array( 'ID' => '3164', 'project' => '1', 'timecreate' => '2013-11-12 08:42:32', 'timelastchg' => '2019-10-11 12:48:12', 'key' => 'AWS-aw-0230', 'docTyp' => array( 'name' => 'Brief', 'id' => '36' ), '36_html' => 'Bonn den 20sten Junius 1824.<br>Ew. Excellenz bitte ich, die verspätete Beantwortung Ihres so belehrenden und aufmunternden Schreibens vom 15ten April gütigst zu entschuldigen. Ich gebe diesen Sommer Vorlesungen, die mir viel Zeit kosten, und mich auch in meinen Brahmanischen Studien nicht so viel thun lassen, als ich wohl wünschte.<br>Die Nachricht von einem Augenübel, das Ew. Excellenz erlitten, hat meine lebhafteste Theilnahme erregt. Ich hoffe und wünsche von ganzem Herzen, daß Sie vollkommen und dauerhaft hergestellt seyn mögen. Zu meiner Freude bestätigt ein Zeitungsartikel diese Hoffnung. Es wird aus Berlin gemeldet, daß Ew. Excellenz sich viel mit den neuerworbenen Papyrus-Rollen beschäftigen, und dazu gehören doch gewiß ganz gesunde Augen.<br>Die meinigen leisten mir immer gute Dienste, wiewohl sie nun schon Veteranen der Manuscripte sind. Nur bei meinem letzten Aufenthalt in Paris litt ich an einem Augenübel. Mein Zustand wurde ängstlich, ich wandte mich an einen berühmten Oculisten, kam aber, wie es zu gehen pflegt, aus dem Regen in die Traufe. Er schrieb mir Einspritzungen durch den Thränenpunkt vor, eine äußerst peinliche Operation, die ich länger als einen Monat ertragen habe. Als ich zurückkam misbilligte mein vortrefflicher Freund von Walther diese Behandlung höchlich, und wünschte mir Glück, daß mir kein unheilbarer Schaden daraus erwachsen sei. Er versprach mir ein Augenwasser, vergaß es aber, und ich mahnte ihn darum in einigen Lateinischen Versen, die ich beilege. Völlig genesen kann Ew. Excellenz dieser Scherz, die Klage eines Leidensgenossen, vielleicht einige Augenblicke unterhalten.<br>Ich bitte recht sehr, die Exemplare von dem letzten Hefte der Indischen Bibliothek doch ja nicht zu schonen. Wir haben deren in Vorrath, und ich weiß keinen besseren Gebrauch dafür. Gerade dieser Theil der mir geschenkten Abhandlung muß für die Hellenisten besonders interessant seyn. Herr Welcker war erstaunt über die vertraute Bekanntschaft mit den Griechischen Grammatikern, welche sich darin kund giebt. Den Berliner Philologen habe ich Exemplare geschickt, auch einigen andern. Aber es stehen immer noch mehrere zu Befehl.<br>Leider ist noch kein neues Heft unter der Presse, wie es nach meinem guten Willen längst schon seyn sollte. Wenn ich einmal beim Schreiben bin, so macht es mir großes Vergnügen, aber es geht langsam, und das Anfangen fodert immer einen großen Entschluß. Ich habe allerlei kleine Aufsätze im Sinn.<br>Ew. Excellenz Vorschlag wegen des Bhagavad Gita erfodert reifliche Erwägung. Wenn ich nur das Glück haben könnte, mich mit Ihnen darüber zu besprechen, so würde ich es vielleicht besser anzugreifen wissen.<br>Ich bin sehr erfreut, Ihren Namen auf meiner Subscribentenliste für den Râmâyana zu haben. Es geht mit der Subscription doch einigermaßen vorwärts, und meine Wünsche und Foderungen sind mäßig. Doch brauche ich wenigstens 120 Subscribenten, um die Kosten zu decken. Es haben sich noch neue Hülfsmittel gefunden. Ein so eben aus Indien zurückgekommener Englischer Militär, der mir auch ein paar Handschriften zum Geschenke gesendet, wiewohl ich ihn nicht persönlich kenne, vertraut meinem Schüler ein sehr seltnes Manuscript des Râmâyana zur Benutzung an. Dieses, zum Theil beträchtlich alt, mit Bildern verziert, hat dem Fürsten von Odeypore (Udayapura) gehört. Es schreibt sich demnach aus der Raj-putana her, einem Lande, woher wir überhaupt noch wenig Handschriften haben. Ich besitze nun schon eine große Anzahl von Varianten des ersten Buches, und glaube in der Geschichte des Textes schon einigermaßen Licht zu sehen. Freilich wird es nöthig seyn, zuweilen das Geschäft des Diaskeuasten mit dem des Kritikers zu verbinden, aber ich hoffe dabei möglichst alle Willkühr zu vermeiden.<br><br><span class="weight-bold ">den 26sten Junius</span>. So geht es mir: diesen vor sechs Tagen angefangenen unbedeutenden Brief habe ich unter mancherlei Störungen immer noch nicht beendigen können. Gestern empfing ich nun Ew. Excellenz Sendung vom 24sten Mai. Ich bemerke ausdrücklich, daß sie einen vollen Monat unterwegs gewesen: denn wäre sie mir so schnell zugekommen, als wir das meiste aus Berlin zu erhalten pflegen, so wäre die lange Versäumniß meiner besten Danksagungen unverzeihlich. Ich habe die Abhandlung sogleich gelesen, aber eine erste Lesung ist wenig für eine so durchdachte Schrift. Der wesentliche Unterschied der Sprachen scheint mir vortrefflich auseinandergesetzt zu seyn. Die Ursprünglichkeit der Flexionen ist freilich der Punkt, über den wir nicht ganz einverstanden sind. Ich möchte beinahe sagen: um so besser! Dieß fodert zu neuer Prüfung auf. Bei so disputabeln Gegenständen muß man auf Widerspruch gefaßt seyn, und wie könnte ich mir einen bessern Gegner wünschen? Ich hatte schon früher den Gedanken, Ew. Excellenz um Erlaubniß zu bitten, einen Brief oder eine Reihe von Briefen über diese Gegenstände an Sie richten und in die Indische Bibliothek einrücken zu dürfen. Vielleicht gäbe dieß dann Ew. Excellenz Veranlassung, mir eine Antwort als neuen Beitrag zu schenken. Nicht alle Sätze meines Bruders möchte ich behaupten, wiewohl seine Forschungen mir die erste Anregung gegeben haben. Meine Ansichten entwickelten sich zuerst bei dem Studium der Geschichte unsrer Sprache vom Gothischen an, und der Entstehungsweise der Romanischen Sprachen; dann kam das Sanskrit hinzu. Ich habe sie bisher immer nur beiläufig zu berühren Gelegenheit gehabt: in der Schrift über das Provenzalische, und neuerdings wieder in der Indischen Bibliothek. Freilich stehe ich dadurch sehr im Nachtheil, daß meine Kenntniß auf eine einzige Familie von Sprachen beschränkt ist; und so gern ich auch das Solonische:<br><span class="slant-italic ">γηράσκω δʼ αἰεὶ πολλὰ διδασκόμενος</span>,<br>zu meinem Wahlspruch mache, so fand ich doch immer noch keine Muße, um das Hebräische wieder anzufrischen, und wenigstens die Anfangsgründe des Arabischen zu erlernen. <br>Ew. Excellenz Bemerkung über meine Übersetzung des Bh. G. II, 70 ist vollkommen gegründet. Ich weiß nicht, wo ich die Augen gehabt haben muß, da ich ein langes <span class="slant-italic ">a</span> für ein kurzes nahm, wiewohl ich es richtig abgedruckt, und auch in meiner Abschrift von diesem Capitel des Commentars kein Versehen gemacht hatte. Die Übersetzung des <span class="slant-italic ">achalapratiṣṭhaṃ</span> muß ich aber in Schutz nehmen, vermöge einer besseren Auctorität als die meinige ist. Sie drückt wörtlich die Erklärung des Srîdharaswâmin aus: <span class="slant-italic ">anatikrāntamaryādaṃ</span>. Ich lege die ganze Stelle des Commentars zu <span class="slant-italic ">sl</span>. 70 auf einem besondern Blatte bei. Die Übersetzung wäre nun etwa so zu berichtigen: <span class="slant-italic ">Continuo sese explenti, nec tamen ultra terminos suos redundanti Oceano etc</span>. Ich bitte Ew. Excellenz, mir doch ja alle Fehler, die Sie bemerken, anzuzeigen. Mit Herrn Bopp’s Beurtheilung in den Göttingischen Anzeigen habe ich Ursache sehr zufrieden zu seyn; nur kann ich ihm schwerlich zugeben, daß in dem Hemistichium <span class="slant-italic ">sukhaṃduḥ</span> <span class="slant-italic ">swaṃbhawō bhāwō</span> vor dem letzten Worte ein <span class="slant-italic ">a privativum</span> ausgefallen, und daß die beiden letzten Wörter als für sich bestehende Begriffe einander entgegengesetzt seyen. Dieß scheint mir die verschiedene Quantität nicht zu erlauben.<br>So eben empfange ich zu meiner großen Freude Herrn Bopps Episoden aus dem Maha Bharata. Der Berliner Guß ist ja recht schön ausgefallen. Dieß ist nun also der zweite Sanskrit-Text, den wir Deutsche binnen Jahresfrist ans Licht fördern. In England sind zwischen dem Hitôpadêsa und dem jetzt zur Erscheinung bald fertigen Gesetzbuch des Manus 14 Jahre verflossen.<br>Nächst dem Râmâyana ist mein Absehen immer noch auf den Hitôpadêsa gerichtet. Nur fehlt es in Europa leider gar sehr an Manuscripten. Der Baron Schilling von Canstadt aus St. Petersburg besitzt eins aus der Verlassenschaft eines Russen, der schon einmal eine Sanskrit-Grammatik geschrieben. Er brachte im vorigen Herbst einige Tage bei mir zu, versprach mir den Gebrauch des Manuscripts für die Folge, nahm es aber nach Paris mit. Nun ist er, wie ich höre, nach Rom gereist, ohne Zweifel wegen der tibetanischen Handschriften in der Propaganda.<br>Sehr hübsch wäre es, wenn man die artigen Mährchenbücher vom Papagei, von den dreißig Statuen am Thron des Vikramâdityas u. s. w. ans Licht stellen könnte. Aber die Handschriften, bei solchen Unterhaltungsbüchern unwissenden Abschreibern anheim gefallen, scheinen in einem heillosen Zustande zu seyn. Ich gedenke nächstens den Satz auszuführen, daß alle eigentlichen Feenmährchen aus Indien herkommen, und daß die Perser (vielleicht schon von der Zeit der Sassaniden her) nichts erfunden, sondern nur manirirte Übertragungen geliefert haben.<br>Ich bitte Ew. Excellenz, mich meine Langsamkeit im Briefschreiben nicht entgelten zu lassen, und bin mit der aufrichtigsten Verehrung und unveränderlich ergebenen Gesinnungen<br>Ew. Excellenz<br>gehorsamster<br>AWvSchlegel.<br><br>Ew. Excellenz haben mich sehr angenehm überrascht durch die günstige Erwähnung meines Calderon, eines ehemaligen Lieblingsdichters, den ich seit langer Zeit so ganz aus den Augen verlor, daß ich nicht einmal die Übersetzungen meiner Nachfolger, der Herren Gries und von Malsburg gelesen. Das Publicum scheint der Meynung zu seyn, daß sie es wenigstens eben so gut machen wie ich, wogegen ich auch nicht viel einzuwenden habe. Nur hat mir bei einem flüchtigen Anblick [geschienen], es fehle dann und wann an Klarheit. Ein gewisser <span class="slant-italic ">Culteranismo</span> im Stil des Calderon ist nicht abzuläugnen; dieß muß freilich ausgedrückt werden, wenn das Bild ähnlich seyn soll. Will man es aber zu ängstlich nachbilden, so entsteht leicht ein völliger Galimathias daraus.<br><br><span class="slant-italic ">Ad. V. Cl. Philippum a Walther.<br>Te vates medicum poscit collyria lippus.<br>Phoebus amat vates; is pater est medicis.<br>Te genitor flectat, flectant communia sacra:<br>Si vis, e lippo Lyncea me efficies.<br>Demodocus, Thamyris, caecus fuit ipse et Homerus;<br>Non tanti est laurus: carmina iam valeant.<br>Sed veterum ad seras evolvere scripta lucernas,<br>Et dictis sapientum invigilare iuvat.<br>Tunc mihi ne doleant lacrimantia lumina, cura: <br>Pro vate haud renuent munera Pierides.</span>', '36_xml' => '<p>Bonn den 20sten Junius 1824.<lb/>Ew. Excellenz bitte ich, die verspätete Beantwortung Ihres so belehrenden und aufmunternden Schreibens vom 15ten April gütigst zu entschuldigen. Ich gebe diesen Sommer Vorlesungen, die mir viel Zeit kosten, und mich auch in meinen Brahmanischen Studien nicht so viel thun lassen, als ich wohl wünschte.<lb/>Die Nachricht von einem Augenübel, das Ew. Excellenz erlitten, hat meine lebhafteste Theilnahme erregt. Ich hoffe und wünsche von ganzem Herzen, daß Sie vollkommen und dauerhaft hergestellt seyn mögen. Zu meiner Freude bestätigt ein Zeitungsartikel diese Hoffnung. Es wird aus Berlin gemeldet, daß Ew. Excellenz sich viel mit den neuerworbenen Papyrus-Rollen beschäftigen, und dazu gehören doch gewiß ganz gesunde Augen.<lb/>Die meinigen leisten mir immer gute Dienste, wiewohl sie nun schon Veteranen der Manuscripte sind. Nur bei meinem letzten Aufenthalt in Paris litt ich an einem Augenübel. Mein Zustand wurde ängstlich, ich wandte mich an einen berühmten Oculisten, kam aber, wie es zu gehen pflegt, aus dem Regen in die Traufe. Er schrieb mir Einspritzungen durch den Thränenpunkt vor, eine äußerst peinliche Operation, die ich länger als einen Monat ertragen habe. Als ich zurückkam misbilligte mein vortrefflicher Freund von Walther diese Behandlung höchlich, und wünschte mir Glück, daß mir kein unheilbarer Schaden daraus erwachsen sei. Er versprach mir ein Augenwasser, vergaß es aber, und ich mahnte ihn darum in einigen Lateinischen Versen, die ich beilege. Völlig genesen kann Ew. Excellenz dieser Scherz, die Klage eines Leidensgenossen, vielleicht einige Augenblicke unterhalten.<lb/>Ich bitte recht sehr, die Exemplare von dem letzten Hefte der Indischen Bibliothek doch ja nicht zu schonen. Wir haben deren in Vorrath, und ich weiß keinen besseren Gebrauch dafür. Gerade dieser Theil der mir geschenkten Abhandlung muß für die Hellenisten besonders interessant seyn. Herr Welcker war erstaunt über die vertraute Bekanntschaft mit den Griechischen Grammatikern, welche sich darin kund giebt. Den Berliner Philologen habe ich Exemplare geschickt, auch einigen andern. Aber es stehen immer noch mehrere zu Befehl.<lb/>Leider ist noch kein neues Heft unter der Presse, wie es nach meinem guten Willen längst schon seyn sollte. Wenn ich einmal beim Schreiben bin, so macht es mir großes Vergnügen, aber es geht langsam, und das Anfangen fodert immer einen großen Entschluß. Ich habe allerlei kleine Aufsätze im Sinn.<lb/>Ew. Excellenz Vorschlag wegen des Bhagavad Gita erfodert reifliche Erwägung. Wenn ich nur das Glück haben könnte, mich mit Ihnen darüber zu besprechen, so würde ich es vielleicht besser anzugreifen wissen.<lb/>Ich bin sehr erfreut, Ihren Namen auf meiner Subscribentenliste für den Râmâyana zu haben. Es geht mit der Subscription doch einigermaßen vorwärts, und meine Wünsche und Foderungen sind mäßig. Doch brauche ich wenigstens 120 Subscribenten, um die Kosten zu decken. Es haben sich noch neue Hülfsmittel gefunden. Ein so eben aus Indien zurückgekommener Englischer Militär, der mir auch ein paar Handschriften zum Geschenke gesendet, wiewohl ich ihn nicht persönlich kenne, vertraut meinem Schüler ein sehr seltnes Manuscript des Râmâyana zur Benutzung an. Dieses, zum Theil beträchtlich alt, mit Bildern verziert, hat dem Fürsten von Odeypore (Udayapura) gehört. Es schreibt sich demnach aus der Raj-putana her, einem Lande, woher wir überhaupt noch wenig Handschriften haben. Ich besitze nun schon eine große Anzahl von Varianten des ersten Buches, und glaube in der Geschichte des Textes schon einigermaßen Licht zu sehen. Freilich wird es nöthig seyn, zuweilen das Geschäft des Diaskeuasten mit dem des Kritikers zu verbinden, aber ich hoffe dabei möglichst alle Willkühr zu vermeiden.<lb/><lb/><hi rend="weight:bold">den 26sten Junius</hi>. So geht es mir: diesen vor sechs Tagen angefangenen unbedeutenden Brief habe ich unter mancherlei Störungen immer noch nicht beendigen können. Gestern empfing ich nun Ew. Excellenz Sendung vom 24sten Mai. Ich bemerke ausdrücklich, daß sie einen vollen Monat unterwegs gewesen: denn wäre sie mir so schnell zugekommen, als wir das meiste aus Berlin zu erhalten pflegen, so wäre die lange Versäumniß meiner besten Danksagungen unverzeihlich. Ich habe die Abhandlung sogleich gelesen, aber eine erste Lesung ist wenig für eine so durchdachte Schrift. Der wesentliche Unterschied der Sprachen scheint mir vortrefflich auseinandergesetzt zu seyn. Die Ursprünglichkeit der Flexionen ist freilich der Punkt, über den wir nicht ganz einverstanden sind. Ich möchte beinahe sagen: um so besser! Dieß fodert zu neuer Prüfung auf. Bei so disputabeln Gegenständen muß man auf Widerspruch gefaßt seyn, und wie könnte ich mir einen bessern Gegner wünschen? Ich hatte schon früher den Gedanken, Ew. Excellenz um Erlaubniß zu bitten, einen Brief oder eine Reihe von Briefen über diese Gegenstände an Sie richten und in die Indische Bibliothek einrücken zu dürfen. Vielleicht gäbe dieß dann Ew. Excellenz Veranlassung, mir eine Antwort als neuen Beitrag zu schenken. Nicht alle Sätze meines Bruders möchte ich behaupten, wiewohl seine Forschungen mir die erste Anregung gegeben haben. Meine Ansichten entwickelten sich zuerst bei dem Studium der Geschichte unsrer Sprache vom Gothischen an, und der Entstehungsweise der Romanischen Sprachen; dann kam das Sanskrit hinzu. Ich habe sie bisher immer nur beiläufig zu berühren Gelegenheit gehabt: in der Schrift über das Provenzalische, und neuerdings wieder in der Indischen Bibliothek. Freilich stehe ich dadurch sehr im Nachtheil, daß meine Kenntniß auf eine einzige Familie von Sprachen beschränkt ist; und so gern ich auch das Solonische:<lb/><hi rend="slant:italic">γηράσκω δʼ αἰεὶ πολλὰ διδασκόμενος</hi>,<lb/>zu meinem Wahlspruch mache, so fand ich doch immer noch keine Muße, um das Hebräische wieder anzufrischen, und wenigstens die Anfangsgründe des Arabischen zu erlernen. <lb/>Ew. Excellenz Bemerkung über meine Übersetzung des Bh. G. II, 70 ist vollkommen gegründet. Ich weiß nicht, wo ich die Augen gehabt haben muß, da ich ein langes <hi rend="slant:italic">a</hi> für ein kurzes nahm, wiewohl ich es richtig abgedruckt, und auch in meiner Abschrift von diesem Capitel des Commentars kein Versehen gemacht hatte. Die Übersetzung des <hi rend="slant:italic">achalapratiṣṭhaṃ</hi> muß ich aber in Schutz nehmen, vermöge einer besseren Auctorität als die meinige ist. Sie drückt wörtlich die Erklärung des Srîdharaswâmin aus: <hi rend="slant:italic">anatikrāntamaryādaṃ</hi>. Ich lege die ganze Stelle des Commentars zu <hi rend="slant:italic">sl</hi>. 70 auf einem besondern Blatte bei. Die Übersetzung wäre nun etwa so zu berichtigen: <hi rend="slant:italic">Continuo sese explenti, nec tamen ultra terminos suos redundanti Oceano etc</hi>. Ich bitte Ew. Excellenz, mir doch ja alle Fehler, die Sie bemerken, anzuzeigen. Mit Herrn Bopp’s Beurtheilung in den Göttingischen Anzeigen habe ich Ursache sehr zufrieden zu seyn; nur kann ich ihm schwerlich zugeben, daß in dem Hemistichium <hi rend="slant:italic">sukhaṃduḥ</hi> <hi rend="slant:italic">swaṃbhawō bhāwō</hi> vor dem letzten Worte ein <hi rend="slant:italic">a privativum</hi> ausgefallen, und daß die beiden letzten Wörter als für sich bestehende Begriffe einander entgegengesetzt seyen. Dieß scheint mir die verschiedene Quantität nicht zu erlauben.<lb/>So eben empfange ich zu meiner großen Freude Herrn Bopps Episoden aus dem Maha Bharata. Der Berliner Guß ist ja recht schön ausgefallen. Dieß ist nun also der zweite Sanskrit-Text, den wir Deutsche binnen Jahresfrist ans Licht fördern. In England sind zwischen dem Hitôpadêsa und dem jetzt zur Erscheinung bald fertigen Gesetzbuch des Manus 14 Jahre verflossen.<lb/>Nächst dem Râmâyana ist mein Absehen immer noch auf den Hitôpadêsa gerichtet. Nur fehlt es in Europa leider gar sehr an Manuscripten. Der Baron Schilling von Canstadt aus St. Petersburg besitzt eins aus der Verlassenschaft eines Russen, der schon einmal eine Sanskrit-Grammatik geschrieben. Er brachte im vorigen Herbst einige Tage bei mir zu, versprach mir den Gebrauch des Manuscripts für die Folge, nahm es aber nach Paris mit. Nun ist er, wie ich höre, nach Rom gereist, ohne Zweifel wegen der tibetanischen Handschriften in der Propaganda.<lb/>Sehr hübsch wäre es, wenn man die artigen Mährchenbücher vom Papagei, von den dreißig Statuen am Thron des Vikramâdityas u. s. w. ans Licht stellen könnte. Aber die Handschriften, bei solchen Unterhaltungsbüchern unwissenden Abschreibern anheim gefallen, scheinen in einem heillosen Zustande zu seyn. Ich gedenke nächstens den Satz auszuführen, daß alle eigentlichen Feenmährchen aus Indien herkommen, und daß die Perser (vielleicht schon von der Zeit der Sassaniden her) nichts erfunden, sondern nur manirirte Übertragungen geliefert haben.<lb/>Ich bitte Ew. Excellenz, mich meine Langsamkeit im Briefschreiben nicht entgelten zu lassen, und bin mit der aufrichtigsten Verehrung und unveränderlich ergebenen Gesinnungen<lb/>Ew. Excellenz<lb/>gehorsamster<lb/>AWvSchlegel.<lb/><lb/>Ew. Excellenz haben mich sehr angenehm überrascht durch die günstige Erwähnung meines Calderon, eines ehemaligen Lieblingsdichters, den ich seit langer Zeit so ganz aus den Augen verlor, daß ich nicht einmal die Übersetzungen meiner Nachfolger, der Herren Gries und von Malsburg gelesen. Das Publicum scheint der Meynung zu seyn, daß sie es wenigstens eben so gut machen wie ich, wogegen ich auch nicht viel einzuwenden habe. Nur hat mir bei einem flüchtigen Anblick [geschienen], es fehle dann und wann an Klarheit. Ein gewisser <hi rend="slant:italic">Culteranismo</hi> im Stil des Calderon ist nicht abzuläugnen; dieß muß freilich ausgedrückt werden, wenn das Bild ähnlich seyn soll. Will man es aber zu ängstlich nachbilden, so entsteht leicht ein völliger Galimathias daraus.<lb/><lb/><hi rend="slant:italic">Ad. V. Cl. Philippum a Walther.<lb/>Te vates medicum poscit collyria lippus.<lb/>Phoebus amat vates; is pater est medicis.<lb/>Te genitor flectat, flectant communia sacra:<lb/>Si vis, e lippo Lyncea me efficies.<lb/>Demodocus, Thamyris, caecus fuit ipse et Homerus;<lb/>Non tanti est laurus: carmina iam valeant.<lb/>Sed veterum ad seras evolvere scripta lucernas,<lb/>Et dictis sapientum invigilare iuvat.<lb/>Tunc mihi ne doleant lacrimantia lumina, cura: <lb/>Pro vate haud renuent munera Pierides.</hi></p>', '36_xml_standoff' => 'Bonn den 20sten Junius 1824.<lb/>Ew. Excellenz bitte ich, die verspätete Beantwortung Ihres so belehrenden und aufmunternden Schreibens vom 15ten April gütigst zu entschuldigen. Ich gebe diesen Sommer Vorlesungen, die mir viel Zeit kosten, und mich auch in meinen Brahmanischen Studien nicht so viel thun lassen, als ich wohl wünschte.<lb/>Die Nachricht von einem Augenübel, das Ew. Excellenz erlitten, hat meine lebhafteste Theilnahme erregt. Ich hoffe und wünsche von ganzem Herzen, daß Sie vollkommen und dauerhaft hergestellt seyn mögen. Zu meiner Freude bestätigt ein Zeitungsartikel diese Hoffnung. Es wird aus Berlin gemeldet, daß Ew. Excellenz sich viel mit den neuerworbenen Papyrus-Rollen beschäftigen, und dazu gehören doch gewiß ganz gesunde Augen.<lb/>Die meinigen leisten mir immer gute Dienste, wiewohl sie nun schon Veteranen der Manuscripte sind. Nur bei meinem letzten Aufenthalt in Paris litt ich an einem Augenübel. Mein Zustand wurde ängstlich, ich wandte mich an einen berühmten Oculisten, kam aber, wie es zu gehen pflegt, aus dem Regen in die Traufe. Er schrieb mir Einspritzungen durch den Thränenpunkt vor, eine äußerst peinliche Operation, die ich länger als einen Monat ertragen habe. Als ich zurückkam misbilligte mein vortrefflicher Freund von Walther diese Behandlung höchlich, und wünschte mir Glück, daß mir kein unheilbarer Schaden daraus erwachsen sei. Er versprach mir ein Augenwasser, vergaß es aber, und ich mahnte ihn darum in einigen Lateinischen Versen, die ich beilege. Völlig genesen kann Ew. Excellenz dieser Scherz, die Klage eines Leidensgenossen, vielleicht einige Augenblicke unterhalten.<lb/>Ich bitte recht sehr, die Exemplare von dem letzten Hefte der Indischen Bibliothek doch ja nicht zu schonen. Wir haben deren in Vorrath, und ich weiß keinen besseren Gebrauch dafür. Gerade dieser Theil der mir geschenkten Abhandlung muß für die Hellenisten besonders interessant seyn. Herr Welcker war erstaunt über die vertraute Bekanntschaft mit den Griechischen Grammatikern, welche sich darin kund giebt. Den Berliner Philologen habe ich Exemplare geschickt, auch einigen andern. Aber es stehen immer noch mehrere zu Befehl.<lb/>Leider ist noch kein neues Heft unter der Presse, wie es nach meinem guten Willen längst schon seyn sollte. Wenn ich einmal beim Schreiben bin, so macht es mir großes Vergnügen, aber es geht langsam, und das Anfangen fodert immer einen großen Entschluß. Ich habe allerlei kleine Aufsätze im Sinn.<lb/>Ew. Excellenz Vorschlag wegen des Bhagavad Gita erfodert reifliche Erwägung. Wenn ich nur das Glück haben könnte, mich mit Ihnen darüber zu besprechen, so würde ich es vielleicht besser anzugreifen wissen.<lb/>Ich bin sehr erfreut, Ihren Namen auf meiner Subscribentenliste für den Râmâyana zu haben. Es geht mit der Subscription doch einigermaßen vorwärts, und meine Wünsche und Foderungen sind mäßig. Doch brauche ich wenigstens 120 Subscribenten, um die Kosten zu decken. Es haben sich noch neue Hülfsmittel gefunden. Ein so eben aus Indien zurückgekommener Englischer Militär, der mir auch ein paar Handschriften zum Geschenke gesendet, wiewohl ich ihn nicht persönlich kenne, vertraut meinem Schüler ein sehr seltnes Manuscript des Râmâyana zur Benutzung an. Dieses, zum Theil beträchtlich alt, mit Bildern verziert, hat dem Fürsten von Odeypore (Udayapura) gehört. Es schreibt sich demnach aus der Raj-putana her, einem Lande, woher wir überhaupt noch wenig Handschriften haben. Ich besitze nun schon eine große Anzahl von Varianten des ersten Buches, und glaube in der Geschichte des Textes schon einigermaßen Licht zu sehen. Freilich wird es nöthig seyn, zuweilen das Geschäft des Diaskeuasten mit dem des Kritikers zu verbinden, aber ich hoffe dabei möglichst alle Willkühr zu vermeiden.<lb/><lb/><hi rend="weight:bold">den 26sten Junius</hi>. So geht es mir: diesen vor sechs Tagen angefangenen unbedeutenden Brief habe ich unter mancherlei Störungen immer noch nicht beendigen können. Gestern empfing ich nun Ew. Excellenz Sendung vom 24sten Mai. Ich bemerke ausdrücklich, daß sie einen vollen Monat unterwegs gewesen: denn wäre sie mir so schnell zugekommen, als wir das meiste aus Berlin zu erhalten pflegen, so wäre die lange Versäumniß meiner besten Danksagungen unverzeihlich. Ich habe die Abhandlung sogleich gelesen, aber eine erste Lesung ist wenig für eine so durchdachte Schrift. Der wesentliche Unterschied der Sprachen scheint mir vortrefflich auseinandergesetzt zu seyn. Die Ursprünglichkeit der Flexionen ist freilich der Punkt, über den wir nicht ganz einverstanden sind. Ich möchte beinahe sagen: um so besser! Dieß fodert zu neuer Prüfung auf. Bei so disputabeln Gegenständen muß man auf Widerspruch gefaßt seyn, und wie könnte ich mir einen bessern Gegner wünschen? Ich hatte schon früher den Gedanken, Ew. Excellenz um Erlaubniß zu bitten, einen Brief oder eine Reihe von Briefen über diese Gegenstände an Sie richten und in die Indische Bibliothek einrücken zu dürfen. Vielleicht gäbe dieß dann Ew. Excellenz Veranlassung, mir eine Antwort als neuen Beitrag zu schenken. Nicht alle Sätze meines Bruders möchte ich behaupten, wiewohl seine Forschungen mir die erste Anregung gegeben haben. Meine Ansichten entwickelten sich zuerst bei dem Studium der Geschichte unsrer Sprache vom Gothischen an, und der Entstehungsweise der Romanischen Sprachen; dann kam das Sanskrit hinzu. Ich habe sie bisher immer nur beiläufig zu berühren Gelegenheit gehabt: in der Schrift über das Provenzalische, und neuerdings wieder in der Indischen Bibliothek. Freilich stehe ich dadurch sehr im Nachtheil, daß meine Kenntniß auf eine einzige Familie von Sprachen beschränkt ist; und so gern ich auch das Solonische:<lb/><hi rend="slant:italic">γηράσκω δʼ αἰεὶ πολλὰ διδασκόμενος</hi>,<lb/>zu meinem Wahlspruch mache, so fand ich doch immer noch keine Muße, um das Hebräische wieder anzufrischen, und wenigstens die Anfangsgründe des Arabischen zu erlernen. <lb/>Ew. Excellenz Bemerkung über meine Übersetzung des Bh. G. II, 70 ist vollkommen gegründet. Ich weiß nicht, wo ich die Augen gehabt haben muß, da ich ein langes <hi rend="slant:italic">a</hi> für ein kurzes nahm, wiewohl ich es richtig abgedruckt, und auch in meiner Abschrift von diesem Capitel des Commentars kein Versehen gemacht hatte. Die Übersetzung des <hi rend="slant:italic">achalapratiṣṭhaṃ</hi> muß ich aber in Schutz nehmen, vermöge einer besseren Auctorität als die meinige ist. Sie drückt wörtlich die Erklärung des Srîdharaswâmin aus: <hi rend="slant:italic">anatikrāntamaryādaṃ</hi>. Ich lege die ganze Stelle des Commentars zu <hi rend="slant:italic">sl</hi>. 70 auf einem besondern Blatte bei. Die Übersetzung wäre nun etwa so zu berichtigen: <hi rend="slant:italic">Continuo sese explenti, nec tamen ultra terminos suos redundanti Oceano etc</hi>. Ich bitte Ew. Excellenz, mir doch ja alle Fehler, die Sie bemerken, anzuzeigen. Mit Herrn Bopp’s Beurtheilung in den Göttingischen Anzeigen habe ich Ursache sehr zufrieden zu seyn; nur kann ich ihm schwerlich zugeben, daß in dem Hemistichium <hi rend="slant:italic">sukhaṃduḥ</hi> <hi rend="slant:italic">swaṃbhawō bhāwō</hi> vor dem letzten Worte ein <hi rend="slant:italic">a privativum</hi> ausgefallen, und daß die beiden letzten Wörter als für sich bestehende Begriffe einander entgegengesetzt seyen. Dieß scheint mir die verschiedene Quantität nicht zu erlauben.<lb/>So eben empfange ich zu meiner großen Freude Herrn Bopps Episoden aus dem Maha Bharata. Der Berliner Guß ist ja recht schön ausgefallen. Dieß ist nun also der zweite Sanskrit-Text, den wir Deutsche binnen Jahresfrist ans Licht fördern. In England sind zwischen dem Hitôpadêsa und dem jetzt zur Erscheinung bald fertigen Gesetzbuch des Manus 14 Jahre verflossen.<lb/>Nächst dem Râmâyana ist mein Absehen immer noch auf den Hitôpadêsa gerichtet. Nur fehlt es in Europa leider gar sehr an Manuscripten. Der Baron Schilling von Canstadt aus St. Petersburg besitzt eins aus der Verlassenschaft eines Russen, der schon einmal eine Sanskrit-Grammatik geschrieben. Er brachte im vorigen Herbst einige Tage bei mir zu, versprach mir den Gebrauch des Manuscripts für die Folge, nahm es aber nach Paris mit. Nun ist er, wie ich höre, nach Rom gereist, ohne Zweifel wegen der tibetanischen Handschriften in der Propaganda.<lb/>Sehr hübsch wäre es, wenn man die artigen Mährchenbücher vom Papagei, von den dreißig Statuen am Thron des Vikramâdityas u. s. w. ans Licht stellen könnte. Aber die Handschriften, bei solchen Unterhaltungsbüchern unwissenden Abschreibern anheim gefallen, scheinen in einem heillosen Zustande zu seyn. Ich gedenke nächstens den Satz auszuführen, daß alle eigentlichen Feenmährchen aus Indien herkommen, und daß die Perser (vielleicht schon von der Zeit der Sassaniden her) nichts erfunden, sondern nur manirirte Übertragungen geliefert haben.<lb/>Ich bitte Ew. Excellenz, mich meine Langsamkeit im Briefschreiben nicht entgelten zu lassen, und bin mit der aufrichtigsten Verehrung und unveränderlich ergebenen Gesinnungen<lb/>Ew. Excellenz<lb/>gehorsamster<lb/>AWvSchlegel.<lb/><lb/>Ew. Excellenz haben mich sehr angenehm überrascht durch die günstige Erwähnung meines Calderon, eines ehemaligen Lieblingsdichters, den ich seit langer Zeit so ganz aus den Augen verlor, daß ich nicht einmal die Übersetzungen meiner Nachfolger, der Herren Gries und von Malsburg gelesen. Das Publicum scheint der Meynung zu seyn, daß sie es wenigstens eben so gut machen wie ich, wogegen ich auch nicht viel einzuwenden habe. Nur hat mir bei einem flüchtigen Anblick [geschienen], es fehle dann und wann an Klarheit. Ein gewisser <hi rend="slant:italic">Culteranismo</hi> im Stil des Calderon ist nicht abzuläugnen; dieß muß freilich ausgedrückt werden, wenn das Bild ähnlich seyn soll. Will man es aber zu ängstlich nachbilden, so entsteht leicht ein völliger Galimathias daraus.<lb/><lb/><hi rend="slant:italic">Ad. V. Cl. Philippum a Walther.<lb/>Te vates medicum poscit collyria lippus.<lb/>Phoebus amat vates; is pater est medicis.<lb/>Te genitor flectat, flectant communia sacra:<lb/>Si vis, e lippo Lyncea me efficies.<lb/>Demodocus, Thamyris, caecus fuit ipse et Homerus;<lb/>Non tanti est laurus: carmina iam valeant.<lb/>Sed veterum ad seras evolvere scripta lucernas,<lb/>Et dictis sapientum invigilare iuvat.<lb/>Tunc mihi ne doleant lacrimantia lumina, cura: <lb/>Pro vate haud renuent munera Pierides.</hi>', '36_briefid' => 'Leitzmann1908_AWSanWvHumboldt_2026061824', '36_absender' => array( (int) 0 => array( 'ID' => '7125', 'content' => 'August Wilhelm von Schlegel', 'bemerkung' => '', 'altBegriff' => 'Schlegel, August Wilhelm von', 'LmAdd' => array( [maximum depth reached] ) ) ), '36_adressat' => array( (int) 0 => array( 'ID' => '7317', 'content' => 'Wilhelm von Humboldt', 'bemerkung' => '', 'altBegriff' => 'Humboldt, Wilhelm von', 'LmAdd' => array( [maximum depth reached] ) ) ), '36_datumvon' => '1824-06-20', '36_datumbis' => '1824-06-26', '36_sprache' => array( (int) 0 => 'Deutsch', (int) 1 => 'Griechisch', (int) 2 => 'Lateinisch' ), '36_absenderort' => array( (int) 0 => array( 'ID' => '887', 'content' => 'Bonn', 'bemerkung' => 'GND:1001909-1', 'altBegriff' => '', 'LmAdd' => array([maximum depth reached]) ) ), '36_leitd' => 'Briefwechsel zwischen Wilhelm von Humboldt und August Wilhelm Schlegel. Hg. v. Albert Leitzmann. Halle 1908, S. 170‒176.', '36_status' => 'Einmal kollationierter Druckvolltext ohne Registerauszeichnung', '36_Datum' => '1824-06-20', '36_facet_absender' => array( (int) 0 => 'August Wilhelm von Schlegel' ), '36_facet_absender_reverse' => array( (int) 0 => 'Schlegel, August Wilhelm von' ), '36_facet_adressat' => array( (int) 0 => 'Wilhelm von Humboldt' ), '36_facet_adressat_reverse' => array( (int) 0 => 'Humboldt, Wilhelm von' ), '36_facet_absenderort' => array( (int) 0 => 'Bonn' ), '36_facet_adressatort' => '', '36_facet_status' => 'Einmal kollationierter Druckvolltext ohne Registerauszeichnung', '36_facet_datengeberhand' => '', '36_facet_sprache' => array( (int) 0 => 'Deutsch', (int) 1 => 'Griechisch', (int) 2 => 'Lateinisch' ), '36_facet_korrespondenten' => array( (int) 0 => 'Wilhelm von Humboldt' ), '36_Digitalisat_Druck_Server' => array( (int) 0 => 'AWS-aw-0230-0.jpg', (int) 1 => 'AWS-aw-0230-1.jpg', (int) 2 => 'AWS-aw-0230-2.jpg', (int) 3 => 'AWS-aw-0230-3.jpg', (int) 4 => 'AWS-aw-0230-4.jpg', (int) 5 => 'AWS-aw-0230-5.jpg', (int) 6 => 'AWS-aw-0230-6.jpg' ), '_label' => '', '_descr' => '', '_model' => 'Letter', '_model_title' => 'Letter', '_model_titles' => 'Letters', '_url' => '' ) $doctype_name = 'Letters' $captions = array( '36_dummy' => '', '36_absender' => 'Absender/Verfasser', '36_absverif1' => 'Verfasser Verifikation', '36_absender2' => 'Verfasser 2', '36_absverif2' => 'Verfasser 2 Verifikation', '36_absbrieftyp2' => 'Verfasser 2 Brieftyp', '36_absender3' => 'Verfasser 3', '36_absverif3' => 'Verfasser 3 Verifikation', '36_absbrieftyp3' => 'Verfasser 3 Brieftyp', '36_adressat' => 'Adressat/Empfänger', '36_adrverif1' => 'Empfänger Verifikation', '36_adressat2' => 'Empfänger 2', '36_adrverif2' => 'Empfänger 2 Verifikation', '36_adressat3' => 'Empfänger 3', '36_adrverif3' => 'Empfänger 3 Verifikation', '36_adressatfalsch' => 'Empfänger_falsch', '36_absenderort' => 'Ort Absender/Verfasser', '36_absortverif1' => 'Ort Verfasser Verifikation', '36_absortungenau' => 'Ort Verfasser ungenau', '36_absenderort2' => 'Ort Verfasser 2', '36_absortverif2' => 'Ort Verfasser 2 Verifikation', '36_absenderort3' => 'Ort Verfasser 3', '36_absortverif3' => 'Ort Verfasser 3 Verifikation', '36_adressatort' => 'Ort Adressat/Empfänger', '36_adrortverif' => 'Ort Empfänger Verifikation', '36_datumvon' => 'Datum von', '36_datumbis' => 'Datum bis', '36_altDat' => 'Datum/Datum manuell', '36_datumverif' => 'Datum Verifikation', '36_sortdatum' => 'Datum zum Sortieren', '36_wochentag' => 'Wochentag nicht erzeugen', '36_sortdatum1' => 'Briefsortierung', '36_fremddatierung' => 'Fremddatierung', '36_typ' => 'Brieftyp', '36_briefid' => 'Brief Identifier', '36_purl_web' => 'PURL web', '36_status' => 'Bearbeitungsstatus', '36_anmerkung' => 'Anmerkung (intern)', '36_anmerkungextern' => 'Anmerkung (extern)', '36_datengeber' => 'Datengeber', '36_purl' => 'OAI-Id', '36_leitd' => 'Druck 1:Bibliographische Angabe', '36_druck2' => 'Druck 2:Bibliographische Angabe', '36_druck3' => 'Druck 3:Bibliographische Angabe', '36_internhand' => 'Zugehörige Handschrift', '36_datengeberhand' => 'Datengeber', '36_purlhand' => 'OAI-Id', '36_purlhand_alt' => 'OAI-Id (alternative)', '36_signaturhand' => 'Signatur', '36_signaturhand_alt' => 'Signatur (alternative)', '36_h1prov' => 'Provenienz', '36_h1zahl' => 'Blatt-/Seitenzahl', '36_h1format' => 'Format', '36_h1besonder' => 'Besonderheiten', '36_hueberlieferung' => 'Ãœberlieferung', '36_infoinhalt' => 'Verschollen/erschlossen: Information über den Inhalt', '36_heditor' => 'Editor/in', '36_hredaktion' => 'Redakteur/in', '36_interndruck' => 'Zugehörige Druck', '36_band' => 'KFSA Band', '36_briefnr' => 'KFSA Brief-Nr.', '36_briefseite' => 'KFSA Seite', '36_incipit' => 'Incipit', '36_textgrundlage' => 'Textgrundlage Sigle', '36_uberstatus' => 'Ãœberlieferungsstatus', '36_gattung' => 'Gattung', '36_korrepsondentds' => 'Korrespondent_DS', '36_korrepsondentfs' => 'Korrespondent_FS', '36_ermitteltvon' => 'Ermittelt von', '36_metadatenintern' => 'Metadaten (intern)', '36_beilagen' => 'Beilage(en)', '36_abszusatz' => 'Verfasser Zusatzinfos', '36_adrzusatz' => 'Empfänger Zusatzinfos', '36_absortzusatz' => 'Verfasser Ort Zusatzinfos', '36_adrortzusatz' => 'Empfänger Ort Zusatzinfos', '36_datumzusatz' => 'Datum Zusatzinfos', '36_' => '', '36_KFSA Hand.hueberleiferung' => 'Ãœberlieferungsträger', '36_KFSA Hand.harchiv' => 'Archiv', '36_KFSA Hand.hsignatur' => 'Signatur', '36_KFSA Hand.hprovenienz' => 'Provenienz', '36_KFSA Hand.harchivlalt' => 'Archiv_alt', '36_KFSA Hand.hsignaturalt' => 'Signatur_alt', '36_KFSA Hand.hblattzahl' => 'Blattzahl', '36_KFSA Hand.hseitenzahl' => 'Seitenzahl', '36_KFSA Hand.hformat' => 'Format', '36_KFSA Hand.hadresse' => 'Adresse', '36_KFSA Hand.hvollstaendig' => 'Vollständigkeit', '36_KFSA Hand.hzusatzinfo' => 'H Zusatzinfos', '36_KFSA Druck.drliteratur' => 'Druck in', '36_KFSA Druck.drsigle' => 'Sigle', '36_KFSA Druck.drbandnrseite' => 'Bd./Nr./S.', '36_KFSA Druck.drfaksimile' => 'Faksimile', '36_KFSA Druck.drvollstaendig' => 'Vollständigkeit', '36_KFSA Druck.dzusatzinfo' => 'D Zusatzinfos', '36_KFSA Doku.dokliteratur' => 'Dokumentiert in', '36_KFSA Doku.doksigle' => 'Sigle', '36_KFSA Doku.dokbandnrseite' => 'Bd./Nr./S.', '36_KFSA Doku.dokfaksimile' => 'Faksimile', '36_KFSA Doku.dokvollstaendig' => 'Vollständigkeit', '36_KFSA Doku.dokzusatzinfo' => 'A Zusatzinfos', '36_Link Druck.url_titel_druck' => 'Titel/Bezeichnung', '36_Link Druck.url_image_druck' => 'Link zu Online-Dokument', '36_Link Hand.url_titel_hand' => 'Titel/Bezeichnung', '36_Link Hand.url_image_hand' => 'Link zu Online-Dokument', '36_preasentation' => 'Nicht in die Präsentation', '36_verlag' => 'Verlag', '36_anhang_tite0' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename0' => 'Image', '36_anhang_tite1' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename1' => 'Image', '36_anhang_tite2' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename2' => 'Image', '36_anhang_tite3' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename3' => 'Image', '36_anhang_tite4' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename4' => 'Image', '36_anhang_tite5' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename5' => 'Image', '36_anhang_tite6' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename6' => 'Image', '36_anhang_tite7' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename7' => 'Image', '36_anhang_tite8' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename8' => 'Image', '36_anhang_tite9' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename9' => 'Image', '36_anhang_titea' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcenamea' => 'Image', '36_anhang_titeb' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcenameb' => 'Image', '36_anhang_titec' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcenamec' => 'Image', '36_anhang_tited' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcenamed' => 'Image', '36_anhang_titee' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcenamee' => 'Image', '36_anhang_titeu' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcenameu' => 'Image', '36_anhang_titev' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcenamev' => 'Image', '36_anhang_titew' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcenamew' => 'Image', '36_anhang_titex' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcenamex' => 'Image', '36_anhang_titey' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcenamey' => 'Image', '36_anhang_titez' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcenamez' => 'Image', '36_anhang_tite10' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename10' => 'Image', '36_anhang_tite11' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename11' => 'Image', '36_anhang_tite12' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename12' => 'Image', '36_anhang_tite13' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename13' => 'Image', '36_anhang_tite14' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename14' => 'Image', '36_anhang_tite15' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename15' => 'Image', '36_anhang_tite16' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename16' => 'Image', '36_anhang_tite17' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename17' => 'Image', '36_anhang_tite18' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename18' => 'Image', '36_h_preasentation' => 'Nicht in die Präsentation', '36_anhang_titef' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcenamef' => 'Image', '36_anhang_titeg' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcenameg' => 'Image', '36_anhang_titeh' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcenameh' => 'Image', '36_anhang_titei' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcenamei' => 'Image', '36_anhang_titej' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcenamej' => 'Image', '36_anhang_titek' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcenamek' => 'Image', '36_anhang_titel' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcenamel' => 'Image', '36_anhang_titem' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcenamem' => 'Image', '36_anhang_titen' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcenamen' => 'Image', '36_anhang_titeo' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcenameo' => 'Image', '36_anhang_titep' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcenamep' => 'Image', '36_anhang_titeq' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcenameq' => 'Image', '36_anhang_titer' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcenamer' => 'Image', '36_anhang_tites' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcenames' => 'Image', '36_anhang_titet' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcenamet' => 'Image', '36_anhang_tite19' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename19' => 'Image', '36_anhang_tite20' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename20' => 'Image', '36_anhang_tite21' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename21' => 'Image', '36_anhang_tite22' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename22' => 'Image', '36_anhang_tite23' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename23' => 'Image', '36_anhang_tite24' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename24' => 'Image', '36_anhang_tite25' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename25' => 'Image', '36_anhang_tite26' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename26' => 'Image', '36_anhang_tite27' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename27' => 'Image', '36_anhang_tite28' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename28' => 'Image', '36_anhang_tite29' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename29' => 'Image', '36_anhang_tite30' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename30' => 'Image', '36_anhang_tite31' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename32' => 'Image', '36_anhang_tite33' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename33' => 'Image', '36_anhang_tite34' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename34' => 'Image', '36_Relationen.relation_art' => 'Art', '36_Relationen.relation_link' => 'Interner Link', '36_volltext' => 'Brieftext (Digitalisat Leitdruck oder Transkript Handschrift)', '36_History.hisbearbeiter' => 'Bearbeiter', '36_History.hisschritt' => 'Bearbeitungsschritt', '36_History.hisdatum' => 'Datum', '36_History.hisnotiz' => 'Notiz', '36_personen' => 'Personen', '36_werke' => 'Werke', '36_orte' => 'Orte', '36_themen' => 'Themen', '36_briedfehlt' => 'Fehlt', '36_briefbestellt' => 'Bestellt', '36_intrans' => 'Transkription', '36_intranskorr1' => 'Transkription Korrektur 1', '36_intranskorr2' => 'Transkription Korrektur 2', '36_intranscheck' => 'Transkription Korr. geprüft', '36_intranseintr' => 'Transkription Korr. eingetr', '36_inannotcheck' => 'Auszeichnungen Reg. geprüft', '36_inkollation' => 'Auszeichnungen Kollationierung', '36_inkollcheck' => 'Auszeichnungen Koll. geprüft', '36_himageupload' => 'H/h Digis hochgeladen', '36_dimageupload' => 'D Digis hochgeladen', '36_stand' => 'Bearbeitungsstand (Webseite)', '36_stand_d' => 'Bearbeitungsstand (Druck)', '36_timecreate' => 'Erstellt am', '36_timelastchg' => 'Zuletzt gespeichert am', '36_comment' => 'Kommentar(intern)', '36_accessid' => 'Access ID', '36_accessidalt' => 'Access ID-alt', '36_digifotos' => 'Digitalisat Fotos', '36_imagelink' => 'Imagelink', '36_vermekrbehler' => 'Notizen Behler', '36_vermekrotto' => 'Anmerkungen Otto', '36_vermekraccess' => 'Bearb-Vermerke Access', '36_zeugenbeschreib' => 'Zeugenbeschreibung', '36_sprache' => 'Sprache', '36_accessinfo1' => 'Archiv H (+ Signatur)', '36_korrekturbd36' => 'Korrekturen Bd. 36', '36_druckbd36' => 'Druckrelevant Bd. 36', '36_digitalisath1' => 'Digitalisat_H', '36_digitalisath2' => 'Digitalisat_h', '36_titelhs' => 'Titel_Hs', '36_accessinfo2' => 'Archiv H (+ Signatur)', '36_accessinfo3' => 'Sigle (Dokumentiert in + Bd./Nr./S.)', '36_accessinfo4' => 'Sigle (Druck in + Bd./Nr./S.)', '36_KFSA Hand.hschreibstoff' => 'Schreibstoff', '36_Relationen.relation_anmerkung' => null, '36_anhang_tite35' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename35' => 'Image', '36_anhang_tite36' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename36' => 'Image', '36_anhang_tite37' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename37' => 'Image', '36_anhang_tite38' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename38' => 'Image', '36_anhang_tite39' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename39' => 'Image', '36_anhang_tite40' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename40' => 'Image', '36_anhang_tite41' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename41' => 'Image', '36_anhang_tite42' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename42' => 'Image', '36_anhang_tite43' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename43' => 'Image', '36_anhang_tite44' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename44' => 'Image', '36_anhang_tite45' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename45' => 'Image', '36_anhang_tite46' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename46' => 'Image', '36_anhang_tite47' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename47' => 'Image', '36_anhang_tite48' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename48' => 'Image', '36_anhang_tite49' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename49' => 'Image', '36_anhang_tite50' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename50' => 'Image', '36_anhang_tite51' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename51' => 'Image', '36_anhang_tite52' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename52' => 'Image', '36_anhang_tite53' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename53' => 'Image', '36_anhang_tite54' => 'Titel/Bezeichnung', '36_sourcename54' => 'Image', '36_KFSA Hand.hbeschreibung' => 'Beschreibung', '36_KFSA Kritanhang.krit_infotyp' => 'Infotyp', '36_KFSA Kritanhang.krit_infotext' => 'Infotext', '36_datumspezif' => 'Datum Spezifikation', 'index_orte_10' => 'Orte', 'index_orte_10.content' => 'Orte', 'index_orte_10.comment' => 'Orte (Kommentar)', 'index_personen_11' => 'Personen', 'index_personen_11.content' => 'Personen', 'index_personen_11.comment' => 'Personen (Kommentar)', 'index_werke_12' => 'Werke', 'index_werke_12.content' => 'Werke', 'index_werke_12.comment' => 'Werke (Kommentar)', 'index_periodika_13' => 'Periodika', 'index_periodika_13.content' => 'Periodika', 'index_periodika_13.comment' => 'Periodika (Kommentar)', 'index_sachen_14' => 'Sachen', 'index_sachen_14.content' => 'Sachen', 'index_sachen_14.comment' => 'Sachen (Kommentar)', 'index_koerperschaften_15' => 'Koerperschaften', 'index_koerperschaften_15.content' => 'Koerperschaften', 'index_koerperschaften_15.comment' => 'Koerperschaften (Kommentar)', 'index_zitate_16' => 'Zitate', 'index_zitate_16.content' => 'Zitate', 'index_zitate_16.comment' => 'Zitate (Kommentar)', 'index_korrespondenzpartner_17' => 'Korrespondenzpartner', 'index_korrespondenzpartner_17.content' => 'Korrespondenzpartner', 'index_korrespondenzpartner_17.comment' => 'Korrespondenzpartner (Kommentar)', 'index_archive_18' => 'Archive', 'index_archive_18.content' => 'Archive', 'index_archive_18.comment' => 'Archive (Kommentar)', 'index_literatur_19' => 'Literatur', 'index_literatur_19.content' => 'Literatur', 'index_literatur_19.comment' => 'Literatur (Kommentar)', 'index_kunstwerke_kfsa_20' => 'Kunstwerke KFSA', 'index_kunstwerke_kfsa_20.content' => 'Kunstwerke KFSA', 'index_kunstwerke_kfsa_20.comment' => 'Kunstwerke KFSA (Kommentar)', 'index_druckwerke_kfsa_21' => 'Druckwerke KFSA', 'index_druckwerke_kfsa_21.content' => 'Druckwerke KFSA', 'index_druckwerke_kfsa_21.comment' => 'Druckwerke KFSA (Kommentar)', '36_fulltext' => 'XML Volltext', '36_html' => 'HTML Volltext', '36_publicHTML' => 'HTML Volltext', '36_plaintext' => 'Volltext', 'transcript.text' => 'Transkripte', 'folders' => 'Mappen', 'notes' => 'Notizen', 'notes.title' => 'Notizen (Titel)', 'notes.content' => 'Notizen', 'notes.category' => 'Notizen (Kategorie)', 'key' => 'FuD Schlüssel' ) $query_id = '6744b3f0dafbd' $value = '„Bonn den 20sten Junius 1824.<br>Ew. Excellenz bitte ich, die verspätete Beantwortung Ihres so belehrenden und aufmunternden Schreibens vom 15ten April gütigst [...]“' $key = 'Incipit' $adrModalInfo = array( 'ID' => '2949', 'project' => '1', 'timecreate' => '2013-10-17 13:02:22', 'timelastchg' => '2018-01-11 15:52:48', 'key' => 'AWS-ap-00av', 'docTyp' => array( 'name' => 'Person', 'id' => '39' ), '39_name' => 'Humboldt, Wilhelm von', '39_geschlecht' => 'm', '39_gebdatum' => '1767-06-22', '39_toddatum' => '1835-04-08', '39_pdb' => 'GND', '39_dbid' => '118554727', '39_quellen' => 'NDB@https://www.deutsche-biographie.de/gnd118554727.html#ndbcontent@ ADB@https://www.deutsche-biographie.de/gnd118554727.html#adbcontent@ WBIS@http://db.saur.de/WBIS/basicSearch.jsf@J023-835-2@ Wikipedia@https://de.wikipedia.org/wiki/Wilhelm_von_Humboldt@', '39_geburtsort' => array( 'ID' => '2275', 'content' => 'Potsdam', 'bemerkung' => 'GND:4046948-7', 'LmAdd' => array() ), '39_sterbeort' => array( 'ID' => '10056', 'content' => 'Tegel', 'bemerkung' => 'GND:5007835-5', 'LmAdd' => array() ), '39_lebenwirken' => 'Politiker, Sprachforscher, Publizist, Philosoph Wilhelm von Humboldt wuchs auf Schloss Tegel auf, dem Familienbesitz der Humboldts. Ab 1787 studierte Wilhelm zusammen mit seinem Bruder Alexander an der Universität in Frankfurt (Oder) Rechtswissenschaften. Ein Jahr später wechselte er an die Universität Göttingen, wo er den gleichfalls dort studierenden AWS kennenlernte. 1789 führte ihn eine Reise in das revolutionäre Paris. Anfang 1790 trat er nach Beendigung des Studiums in den Staatsdienst und erhielt eine Anstellung im Justizdepartement. 1791 heiratete er Caroline von Dacheröden, die Tochter eines preußischen Kammergerichtsrates. Im selben Jahr schied er aus dem Staatsdienst aus, um auf den Gütern der Familie von Dacheröden seine Studien der altgriechischen Sprache, Kultur, Kunst und Philosophie fortzusetzen. 1794 zog er nach Jena. Humboldt fungierte als konstruktiver Kritiker und gelehrter Ratgeber für die Protagonisten der Weimarer Klassik. Ab November 1797 lebte er in Paris, um seine Studien fortzuführen. Ausgiebige Reisen nach Spanien dienten auch der Erforschung der baskischen Kultur und Sprache. Von 1802 bis 1808 agierte Humboldt als preußischer Gesandter beim Heiligen Stuhl in Rom. Mit der Aufgabe der konsularischen Vertretung war Humboldt zeitlich nicht überfordert, so dass er genug Gelegenheit hatte, seine Studien weiter zu betreiben und sein Domizil zu einem gesellschaftlichen Mittelpunkt zu machen. 1809 wurde er Sektionschef für Kultus und Unterricht im Ministerium des Innern in Berlin. Humboldt galt als liberaler Bildungsreformer. Zu seinen Leistungen gehören ein neu gegliedertes Bildungssystem, das allen Schichten die Möglichkeit des Zugangs zu Bildung zusichern sollte, und die Vereinheitlichung der Abschlussprüfungen. Als weiterer Meilenstein kann Humboldts Beteiligung bei der Gründung der Universität Berlin gelten; zahlreiche renommierte Wissenschaftler konnten für die Lehrstühle gewonnen werden. Die Eröffnung der Universität im Oktober 1810 fand allerdings ohne Humboldt statt. Nach Auseinandersetzungen verließ er den Bildungssektor und ging als preußischer Gesandter nach Wien, später nach London. In dieser Funktion war er am Wiener Kongress beteiligt. 1819 schied er aus dem Staatsdienst aus und beschäftigte sich weiter mit sprachwissenschaftlichen Forschungen, darunter auch dem Sanskrit und dem Kâwi, der Sprache der indonesischen Insel Java. Wilhelms Bruder Alexander von Humboldt war ein bedeutender Naturforscher, die Brüder Humboldt gelten als die „preußischen Dioskuren“.', '39_namevar' => 'Humboldt, Friedrich Wilhelm Christian Karl Ferdinand von Humboldt, Carl W. von Humboldt, Wilhelm F. von Humboldt, Guillaume de Humboldt, Karl W. von Humboldt, Carl Wilhelm von Humboldt, G. de', '39_beziehung' => 'AWS kannte Wilhelm von Humboldt schon aus Göttinger Studentenzeiten, in Jena begegneten sie sich wieder. Schlegel war 1805 Gast Humboldts in Rom, zur Zeit von dessen preußischer Gesandtschaft. Humboldt und AWS korrespondierten auch über ihre sprachwissenschaftlichen Studien, von großer Kenntnis Humboldts zeugen die ausführlichen brieflichen Diskussionen über das Sanskrit. Humboldt steuerte Aufsätze zu Schlegels „Indischer Bibliothek“ bei. Beide Gelehrte begegneten sich mit großem Respekt, auch wenn sie nicht in allen fachlichen Überzeugungen übereinstimmten.', '39_status_person' => 'Vollständig', '39_sourcename0' => 'AWS-ap-00av-0.jpg', 'folders' => array( (int) 0 => 'Personen', (int) 1 => 'Personen' ), '_label' => '', '_descr' => '', '_model' => 'Person', '_model_title' => 'Person', '_model_titles' => 'People', '_url' => '' ) $version = 'version-01-20' $domain = 'https://august-wilhelm-schlegel.de' $url = 'https://august-wilhelm-schlegel.de/version-01-20' $purl_web = 'https://august-wilhelm-schlegel.de/version-01-20/letters/view/3164' $state = '15.01.2020' $citation = 'Digitale Edition der Korrespondenz August Wilhelm Schlegels [15.01.2020]; August Wilhelm von Schlegel an Wilhelm von Humboldt; 20.06.1824 bis 26.06.1824' $lettermsg1 = 'August Wilhelm Schlegel: Digitale Edition der Korrespondenz [Version-01-20]' $lettermsg2 = ' <a href="https://august-wilhelm-schlegel.de/version-01-20/letters/view/3164">https://august-wilhelm-schlegel.de/version-01-20/letters/view/3164</a>.' $changeLeit = array( (int) 0 => 'Briefwechsel zwischen Wilhelm von Humboldt und August Wilhelm Schlegel. Hg. v. Albert Leitzmann. Halle 1908' ) $sprache = 'Lateinisch' $caption = array( 'exists' => '1', 'content' => 'Digitalisat Druck' ) $tab = 'druck' $n = (int) 1
include - APP/View/Letters/view.ctp, line 329 View::_evaluate() - APP/Lib/cakephp/lib/Cake/View/View.php, line 971 View::_render() - APP/Lib/cakephp/lib/Cake/View/View.php, line 933 View::render() - APP/Lib/cakephp/lib/Cake/View/View.php, line 473 Controller::render() - APP/Lib/cakephp/lib/Cake/Controller/Controller.php, line 968 Dispatcher::_invoke() - APP/Lib/cakephp/lib/Cake/Routing/Dispatcher.php, line 200 Dispatcher::dispatch() - APP/Lib/cakephp/lib/Cake/Routing/Dispatcher.php, line 167 [main] - APP/webroot/index.php, line 109
Bonn den 20sten Junius 1824.
Ew. Excellenz bitte ich, die verspätete Beantwortung Ihres so belehrenden und aufmunternden Schreibens vom 15ten April gütigst zu entschuldigen. Ich gebe diesen Sommer Vorlesungen, die mir viel Zeit kosten, und mich auch in meinen Brahmanischen Studien nicht so viel thun lassen, als ich wohl wünschte.
Die Nachricht von einem Augenübel, das Ew. Excellenz erlitten, hat meine lebhafteste Theilnahme erregt. Ich hoffe und wünsche von ganzem Herzen, daß Sie vollkommen und dauerhaft hergestellt seyn mögen. Zu meiner Freude bestätigt ein Zeitungsartikel diese Hoffnung. Es wird aus Berlin gemeldet, daß Ew. Excellenz sich viel mit den neuerworbenen Papyrus-Rollen beschäftigen, und dazu gehören doch gewiß ganz gesunde Augen.
Die meinigen leisten mir immer gute Dienste, wiewohl sie nun schon Veteranen der Manuscripte sind. Nur bei meinem letzten Aufenthalt in Paris litt ich an einem Augenübel. Mein Zustand wurde ängstlich, ich wandte mich an einen berühmten Oculisten, kam aber, wie es zu gehen pflegt, aus dem Regen in die Traufe. Er schrieb mir Einspritzungen durch den Thränenpunkt vor, eine äußerst peinliche Operation, die ich länger als einen Monat ertragen habe. Als ich zurückkam misbilligte mein vortrefflicher Freund von Walther diese Behandlung höchlich, und wünschte mir Glück, daß mir kein unheilbarer Schaden daraus erwachsen sei. Er versprach mir ein Augenwasser, vergaß es aber, und ich mahnte ihn darum in einigen Lateinischen Versen, die ich beilege. Völlig genesen kann Ew. Excellenz dieser Scherz, die Klage eines Leidensgenossen, vielleicht einige Augenblicke unterhalten.
Ich bitte recht sehr, die Exemplare von dem letzten Hefte der Indischen Bibliothek doch ja nicht zu schonen. Wir haben deren in Vorrath, und ich weiß keinen besseren Gebrauch dafür. Gerade dieser Theil der mir geschenkten Abhandlung muß für die Hellenisten besonders interessant seyn. Herr Welcker war erstaunt über die vertraute Bekanntschaft mit den Griechischen Grammatikern, welche sich darin kund giebt. Den Berliner Philologen habe ich Exemplare geschickt, auch einigen andern. Aber es stehen immer noch mehrere zu Befehl.
Leider ist noch kein neues Heft unter der Presse, wie es nach meinem guten Willen längst schon seyn sollte. Wenn ich einmal beim Schreiben bin, so macht es mir großes Vergnügen, aber es geht langsam, und das Anfangen fodert immer einen großen Entschluß. Ich habe allerlei kleine Aufsätze im Sinn.
Ew. Excellenz Vorschlag wegen des Bhagavad Gita erfodert reifliche Erwägung. Wenn ich nur das Glück haben könnte, mich mit Ihnen darüber zu besprechen, so würde ich es vielleicht besser anzugreifen wissen.
Ich bin sehr erfreut, Ihren Namen auf meiner Subscribentenliste für den Râmâyana zu haben. Es geht mit der Subscription doch einigermaßen vorwärts, und meine Wünsche und Foderungen sind mäßig. Doch brauche ich wenigstens 120 Subscribenten, um die Kosten zu decken. Es haben sich noch neue Hülfsmittel gefunden. Ein so eben aus Indien zurückgekommener Englischer Militär, der mir auch ein paar Handschriften zum Geschenke gesendet, wiewohl ich ihn nicht persönlich kenne, vertraut meinem Schüler ein sehr seltnes Manuscript des Râmâyana zur Benutzung an. Dieses, zum Theil beträchtlich alt, mit Bildern verziert, hat dem Fürsten von Odeypore (Udayapura) gehört. Es schreibt sich demnach aus der Raj-putana her, einem Lande, woher wir überhaupt noch wenig Handschriften haben. Ich besitze nun schon eine große Anzahl von Varianten des ersten Buches, und glaube in der Geschichte des Textes schon einigermaßen Licht zu sehen. Freilich wird es nöthig seyn, zuweilen das Geschäft des Diaskeuasten mit dem des Kritikers zu verbinden, aber ich hoffe dabei möglichst alle Willkühr zu vermeiden.
den 26sten Junius. So geht es mir: diesen vor sechs Tagen angefangenen unbedeutenden Brief habe ich unter mancherlei Störungen immer noch nicht beendigen können. Gestern empfing ich nun Ew. Excellenz Sendung vom 24sten Mai. Ich bemerke ausdrücklich, daß sie einen vollen Monat unterwegs gewesen: denn wäre sie mir so schnell zugekommen, als wir das meiste aus Berlin zu erhalten pflegen, so wäre die lange Versäumniß meiner besten Danksagungen unverzeihlich. Ich habe die Abhandlung sogleich gelesen, aber eine erste Lesung ist wenig für eine so durchdachte Schrift. Der wesentliche Unterschied der Sprachen scheint mir vortrefflich auseinandergesetzt zu seyn. Die Ursprünglichkeit der Flexionen ist freilich der Punkt, über den wir nicht ganz einverstanden sind. Ich möchte beinahe sagen: um so besser! Dieß fodert zu neuer Prüfung auf. Bei so disputabeln Gegenständen muß man auf Widerspruch gefaßt seyn, und wie könnte ich mir einen bessern Gegner wünschen? Ich hatte schon früher den Gedanken, Ew. Excellenz um Erlaubniß zu bitten, einen Brief oder eine Reihe von Briefen über diese Gegenstände an Sie richten und in die Indische Bibliothek einrücken zu dürfen. Vielleicht gäbe dieß dann Ew. Excellenz Veranlassung, mir eine Antwort als neuen Beitrag zu schenken. Nicht alle Sätze meines Bruders möchte ich behaupten, wiewohl seine Forschungen mir die erste Anregung gegeben haben. Meine Ansichten entwickelten sich zuerst bei dem Studium der Geschichte unsrer Sprache vom Gothischen an, und der Entstehungsweise der Romanischen Sprachen; dann kam das Sanskrit hinzu. Ich habe sie bisher immer nur beiläufig zu berühren Gelegenheit gehabt: in der Schrift über das Provenzalische, und neuerdings wieder in der Indischen Bibliothek. Freilich stehe ich dadurch sehr im Nachtheil, daß meine Kenntniß auf eine einzige Familie von Sprachen beschränkt ist; und so gern ich auch das Solonische:
γηράσκω δʼ αἰεὶ πολλὰ διδασκόμενος,
zu meinem Wahlspruch mache, so fand ich doch immer noch keine Muße, um das Hebräische wieder anzufrischen, und wenigstens die Anfangsgründe des Arabischen zu erlernen.
Ew. Excellenz Bemerkung über meine Übersetzung des Bh. G. II, 70 ist vollkommen gegründet. Ich weiß nicht, wo ich die Augen gehabt haben muß, da ich ein langes a für ein kurzes nahm, wiewohl ich es richtig abgedruckt, und auch in meiner Abschrift von diesem Capitel des Commentars kein Versehen gemacht hatte. Die Übersetzung des achalapratiṣṭhaṃ muß ich aber in Schutz nehmen, vermöge einer besseren Auctorität als die meinige ist. Sie drückt wörtlich die Erklärung des Srîdharaswâmin aus: anatikrāntamaryādaṃ. Ich lege die ganze Stelle des Commentars zu sl. 70 auf einem besondern Blatte bei. Die Übersetzung wäre nun etwa so zu berichtigen: Continuo sese explenti, nec tamen ultra terminos suos redundanti Oceano etc. Ich bitte Ew. Excellenz, mir doch ja alle Fehler, die Sie bemerken, anzuzeigen. Mit Herrn Bopp’s Beurtheilung in den Göttingischen Anzeigen habe ich Ursache sehr zufrieden zu seyn; nur kann ich ihm schwerlich zugeben, daß in dem Hemistichium sukhaṃduḥ swaṃbhawō bhāwō vor dem letzten Worte ein a privativum ausgefallen, und daß die beiden letzten Wörter als für sich bestehende Begriffe einander entgegengesetzt seyen. Dieß scheint mir die verschiedene Quantität nicht zu erlauben.
So eben empfange ich zu meiner großen Freude Herrn Bopps Episoden aus dem Maha Bharata. Der Berliner Guß ist ja recht schön ausgefallen. Dieß ist nun also der zweite Sanskrit-Text, den wir Deutsche binnen Jahresfrist ans Licht fördern. In England sind zwischen dem Hitôpadêsa und dem jetzt zur Erscheinung bald fertigen Gesetzbuch des Manus 14 Jahre verflossen.
Nächst dem Râmâyana ist mein Absehen immer noch auf den Hitôpadêsa gerichtet. Nur fehlt es in Europa leider gar sehr an Manuscripten. Der Baron Schilling von Canstadt aus St. Petersburg besitzt eins aus der Verlassenschaft eines Russen, der schon einmal eine Sanskrit-Grammatik geschrieben. Er brachte im vorigen Herbst einige Tage bei mir zu, versprach mir den Gebrauch des Manuscripts für die Folge, nahm es aber nach Paris mit. Nun ist er, wie ich höre, nach Rom gereist, ohne Zweifel wegen der tibetanischen Handschriften in der Propaganda.
Sehr hübsch wäre es, wenn man die artigen Mährchenbücher vom Papagei, von den dreißig Statuen am Thron des Vikramâdityas u. s. w. ans Licht stellen könnte. Aber die Handschriften, bei solchen Unterhaltungsbüchern unwissenden Abschreibern anheim gefallen, scheinen in einem heillosen Zustande zu seyn. Ich gedenke nächstens den Satz auszuführen, daß alle eigentlichen Feenmährchen aus Indien herkommen, und daß die Perser (vielleicht schon von der Zeit der Sassaniden her) nichts erfunden, sondern nur manirirte Übertragungen geliefert haben.
Ich bitte Ew. Excellenz, mich meine Langsamkeit im Briefschreiben nicht entgelten zu lassen, und bin mit der aufrichtigsten Verehrung und unveränderlich ergebenen Gesinnungen
Ew. Excellenz
gehorsamster
AWvSchlegel.
Ew. Excellenz haben mich sehr angenehm überrascht durch die günstige Erwähnung meines Calderon, eines ehemaligen Lieblingsdichters, den ich seit langer Zeit so ganz aus den Augen verlor, daß ich nicht einmal die Übersetzungen meiner Nachfolger, der Herren Gries und von Malsburg gelesen. Das Publicum scheint der Meynung zu seyn, daß sie es wenigstens eben so gut machen wie ich, wogegen ich auch nicht viel einzuwenden habe. Nur hat mir bei einem flüchtigen Anblick [geschienen], es fehle dann und wann an Klarheit. Ein gewisser Culteranismo im Stil des Calderon ist nicht abzuläugnen; dieß muß freilich ausgedrückt werden, wenn das Bild ähnlich seyn soll. Will man es aber zu ängstlich nachbilden, so entsteht leicht ein völliger Galimathias daraus.
Ad. V. Cl. Philippum a Walther.
Te vates medicum poscit collyria lippus.
Phoebus amat vates; is pater est medicis.
Te genitor flectat, flectant communia sacra:
Si vis, e lippo Lyncea me efficies.
Demodocus, Thamyris, caecus fuit ipse et Homerus;
Non tanti est laurus: carmina iam valeant.
Sed veterum ad seras evolvere scripta lucernas,
Et dictis sapientum invigilare iuvat.
Tunc mihi ne doleant lacrimantia lumina, cura:
Pro vate haud renuent munera Pierides.
Ew. Excellenz bitte ich, die verspätete Beantwortung Ihres so belehrenden und aufmunternden Schreibens vom 15ten April gütigst zu entschuldigen. Ich gebe diesen Sommer Vorlesungen, die mir viel Zeit kosten, und mich auch in meinen Brahmanischen Studien nicht so viel thun lassen, als ich wohl wünschte.
Die Nachricht von einem Augenübel, das Ew. Excellenz erlitten, hat meine lebhafteste Theilnahme erregt. Ich hoffe und wünsche von ganzem Herzen, daß Sie vollkommen und dauerhaft hergestellt seyn mögen. Zu meiner Freude bestätigt ein Zeitungsartikel diese Hoffnung. Es wird aus Berlin gemeldet, daß Ew. Excellenz sich viel mit den neuerworbenen Papyrus-Rollen beschäftigen, und dazu gehören doch gewiß ganz gesunde Augen.
Die meinigen leisten mir immer gute Dienste, wiewohl sie nun schon Veteranen der Manuscripte sind. Nur bei meinem letzten Aufenthalt in Paris litt ich an einem Augenübel. Mein Zustand wurde ängstlich, ich wandte mich an einen berühmten Oculisten, kam aber, wie es zu gehen pflegt, aus dem Regen in die Traufe. Er schrieb mir Einspritzungen durch den Thränenpunkt vor, eine äußerst peinliche Operation, die ich länger als einen Monat ertragen habe. Als ich zurückkam misbilligte mein vortrefflicher Freund von Walther diese Behandlung höchlich, und wünschte mir Glück, daß mir kein unheilbarer Schaden daraus erwachsen sei. Er versprach mir ein Augenwasser, vergaß es aber, und ich mahnte ihn darum in einigen Lateinischen Versen, die ich beilege. Völlig genesen kann Ew. Excellenz dieser Scherz, die Klage eines Leidensgenossen, vielleicht einige Augenblicke unterhalten.
Ich bitte recht sehr, die Exemplare von dem letzten Hefte der Indischen Bibliothek doch ja nicht zu schonen. Wir haben deren in Vorrath, und ich weiß keinen besseren Gebrauch dafür. Gerade dieser Theil der mir geschenkten Abhandlung muß für die Hellenisten besonders interessant seyn. Herr Welcker war erstaunt über die vertraute Bekanntschaft mit den Griechischen Grammatikern, welche sich darin kund giebt. Den Berliner Philologen habe ich Exemplare geschickt, auch einigen andern. Aber es stehen immer noch mehrere zu Befehl.
Leider ist noch kein neues Heft unter der Presse, wie es nach meinem guten Willen längst schon seyn sollte. Wenn ich einmal beim Schreiben bin, so macht es mir großes Vergnügen, aber es geht langsam, und das Anfangen fodert immer einen großen Entschluß. Ich habe allerlei kleine Aufsätze im Sinn.
Ew. Excellenz Vorschlag wegen des Bhagavad Gita erfodert reifliche Erwägung. Wenn ich nur das Glück haben könnte, mich mit Ihnen darüber zu besprechen, so würde ich es vielleicht besser anzugreifen wissen.
Ich bin sehr erfreut, Ihren Namen auf meiner Subscribentenliste für den Râmâyana zu haben. Es geht mit der Subscription doch einigermaßen vorwärts, und meine Wünsche und Foderungen sind mäßig. Doch brauche ich wenigstens 120 Subscribenten, um die Kosten zu decken. Es haben sich noch neue Hülfsmittel gefunden. Ein so eben aus Indien zurückgekommener Englischer Militär, der mir auch ein paar Handschriften zum Geschenke gesendet, wiewohl ich ihn nicht persönlich kenne, vertraut meinem Schüler ein sehr seltnes Manuscript des Râmâyana zur Benutzung an. Dieses, zum Theil beträchtlich alt, mit Bildern verziert, hat dem Fürsten von Odeypore (Udayapura) gehört. Es schreibt sich demnach aus der Raj-putana her, einem Lande, woher wir überhaupt noch wenig Handschriften haben. Ich besitze nun schon eine große Anzahl von Varianten des ersten Buches, und glaube in der Geschichte des Textes schon einigermaßen Licht zu sehen. Freilich wird es nöthig seyn, zuweilen das Geschäft des Diaskeuasten mit dem des Kritikers zu verbinden, aber ich hoffe dabei möglichst alle Willkühr zu vermeiden.
den 26sten Junius. So geht es mir: diesen vor sechs Tagen angefangenen unbedeutenden Brief habe ich unter mancherlei Störungen immer noch nicht beendigen können. Gestern empfing ich nun Ew. Excellenz Sendung vom 24sten Mai. Ich bemerke ausdrücklich, daß sie einen vollen Monat unterwegs gewesen: denn wäre sie mir so schnell zugekommen, als wir das meiste aus Berlin zu erhalten pflegen, so wäre die lange Versäumniß meiner besten Danksagungen unverzeihlich. Ich habe die Abhandlung sogleich gelesen, aber eine erste Lesung ist wenig für eine so durchdachte Schrift. Der wesentliche Unterschied der Sprachen scheint mir vortrefflich auseinandergesetzt zu seyn. Die Ursprünglichkeit der Flexionen ist freilich der Punkt, über den wir nicht ganz einverstanden sind. Ich möchte beinahe sagen: um so besser! Dieß fodert zu neuer Prüfung auf. Bei so disputabeln Gegenständen muß man auf Widerspruch gefaßt seyn, und wie könnte ich mir einen bessern Gegner wünschen? Ich hatte schon früher den Gedanken, Ew. Excellenz um Erlaubniß zu bitten, einen Brief oder eine Reihe von Briefen über diese Gegenstände an Sie richten und in die Indische Bibliothek einrücken zu dürfen. Vielleicht gäbe dieß dann Ew. Excellenz Veranlassung, mir eine Antwort als neuen Beitrag zu schenken. Nicht alle Sätze meines Bruders möchte ich behaupten, wiewohl seine Forschungen mir die erste Anregung gegeben haben. Meine Ansichten entwickelten sich zuerst bei dem Studium der Geschichte unsrer Sprache vom Gothischen an, und der Entstehungsweise der Romanischen Sprachen; dann kam das Sanskrit hinzu. Ich habe sie bisher immer nur beiläufig zu berühren Gelegenheit gehabt: in der Schrift über das Provenzalische, und neuerdings wieder in der Indischen Bibliothek. Freilich stehe ich dadurch sehr im Nachtheil, daß meine Kenntniß auf eine einzige Familie von Sprachen beschränkt ist; und so gern ich auch das Solonische:
γηράσκω δʼ αἰεὶ πολλὰ διδασκόμενος,
zu meinem Wahlspruch mache, so fand ich doch immer noch keine Muße, um das Hebräische wieder anzufrischen, und wenigstens die Anfangsgründe des Arabischen zu erlernen.
Ew. Excellenz Bemerkung über meine Übersetzung des Bh. G. II, 70 ist vollkommen gegründet. Ich weiß nicht, wo ich die Augen gehabt haben muß, da ich ein langes a für ein kurzes nahm, wiewohl ich es richtig abgedruckt, und auch in meiner Abschrift von diesem Capitel des Commentars kein Versehen gemacht hatte. Die Übersetzung des achalapratiṣṭhaṃ muß ich aber in Schutz nehmen, vermöge einer besseren Auctorität als die meinige ist. Sie drückt wörtlich die Erklärung des Srîdharaswâmin aus: anatikrāntamaryādaṃ. Ich lege die ganze Stelle des Commentars zu sl. 70 auf einem besondern Blatte bei. Die Übersetzung wäre nun etwa so zu berichtigen: Continuo sese explenti, nec tamen ultra terminos suos redundanti Oceano etc. Ich bitte Ew. Excellenz, mir doch ja alle Fehler, die Sie bemerken, anzuzeigen. Mit Herrn Bopp’s Beurtheilung in den Göttingischen Anzeigen habe ich Ursache sehr zufrieden zu seyn; nur kann ich ihm schwerlich zugeben, daß in dem Hemistichium sukhaṃduḥ swaṃbhawō bhāwō vor dem letzten Worte ein a privativum ausgefallen, und daß die beiden letzten Wörter als für sich bestehende Begriffe einander entgegengesetzt seyen. Dieß scheint mir die verschiedene Quantität nicht zu erlauben.
So eben empfange ich zu meiner großen Freude Herrn Bopps Episoden aus dem Maha Bharata. Der Berliner Guß ist ja recht schön ausgefallen. Dieß ist nun also der zweite Sanskrit-Text, den wir Deutsche binnen Jahresfrist ans Licht fördern. In England sind zwischen dem Hitôpadêsa und dem jetzt zur Erscheinung bald fertigen Gesetzbuch des Manus 14 Jahre verflossen.
Nächst dem Râmâyana ist mein Absehen immer noch auf den Hitôpadêsa gerichtet. Nur fehlt es in Europa leider gar sehr an Manuscripten. Der Baron Schilling von Canstadt aus St. Petersburg besitzt eins aus der Verlassenschaft eines Russen, der schon einmal eine Sanskrit-Grammatik geschrieben. Er brachte im vorigen Herbst einige Tage bei mir zu, versprach mir den Gebrauch des Manuscripts für die Folge, nahm es aber nach Paris mit. Nun ist er, wie ich höre, nach Rom gereist, ohne Zweifel wegen der tibetanischen Handschriften in der Propaganda.
Sehr hübsch wäre es, wenn man die artigen Mährchenbücher vom Papagei, von den dreißig Statuen am Thron des Vikramâdityas u. s. w. ans Licht stellen könnte. Aber die Handschriften, bei solchen Unterhaltungsbüchern unwissenden Abschreibern anheim gefallen, scheinen in einem heillosen Zustande zu seyn. Ich gedenke nächstens den Satz auszuführen, daß alle eigentlichen Feenmährchen aus Indien herkommen, und daß die Perser (vielleicht schon von der Zeit der Sassaniden her) nichts erfunden, sondern nur manirirte Übertragungen geliefert haben.
Ich bitte Ew. Excellenz, mich meine Langsamkeit im Briefschreiben nicht entgelten zu lassen, und bin mit der aufrichtigsten Verehrung und unveränderlich ergebenen Gesinnungen
Ew. Excellenz
gehorsamster
AWvSchlegel.
Ew. Excellenz haben mich sehr angenehm überrascht durch die günstige Erwähnung meines Calderon, eines ehemaligen Lieblingsdichters, den ich seit langer Zeit so ganz aus den Augen verlor, daß ich nicht einmal die Übersetzungen meiner Nachfolger, der Herren Gries und von Malsburg gelesen. Das Publicum scheint der Meynung zu seyn, daß sie es wenigstens eben so gut machen wie ich, wogegen ich auch nicht viel einzuwenden habe. Nur hat mir bei einem flüchtigen Anblick [geschienen], es fehle dann und wann an Klarheit. Ein gewisser Culteranismo im Stil des Calderon ist nicht abzuläugnen; dieß muß freilich ausgedrückt werden, wenn das Bild ähnlich seyn soll. Will man es aber zu ängstlich nachbilden, so entsteht leicht ein völliger Galimathias daraus.
Ad. V. Cl. Philippum a Walther.
Te vates medicum poscit collyria lippus.
Phoebus amat vates; is pater est medicis.
Te genitor flectat, flectant communia sacra:
Si vis, e lippo Lyncea me efficies.
Demodocus, Thamyris, caecus fuit ipse et Homerus;
Non tanti est laurus: carmina iam valeant.
Sed veterum ad seras evolvere scripta lucernas,
Et dictis sapientum invigilare iuvat.
Tunc mihi ne doleant lacrimantia lumina, cura:
Pro vate haud renuent munera Pierides.