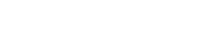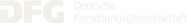Deinen Brief vom 5ten Dec[ember] habe ich nur vor einigen Stunden empfangen. Außer einer gewißen Abspannung, in die mich eine Arbeit, die meine ganze Seele in Feuer setzte, geworfen hatte, ist der Eindruck dieses Briefes auf mich vielleicht Schuld, daß das Einliegende sehr rauh und ungleich geschrieben ist.
Es ist traurig, daß zwischen mir und meinen treuesten Freund eine lange Entfernung tritt, uns unbekannt macht, und in vielen kleinen Momenten endlich nothwendig wirkt; bey mir die Besorgniß, er wolle mir nicht helfen; bey ihm, ich möchte es vielleicht nicht <mehr> verdienen. Wärest Du nur in H.[annover] nicht so [2] ganz abwesend gewesen, hättest Du nur mit Achtung, wenn auch mit Härte, Erläuterung und Rechenschaft von mir gefordert. Nun darf ich kaum hoffen, alles Verdorbne wieder herzustellen, bis ich Dich wiedersehe, und wann wird das seyn? Erst dann wirst Du sehen, daß ich mehr für mich that, als es Dir schien; und in welcher Lage ich war. Ich bin ja gegen niemand so offenherzig gewesen, wie gegen Dich. –
Was Dein leztes Anerbieten betrifft, so war es wohl natürlich, daß ich hoffte – bey meiner Lage. Ich schrieb das meiner Mutter, wie es mir meine Pflicht zu seyn schien; und schrieb Dir mit der größten Ruhe, wann es vielleicht mehr als möglich war, daß ich in vierzehn Tagen vielleicht nicht mehr leben könnte. Und als ich das Leben wählte, dem ich nun unwiederruflich geweiht, da wußte ich auch, daß ich Leben oder – Todt wählte. Es braucht dahin nun wohl iezt gar nicht zu kommen, da ich allenfalls Festigkeit genung habe, über eine Art von Schande erhaben zu seyn. –
Du hast iezt eine richtige Vorstellung von der Wichtigkeit der Sache. Wenn Du nur Dich verbürgen willst, so halte ich noch nichts für verloren, und dächte es müßte Dir nichts leichter seyn, als selbst in A.[msterdam] die Sache zu machen; das braucht [3] ja iezt gleich gar nicht die ganze Summe zu seyn. Solltest Du nicht iezt gleich 300 oder doch 200 Florins geborgt bekommen.* Vielleicht finde ich nachher selbst Hülfe; denn Aufschub finde ich wohl, wenn ich nur etwan 150 Thl. hätte. – Mit Recht kann ich gegen Ostern etwas auf mein Verdienst rechnen. Ich habe die größte Hoffnung die Uebersetzung des Gorani zu bekommen, andrer Dinge nicht zu erwähnen, auf die ich grade nicht rechnen will. – Das muß ich Dir doch noch sagen, daß ich mir seit dem October unglaubliche Mühe wegen des Uebersetzens gegeben habe: und da ich an der Quelle bin, und iezt Wege und Connexionen ein wenig beßer weiß, so muß es mir wohl gelingen, sollte es auch mit dem Gorani fehlschlagen.
Mit Lottchen ist es aber durchaus nichts. Sie hat weder den Willen noch die Mittel; obwohl sie unermüdet ist, mir kleinere Dienste zu erweisen. –
Ob Dir das möglich ist, das bitte ich Dich nun in Ueberlegung zu nehmen. Kannst Du 300 bis 350 Florins iezt schaffen, so gewinne ich vollkommen Zeit; und auch Du um, etwa noch bey M[astiau]x es weiter zu versuchen. Denn wenn das auch geht, so ist das doch gewiß nun zu spät.
[4] Du machst mir einen Vorwurf über meine politische Lectüre. Ich gestehe Dir, daß ich Abends oft eine Stunde sehr abgespannt bin, oder auch wohl Mittags nach Tische, und da brauche ich Nahrung, und keine paßt so in mein ietziges und meine künftigen Plane. In der Geschichte möchte ich leicht eine beträchtliche größere Belesenheit haben, wie Du glaubst. Du weißt, was ich alles getrieben, hier in L[eipzig]. Es sind das auch Entwürfe auf die Zukunft hinaus; es könnte freylich wohl kommen, daß wenigstens der Anfang schon in einem halben oder ganzen Jahre in Dr.[esden] gemacht wird – Du kannst leicht denken, daß es mir höchst wichtig seyn wird, einen politischen guten Ruf zu haben. Sey deshalb außer Sorgen; wenigstens meine nächsten historischen Arbeiten können damit gar nicht zusammentreffen.
Es liegt gewiß an mir, wenn Du nicht rechte Vorstellungen von meinen Arbeiten und Planen hast. Ich will indeßen nur mit der trocknen Notiz fortfahren; nimm Du Dir daraus, was Du willst und kannst. Mein erster Vorwurf sind einige Abhandlungen, die ich durch Körner in die Thalia befördern laße. [5] Ueber die Moralität (Philosophie) der griechischen Tragiker. – Ueber die Nachahmung der Griechischen Dichter (besonders der Atheniensischen). Apologie des Aristophanes – vielleicht, Du siehst daß diese Abh.[andlungen] zusammen gehören, und sie werden auch wohl zugleich fertig werden. Die mittelste könnte leicht ziemlich stark werden. – Eine Uebersetzung fürs erste des Orestes (Choephoren) und der Eumeniden des Aeschylus; eine U[ebersetzung] des ganzen gehört seit einem Vierteljahre, so lange ich mich mit diesen Gegenständen beschäftige, unter meine großen Plane. – Vieles, was dem nicht unähnlich, ist noch ohne Namen, und ich kann nichts davon melden. – Bey dem, was ich Dir in Hann[over] ankündigte, bleibts.
Car.[oline] hat mir nicht viel Zeit geraubt, aber wohl die Sorge für meine Lage. – Car.[olines] Meynung ist seit der lezten Zeit von großem Werthe für mich gewesen, was mich über alles stärkte und freute. Auf ihre Dankbarkeit habe ich doch eigentlich gar keine Ansprüche, aber sie hat meine Freundschaft <auf immer>. Ich bin durch sie beßer geworden, und das weiß sie vielleicht nicht.
Was die Auslagen betrifft, so muß ich wiederhohlen, was ich schon so oft geschrieben. [6] Erstlich daß Du mir natürlicherweise nichts schuldig bist. Daß es mir freylich Kosten gemacht, die ich aber nur ohngefähr angeben kann. Drittens kann ich unmöglich annehmen, daß Du mir für Besuche, die mir Vergnügen machten, etwas ersetztest.
Lebe recht wohl, mein Bester, die Augen fallen mir nicht vor Schlaf zu, aber wohl vor Mattigkeit.
Den 11ten Dezember 1793.
Sey versichert, daß meine Entschlüße für Dr.[esden] sehr strenge und unwandelbar sind. Hier hilft es wenig oder nichts; ich kann ein Logis nicht räumen, was ich nicht bezahlt: ich kann von Leuten nicht abgehen, denen ich sehr lange schuldig bin. Und endlich würde eine auffallende Reform mich um den Credit bringen, der mich denn doch noch retten kann, wenn er mich auch tiefer hineinstürtzt. Glaube aber, daß ich thue, was ich kann.
[7] Ich wollte erst Bürgers Gedichte noch einmal lesen, Dir antworten, und wenigstens Dich überführen, wie schwer es ist, das gerechteste Lob dem Fremden zu beweisen, und wie bequem es ist aus der Ferne mit Witz, mit Scharfsinn, ja mit einer Art von Wahrheit zu tadeln und zu spotten, kurz Alles – nur nicht den Geist des Dichters zu faßen. Wenn ich dieß von Dir bey Schiller und Klopstock nicht erwarte, so fühle ich auch mein Unvermögen, Bürgern völlig treffend zu beurtheilen. Ich gebe Dir nur blos meine Gründe an, warum er mir so wenig bedeutend ist; nicht um Dir etwas Neues zu sagen, nur um Dir deutlich zu machen, welchen Eindruck er auf mich macht – und das nur blos aus der Erinnrung. – Erstlich finde ich in seinen poetischen Gedichten nur gemeine Wahrheit. Mit dem Gemeinen meyne ich etwas, das zwischen dem Schönen und dem Häßlichen in der Mitte liegt, dem lezten aber näher ist. Du sagst, die Natur sey niemals gemein, sondern nur die Abartung von derselben. Dieß läuft aber am Ende auf einen Wortstreit hinaus; wenn Du mir nehmlich nur zugiebst, daß das Häßliche <und Gemeine> wirklich vorhanden ist; da ich aber alles Vorhandne für natürlich halte, so auch das Häßliche. – Seine Liebe, Leidenschaft und Genuß finde ich nicht natürlich (in Deinem Sinne des Wortes) sondern ganz modern und oft häßlich. – Ich erkenne sehr oft kräftige, frische leichte Darstellung <in seinen Gedichten dieses Inhalts>; daß er zu[8]weilen, sehr schönen Stoff, der sich ihm aber doch anbot, nicht verdarb, <wie z. B. bey dem Liebesgeflüster,> wozu er sonst so viel Talent hat. – Grazie, glaube ich, legst Du ihnen zu freygebig bey. Ich wenigstens würde für Amor ein Landschaftsmahler von Göthe alle hingeben. – Ich kann Dir zugeben, daß B.[ürger] in einigen seiner Romanzen ein Originale-Höchstes erreicht habe, aber nicht daß ihm dieß auf den Namen eines großen Dichters gültigen Anspruch giebt, und ich wüßte nicht, was ein Originale-Höchstes für einen Grund anführen könnte, sich schon deshalb, daß es das ist, dem Richtstuhl der Muse zu entziehn. Ich würde es nicht einmal wagen, Jacobi einen großen Dichter zu nennen. Ist die Darstellung der Amli, und Sylly des Allwills und der übrigen ein Originale-Höchstes? und von mehr innerm Werthe, als die äußerst beschränkte Romanzenwelt Bürgers? – Ich gestehe Dir, daß die Griechen und Göthe mir volksmäßig genung sind, und daß die Volkspoesie des Percy u.s.w. für mich – zur gelehrten Litteratur gehört, bis auf äusserst wenige Ausnahmen. Was den Toriden betrifft, so finde ich wahre Poesie in Deiner Darstellung, aber durchaus nicht in der Seele des Gassenbuben. – Aber sagt mir doch ihr Naturherren, wie ist es nur möglich, daß Dante dem Volke verständlich sey? – Und [9] wenn der grobe Leib der Shakespearschen Dichtungen sehr sichtbar ist, sage selbst, ist sein Geist nicht so wunderbar, und zart, daß er selbst denen zu entschlüpfen scheint, die durch den seltensten Zusammenfluß heterogener Eigenschaften allein bestimmt scheinen, ihn faßen zu können? – Ihr versichert uns, daß diejenigen Volksdichter sind, deren Entstehung unter und Zusammenhang mit ihrem Volke und ihrer Zeit unter die Räthsel der Geschichte gehört! Die Atheniensischen Dichter hingegen gehören ganz ihrem Volke, und waren wohl jedem ihrer Landsleute, der etwas Gefühl und Bildung hatte, verständlich. – Daß Bürger die Gabe hat, seine schönsten Werke zu verunstalten, und Plattheiten von sich zu geben, wirst Du wohl nicht läugnen, denn ich wüßte es nicht wie man seine Epigramme anders benennen könnte. Und eben so wenig kannst Du wohl angeben, was Edles in seinem Leben ist. – Es läßt sich voraussehen, daß wer Bürger einen großen Dichter nennt, die Gabe des Dichters ausschließlich in Darstellung setzen wird. Dem kann ich nicht beystimmen. Klarheit, Bestimtheit, Kürze, Leichtigkeit u.s.w. kurz alle negativen Tugenden der Rede erheben sie noch nicht zur Poesie. Das Einzige Dichterische, was ich in B[ürger]s Darstellung an[10]erkenne, ist Leben: aber Leben ist nur ein Element der Schönheit und nicht Schönheit selbst. Frage Dich selbst, ob Du unpartheyisch bist. Du thust Dir selbst Unrecht, mit B.[ürger] gemeine Sache zu machen, solltest Du auch nie seinen Ruhm erwerben wollen. Deine Dankbarkeit ehre ich, aber ich weiß gar nicht worauf sie sich eigentlich gründet? – Auf die Gedichte, die Du in der Zeit machtest, da Du am meisten mit ihm lebtest, legst Du selbst keinen Werth mehr, einige Sonnette ausgenommen. In Deiner Prosa aber und in Deinem Gespräche bemerkte man allgemein (ich selbst konnte damals noch nicht urtheilen) Etwas das gar nicht liebenswürdig war, und an Bürger erinnerte, der wahrlich auch nicht liebenswürdig ist. – Seit Du Car.[oline] liebtest, und wie Du nachher den Dante kennen lerntest, stieg Dein Geschmack zu einer Höhe, die B.[ürger] vielleicht nicht zu begreifen fähig ist; und diesen verdankst Du gewiß reines Gutes – nicht mit so eckelhaften Zusätzen vergiftet. – Alsdann hast Du gewiß keine rechten Vorstellungen von deutschem Publicum und Geschmack. Dein Eifer gegen Schiller gründet sich auf die Furcht, er möchte schaden. Sey sicher, er ist noch viel zu gut! Bürgerʼs Fall aber war auch ohne die Rec[ension] gewiß.
[11] Du schriebst mir den 15ten Februar 1790. – ‚Indeßen bitte ich Dich, ein Buch zu lesen, das mich iezt – mächtig traf. Es ist Dom Karlos. Wenn Du mit dem Buche sympathisirst, so wirst es Du auch mit mir. Laß Dir das nicht fremde oder gar stolz klingen. – Es ist nicht – sondern den Dichter liebe ich, wie er sich allenthalben in seiner Darstellung verräth. Ich liebe den Sinn, mit welchem er die Dinge des menschlichen Lebens auffaßt, das Maaß, mit welchem er sie mißt, finde Beydes ächt menschlich, und möchte es ganz zu dem meinigen machenʻ. – Ich habe Schiller nie geliebt, Klopst[ock] lange gar nicht sehr geachtet; vielleicht bin ich eben deshalb um so mehr gerecht gegen sie, seit der Zeit, da ich auch andre Dichter verstehe, als die meinem eigenthümlichen Geschmack besonders analog sind. – Und nun bitte ich Dich, laß uns diesen Streit auf immer aufgeben; hast Du noch etwas über B.[ürger] zu sagen, so werde ich es gern lesen denn gewiß wirst Du über ihn nicht blos mit Witz schreiben, aber ich werde es nicht beantworten. Gabe und Kunst der Darstellung, Leben hat er in so hohem Grade, seine Erfindung ist in ihrem beschränkten Kreise so vollendet, daß ich allenfalls zugeben kann, er hat Genie aber nie, daß er Genie wie Klopstock und noch mehr Schiller. Daß der lezte auch im Leben ein höchst außerordentlicher Mensch ist, davon habe ich viele Beweise. Ich kenne [12] viele, denen er sich mittheilte; und wenn es mir mannichmal schien, daß er seinen Anhängern einen gewißen Stempel aufdrückte; so war doch sein Einfluß immer so mächtig, wie nur der eines sehr überlegnen Geistes seyn kann: nicht selten sehr vortheilhaft, und fast immer traf er Menschen, die auch mir von vorzüglichem Werth schienen. – Das sind nun meine Resultate; aber damit Du Dir keine falschen Gedanken machst – ich bewundre eigentlich keinen <deutschen> Dichter als Göthe. Und doch ist er vielleicht nicht grade durch Uebermacht des Genies so unendlich weit über jene beyden erhaben als durch Etwas Andres. Etwas, das er doch nur beynahe hat, was allein den Griechischen vorzüglich den Atheniensischen Dichtern eigenthümlich ist. –
Auch über die deutschen Critiker ist mein Urtheil nicht dem Deinigen gleich. Ich gestehe Dir, ich fand in Engels Poetik nichts als etwas Scharfsinn und Eleganz, in Lessings critischen Schriften wenig mehr, und wenn einmal von Arbeiten die Rede ist, so halte ich die von Heydenreich für eine der brauchbarsten. In Herder finde ich großen Geschmack, aber er scheint mir nur errungen, wiewohl nicht so mühsam wie bey Moritz. Weniger Geschmack aber etwas das ich critisches Genie nennen möchte, finde ich in Klopstockʼs Fragm[enten] und Gespr[ächen], in Kants Critik [13] der Urtheilskraft, und – in Schillers aesthetischen Abhandlungen. Mit gewißen Einschränkungen laße ich allen Deinen Tadel und Spott wieder den lezten gelten, und bemerke noch daß zwischen dem Felde, was Kant und Klopstock bearbeitet haben, ein sehr großer Zwischenraum ist, und also noch genung zu thun übrig ist. – Ich habe Dir hier mit Fleiß wieder nur Resultate gegeben (à la Klopstock) denn die Ausführung hielte uns von wichtigern Dingen ab. – Es giebt sehr viele interessante Stellen in Deinen lezten Briefen, worüber ich es gerne mehr zur Sprache bringen möchte; aber unter diesen ist mir doch nichts so wichtig als Prosodie und Verskunst, weil ich hier mir selbst nicht so leicht forthelfen kann, und hoffen darf von Dir vielleicht zu lernen, was ich in Büchern nicht finden werde. Obgleich ich schon eine sehr starke Vorliebe für die Griechischen Versarten habe, so verspreche ich Dir doch, die Sache noch einmal von Grund aus zu prüfen. Und damit es Dir wichtiger wird, mich zu bekehren, so will ich Dir sagen, daß sonst Gefahr vorhanden, Caroline möchte in diesem Puncte zu mir übergehen. Ich bitte Dich also um eine vollständige Lehre und Deduktion vom Reime. In Moritz Prosodie habe ich nicht sehr viel Belehrung gefunden. – Ich bitte Dich, mir zu bestimmen, was in der Verskunst, willkührlich schöne Form und welche Gesetze Du dieser giebst. Was hingegen gleichsam – nothwendig; was nehmlich zum vollkommensten Ausdruck wesentlich gehört. Ferner [14] ob es eine Wahl nach deutlichen Begriffen, oder nach dunkeln Gefühle ist, nach welcher der Künstler für seinen Stoff, den nothwendigen Theil des Versmaaßes wählt. Freylich weiß ich wohl, daß wohl oft beydes zugleich ans Licht tritt. Aber die Fiktion ist zur Theorie brauchbar. – Du sagst, es hätten so viele Völker mit feinem Sinn für Schönheit begabt, ihn gebraucht. Das kann ich nicht wohl gelten laßen. Wo ist das Volk deßen Charakter Sinn fürs Schöne wäre. Ich hoffe Du wirst mir den Beweis schenken, daß alle modernen Völker sehr häufig, Jahrhunderte hindurch, mit der größten Uebereinstimmung, etwas verehrt, geliebt, angebetet haben, was sehr häßlich und schief war: in Kunst, Wißenschaft, Sitten, Verfaßungen, Religion kurz in allem was nur Namen hat. – Ueberspannung ist daher meine demüthigste Meynung wohl nicht, daß kein Volk außer den Griechen, Geschmack hatte. Es ist etwas sehr Großes, was ich meyne, grade das, was dieß Volk über alle Andre erhebt; jedoch spricht es den übrigen nicht ab große, vielleicht größre Kraft, hohe Bildung, Erhabenheit und Feinheit, ja selbst nicht die Fähigkeit der Einzelnen, jene Schönheit des Lebens zu erreichen. Ich weiß Dir wirklich aber keinen einzigen modernen Helden zu nennen, an dem...
Die Fortsetzung nächstens.
[3] * giebt Dir die Veränderung in unsrer Familie nicht Anlaß, das ohne Dir was zu vergeben, unter gewißen Bedingungen von Muilm[an] selbst zu verlangen; kannst Du nicht gradezu den wahren Grund angeben, um etwas für einen jungen Bruder zu thun, für den die Familie nicht sorgen kann?