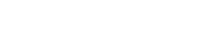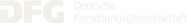Seien Sie mir in dieses neue Jahr schönstens und bestens gegrüsst, liebster Wilhelm! Möchte es doch sein Versprechen halten, welches es uns zwar kalt und blutig, dennoch hoffnungsvoll in seinem Anfang gab, so wäre uns ja wohl allen geholfen. – Es will mir gar nicht in den Kopf, dass ich so weit weg, über Meer an Sie schreiben soll; es ist mir, als schriebe ich nach einer andern Welt. Ich habe erst eine Weile vor Ihrer Büste gestanden, um es mir etwas bekannter werden zu lassen, dass ich an Sie schreibe. Sie stehen da recht herrlich, in einem zierlichen Glaskasten, mitten unter uns und sehen so täuschend ähnlich, so sprechend aus, dass wir jeden Augenblick warten, dass Sie etwas sagen werden. Das ist aber auch die einzige Unähnlichkeit dieser Büste mit Ihnen, lieber Bruder, dass sie so stumm ist und mit alle ihrem geistreichen und liebenswürdigen Aussehen und Ansehen uns ganz und gar nichts zu sagen weiss. Dennoch ist sie uns eine recht angenehme, recht tröstliche Gegenwart mit ihrer theilnehmenden Miene, und ich danke Ihnen und dem Künstler sehr dafür.
Wir haben einen Brief gesehen, den Ihre Reisegefährtin aus dem Orte ihres jetzigen Aufenthaltes hergeschrieben hat. Er klang wie ein Ruf aus einer bessern Welt zu uns armen Zurückgebliebenen herüber, als ob sie vom seligmachenden Lethe getrunken und alle verwirrenden Missverhältnisse und allen Unsinn des Hierseits rein vergessen hätte. Ja ja, es kann noch wohl mancher Regen und mancher Sonnenschein bei uns wechseln, bevor diese Sprache an der Tagesordnung scheint. Friedrich und mir aber war dieser Ton Musik; es ist eine herrliche Bestätigung der Hoffnungen, die wir von dort her haben. Möchten wir doch das Wohlgelingen dieser Hoffnungen erleben!
Ihnen geht es also in allen Stücken gut, ausgenommen in einem Stück; uns hier geht es, dieses eine Stück ausgenommen, in allem übrigen ziemlich schlecht. Wer ist nun zu beklagen, wer zu beneiden? – Das ‚Museum‘ hat seinen ersten Jahrgang glücklich durchgebracht und Ihrem Wunsch gemäss den zweiten angefangen. Gern gestehe ich Ihnen aber, dass, wenn ich durch mein Zureden etwas beigetragen habe, dass es fortgesetzt wird, es einzig und allein in Rücksicht auf Ihren Wunsch geschah und in der Hoffnung, dass Sie bald zurückkehren und thätigen Antheil daran nehmen werden. Für unsern Friedrich, glaube ich, ist ein solches immer wiederkehrendes regelmässiges Geschäft, wie die Redaction einer Zeitschrift, nicht eben gemacht, und der vielfältige, einmal nicht auszuweichende Verdruss bei einem solchen Geschäft, wo man mit so vielen, natürlich grösstentheils eigennützigen und beschränkten Menschen zu thun haben muss, zerstört seinen ganzen Frieden. Auch ist es nicht seine Sache, wie Sie wohl wissen, zur bestimmten gehörigen Zeit eine Arbeit wirklich vollendet zu haben. Kurz, dieses ‚Museum‘ nimmt seine ganze Zeit in Beschlag und so viel bringt es ja bei weitem nicht ein. Mit rechtem Schmerz und oft – bei der so nahe liegenden Betrachtung über den schnellen Flug der Zeit – mit rechter Herzensangst sehe ich alle seine angefangenen, theils besprochne, theils beabsichtigte Werke weit, weit zurückgeschoben. Das ist das ‚Museum‘ nicht werth, besonders da wirklich ausser Ihren und Friedrichs Arbeiten nicht gar viel besonders von andern darin steht; und bei alledem, dass es meistens nur mittelmässige Produkte sind, ist es doch die strengste Auswahl. Sie würden lachen und doch sich wieder betrüben müssen, wenn Sie das Zeugs sähen, das man einzurücken zumuthet.
Recht ein Zeichen der Zeit ist es auch, dass man Friedrich hier zu nichts braucht, dass man so gar nichts mit ihm anzufangen weiss. Wessen Schuld es ist, das weiss ich nicht. So viel ist gewiss, dass alles, was man Ihnen bei Ihrem Hiersein für schöne Redensarten darüber an den Tag gelegt hatte, bloses leeres Geschwätz ist. Man denkt nicht an ihn. – Für Adam Müller geschieht hier sehr viel vom Erzherzog Maximilian. Er hat ihn jetzt unter seinem Schutz eine Erziehungsanstalt für junge Edelleute anlegen lassen, bei welchem für’s erste die Finanzen sich sehr gut befinden, das Uebrige wird sich auch wohl finden. Müller hat eine Anzahl subalterner Lehrer aller Art dabei angestellt. Friedrich mit hineinzuziehen, das hat er bleiben lassen. Anfangs ärgerte uns das, im Grunde aber können wir froh darüber sein. Er hat mit vielen Neidern und Widersachern aller Art zu kämpfen. Wer weiss, ob die Anstalt wirklich sich befestigt.
Meine beiden jungen Freundinnen, Nina und Franziska, sprechen von niemand so gern und hören von niemand lieber als vom Bruder Wilhelm. So schreibt auch die Schwester in Paris keinen Brief, in welchem dieser Bruder und seine Angelegenheit nicht einen grossen Platz einnehmen. Wenn Sie sich also immer noch beklagen, nicht geliebt zu werden, so können Sie doch nicht sagen, dass es nicht in der Entfernung geschieht, und einer solchen Liebe können doch gewiss wenige Männer sich rühmen.
Der junge Körner aus Dresden ist k. k. Hoftheaterdichter geworden. Das wird nun wohl so viel heissen, als er wird früher noch, als sonst geschehen wäre, recht sanft wieder eindämmern in die allerkotzebueschte Gewöhnlichkeit. Ohne diese Fortune, die er wohl seiner Handfertigkeit und seinem familiären Umgang mit den Schauspielern verdankt, hätte er sich vielleicht doch noch um einige Stufen höher bringen können. Dies wäre ein vortreffliches Amt für einen ausgemachten Dichter gewesen, der sich des Theaters hätte annehmen wollen; für einen jungen Menschen wie Körner ist es aber gradezu ein Verderb, ohne dass die Bühne etwas dabei gewinnen wird. Er überschwemmt jetzt das Theater mit Dramen aller Art, die bei ihm wie Pilze aufschiessen, in welchen, er mag nun sein Thema aus der Geschichte oder aus der Conversation, aus der Phantasie oder aus der Zeitung nehmen, ihm nichts deutlich vorschwebt als die Katastrophe, die manchmal eine wahre Explosion ist, wie in seinem ,Zriny‘, wo alles in die Luft gesprengt wird. Die drei, vier oder auch fünf Acte vorher sind nichts als Zubereitungen zu einem solchen Feuerwerk. In Wien heisst er allgemein „der zweite Schiller.“ Sie meinen ihn damit sehr zu ehren, eigentlich aber geben sie ihm diesen Beinamen, weil ihnen Schiller ganz natürlich bei diesen Dramen einfallen muss, da er aus lauter Reminiscenzen von Schiller besteht. Auch liest er nichts als Schiller und kennt ausser Kotzebue keinen andern Dichter als höchstens Werner, den er sehr beneidet um gewisse Grauslichkeiten, die ihm noch immer nicht so recht gelingen wollen.
Wir haben ,den vierundzwanzigsten Februar‘ gelesen und Ihrer fleissig dabei gedacht, wie Sie den Kurt wohl mögen dargestellt haben. Meiner Meinung nach ist das wohl von Werner das vollendetste Werk, aber leugnen kann ich nicht: Er ist mein Dichter nicht, nach diesem Werk weniger als je. Nie habe ich mich gegen jemand, der in der That ein Dichter ist, so feindlich gestimmt gefühlt; er ist meine ganze Antipathie. Es ist kein Leben, kein warmer Hauch, keine Natur, kein Glauben und kein Gefühl, keine andre Bewegung, als die man bei einem todten Frosch noch durch den Galvanismus hervorzuckt. Es ist die Sünde und die kalte, kalte Hölle! Pfui! – Das ganze schreckliche, unabwendbare Schicksal der Griechen ist sanft und tröstlich dagegen, weil man es bei jenen wohl fühlt, dass dieser Aberglaube bei ihnen wirklich Glaube war, und wo nur der ist, da hat auch jedes Verhängniss etwas beruhigendes, heilendes. Aber bei Werner ist es weder Glaube noch Aberglaube, sondern kaltes beobachtendes convulsivisches Nichts, der lähmende, starrende Tod im Innersten. Hätte er wenigstens diesen Stoff in eine Ballade oder Romanze gebracht – die Vergangenheit wird durch die Gegenwart des Erzählenden gemildert – aber diese Greuel so zu vergegenwärtigen, wie gefühllos, welch ein Scheusal! – Er ist jetzt in der That und wie man sagt, ernstlich zur katholischen Kirche übergegangen. Ist dem so, dann habe ich Hoffnung für ihn, dass ihm der Sinn für die Schönheit aufgehen wird, der ihm jetzt sehr fern zu sein scheint; dann wird er diese Missgeburten aber gewiss ebenso verabscheuen wie ich. Wie konnte sich Ihr schönes Herz entschliessen, in einem solchen Stück eine Rolle zu übernehmen!
Dagegen lebt jetzt ein andrer Freund von Ihnen auf, der alte Pellegrin, Ihr Schüler und wahrhafter Verehrer Fouqué. Dieser schreibt ganz treffliche Sachen. Er hat jetzt einen Ritterroman geschrieben, ,der Zauberring‘, und nun kann man sagen, dass die Deutschen einen Roman haben, den man den besten andrer Nationen an die Seite setzen kann. In seinen ,Jahrszeiten‘ sind auch ganz unvergleichliche Märchen und Novellen von ihm. Dabei ist er so wahrhaft, so liebend und treugesinnt. Es ist ein rechter Meister, und wir mögen uns Glück zu ihm wünschen. Seine Frau schreibt auch vieles, manches recht gute; sie selber aber ist mir nicht so lieb als ihr Gemahl. Sie rühmt sich in einem Briefe an Friedrich, dass Sie sehr leicht von der Freundin sich bestechen liessen. Ei, ei! was man nicht alles erfährt!
Ferner haben wir Goethe’s zweiten Theil seiner ‚Dichtung und Wahrheit.‘ Es ist in diesem zweiten Theil mehr Reichthum als in dem ersten; es will einem aber doch nicht klar daraus werden, woher denn nun der ausgezeichnete Mann, der Dichter seines Volks daraus hat entstehen können. Am Ende glaube ich doch, dass er diese ganze Form blos braucht, um manches zu sagen, was ihm zu sagen bequem ist: das Beste aber verschweigt er dennoch. Aus diesen meistens läppischen Geschichtchen kann ich mir seine Entstehung nicht zusammen setzen. Was sagen Sie aber zu allem, was wir hören und sehen? Dass Ihr Gedicht auf die Schnellfüssigen witzig ist, das sahen wir; dass es aber auch prophetisch sein würde, wäre uns wohl nicht eingefallen: bis auf den Reim auf Wind ist alles eingetroffen! Bei dem Helden selber hätten Sie auch den Reim Mäuse noch benutzen können; man erzählt sich Wunderdinge darüber. Wäre mein Herz nicht von Mitleid und Theilnahme über die armen zusammengetriebenen, gemissbrauchten Muttersöhne wund, ich würde den ganzen Tag Te Deum singen. Ja lasst uns loben den, der zu den Wellen des Meeres sagt: Bis hierher und nicht weiter! und der das Böse in gutes umzuschaffen vermag für alle, die mitwirkend es zum ewigen Heil verwenden.
Leben Sie wohl, liebster Bruder! Möchten wir Sie bald wieder sehen. Philipp ist fleissig; er malt die schönsten Frauen der Stadt, jetzt eine Gräfin Julie Zichy, die Sie vielleicht gesehen haben, eine königliche Grazie wie Madonna della sedia. Es ist ein glücklicher Schelm; er empfiehlt sich Ihnen bestens und ich von ganzem Herzen. Empfehlen Sie mich der Fr. v. St[aël].