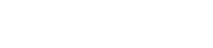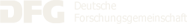Ew. Wohlgeboren interessantes Werk: die Indische Bibliothek, hat auch zu diesem entlegenen Winkel Indiens seinen Weg gefunden, und ist hier mit nicht geringer Theilnahme gelesen worden. Es hat mich sehr gefreut, daraus zu ersehen, daß Deutscher Fleiß und Tiefsinn, unterstützt durch die Freigebigkeit Deutscher Fürsten, in den Stand gesetzt ist, den Engländern kühn den Fehdehandschuh hinzuwerfen, und den Deutschen die Blumengärten Indiens aufzuschließen. – Diese erfolgreichen Bemühungen Deutscher Gelehrten um die Sanskrit-Litteratur müssen insbesondere mich erfreuen, da ähnliche philologische Bestrebungen, namentlich das Lesen des geistreichen Werks Ihres verehrten Herrn Bruders, über die Sprache und Weisheit der Indier, meinem Geiste, der bis dahin sich in dem tändelnden Studium der Dichter älterer und neuerer Zeit zufrieden gefühlt hatte, einen neuen und mächtigen Schwung gaben, ohne welchen ich vielleicht nicht nach Indien gekommen seyn würde. Die Erwähnung dieser Umstände wird, hoffe ich, die Zudringlichkeit mit welcher ich, ein Ihnen völlig unbekanntes Individuum, an Sie schreibe, einigermaßen entschuldigen.
Das Interesse und die Vorliebe, die ich immer noch für die Sanskrit-Litteratur, ich möchte sagen aus Dankbarkeit, fühle, obgleich mein Beruf es mir zur Pflicht machte, seitdem ich in Indien bin, alle meine Aufmerksamkeit und Kräfte auf andere Gegenstände zu verwenden, treibt mich an, meine Bemerkungen und Einwendungen in Bezug auf verschiedene Stellen Ihres Werks, Ihnen offen mitzutheilen, in der Ueberzeugung, daß ein philosophisches Gemüth jede verschiedene Ansicht, von wem sie auch herrühren mag, gern berücksichtiget, das Wahre darin annimmt, und das Irrige mit Nachsicht trägt.
Seite 4 (des ersten Bandes) finde ich die Bemerkung, daß die heutigen Mundarten der verschiedenen Landschaften Indiens sämtlich durch Einmischung des Persischen, des Arabischen und anderer Sprachen aus dem Sanskrit entstanden sind. Daß das Sanskrit die Mutter aller Indischen Dialecte sei, ist eine durch Caren verbreitete, und noch jetzt häufig angenommene irrige Meinung. Das Tamulische ist eine vom Sanskrit völlig unabhängige Indische Ursprache, deren sehr vollkommene erste Grammatik auf Anstiften Pandions, Königs zu Madura, zuerst aufgesetzt, und in einer vervollkommneten Gestalt noch jetzt die einzig authentische Richtschnur der Sprache ist. Das Tamulische hat eine eigene, sehr einfache Declination und Conjugation, eigne Namen für die Zahlen, eigne Benennungen der ersten Familienverhältnisse, der Glieder des menschlichen Körpers und anderer sichtbaren Gegenstände; – welches alles unzweideutige Kennzeichen einer selbstständigen Originalsprache sind. Ich läugne damit nicht, daß sehr viele Sanskritwörter in die Tamulische Sprache aufgenommen sind, aber in vielen Fällen unnöthiger Weise, und der Sudra, der seine Sprache wohl studirt hat, vermeidet die Sanskritwörter eben so sehr, als der patriotische Deutsche französische und andere fremde Wörter vermeidet; obgleich Sanskritwörter dem Tamulen unentbehrlich sind, um religiöse und wissenschaftliche Gegenstände zu bezeichnen. Aber auch in diesem Falle behauptet die Tamulische Sprache ihre Unabhängigkeit, indem die Regeln aufgestellt hat, nach welchen Sanskritwörter tamulisirt werden. Nach der Tamulischen Grammatik wird z.B. aus Wischnu, Wittuni, aus artam (die Sache, Bedeutung) aruttam, aus mokscham, mokam, oder wenigstens motscham, wodurch viele Sanskritwörter ganz unkenntlich werden. Mein Mitarbeiter, K. Rhenius, hat eine Tamulische Grammatik geschrieben, die, wie ich hoffe, bald im Druck erscheinen wird, und er wird dann die Ehre haben, Ihnen, als einen Beweis seiner Achtung, ein Exemplar zuzusenden. Da diese Grammatik aber, der Natur der Sache nach, mit dieser Untersuchung nichts zu thun hat, so werde ich mit Freuden meine Gründe schriftlich weiter aus einander setzen, wenn dieser Gegenstand einiges Interesse für Sie haben sollte.
Seite 83 steht die Vermuthung, daß die Schreibung: Bramine, statt des classischen: Brachmane, wahrscheinlich von französischen Missionaren herrührt. Die Engländer in Bengalen schrieben zu verschiedenen Zeiten: Brahman (As. Res. Voll. I und II. passim), Brahmen, (As. Res. Vol. III.) Brahmin, (As. Res. Vol. IV. p. 330, und Brahmana p. 206) und jetzt scheint die Schreibart Bramhun vorzuherrschen; – ein Beweis, daß in den jetzigen Indischen Mundarten die alte Form nicht erhalten worden ist. Im Tamulischen heißt das Wort Bramenen oder nach den Buchstaben Biramenen. In der Prosa Brahmane oder Brachmane einzuführen, würde, däucht mich, eben so affectirt klingen, als wenn man nicht mehr: die Römische Kirche, das Römische Reich, sondern: die Romanische Kirche, das Romanische Reich sagen wollte, weil es im Lateinischen Romanus, a, um, heißt. Die jetzigen Braminen sind doch wahrlich nicht, was mich sich gewöhnlich unter den Brachmanen vorstellt! Gegen die Vermuthung, die Seite 147 und 148 aufgestellt ist, daß die Perser und Indier lange nichts von einander gewußt haben, hege ich starke Zweifel; es würde mich aber viel zu weit führen, sie hier aus einander zu setzen.
Seite 234 stellen Sie die Vermuthung auf, daß das verneinende a, wie dem Griechischen und Indischen, vor Alters allen deutschen Mundarten gemein gewesen sei, und später durch die Partikel un ersetzt worden. – Ich würde im Gegentheil gesagt haben, daß die verneinende Partikel in allen diesen Sprache ursprünglich an war, wovon das n in Zusammensetzungen mit Wörtern, welche mit einem Selbstlauter anfangen, beibehalten wurde, aber vor Mitlautern wegfiel. Die rauheren Germanischen Mundarten, und die Lateinische Sprache behielten das an (in, un) ohne Bedenken in jedem Falle bei. Wäre a, und nicht an, die ursprüngliche Form, so würde der Tamule gewiß nicht anâdhi, Anfangslosigkeit, anandham, Unendlichkeit sagen, sondern awâdhi, awandham, weil es eine Grundregel der Tamulischen Sprache ist, keinen Hiatus zu dulden, sondern zwischen zusammenstoßenden Selbstlautern entweder w oder j zu setzen; ohngefähr wie im Worte Avernus, nur mit dem Unterschiede, daß hier das v sich vom Äolischen Doppelgamma in ἄ Fορνος, herschreibt. Daß an die ursprüngliche Form war, wird außer Zweifel gejetzt durch die Existenz der verlängerten Formen ἄνευ, und ohne, woran sich erweislich das Wort sine anschließt.
Die, S. 235–237, aufgestellte Vermuthung, das einige Stämme der Deutschen in ihren Ursitzen zurückgeblieben seyn möchten, erschien vor etwa acht Jahren noch meiner erhitzten Phantasie als Gewißheit, und ich wäre damals jeden Augenblick bereit gewesen, mit dem Herrn von Humboldt die damals schon entworfene Reise nach Tibet zu machen, denn was würde schöner, und für die vergleichende Sprachkenntnis interessanter und lehrreicher gewesen seyn, als in einer Bergschlucht des Himalaya eine Colonie Deutschredender Brüder anzutreffen, ungefähr wie sich im Thale Engadin eine Colonie Romanisch redender Menschen, oder in Malta ein Ueberrest einer merkwürdigen Arabischen Mundart erhalten hat? – Ich war damals von dieser Idee, und von allem, was mit der Sanskrit-Litteratur in Verbindung stand, so eingenommen, daß ich es einem jedem sehr übel genommen haben würde, der so indiscret gewesen wäre, diese Idee zu bestreiten, oder überhaupt meine „guten Indier“ anzutasten. Ein würdiger Mann, dessen Bekanntschaft ich in dieser Periode zu machen das Glück hatte, brauchte, in Rücksicht meiner Vorliebe, den zwar nicht sehr ästhetischen, aber ziemlich treffenden Ausdruck, daß ich, so oft ich auf das Sanskrit zu sprechen käme, wie ein Haufe Stroh aufloderte. Aber reifere Erfahrung hat seitdem diese Glut sehr abgekühlt! Ein vergleichender Blick auf die Ursachen und die Natur der frühesten Völkerzüge hat mich zu der Ueberzeugung gebracht, daß die verschiedenen Familien, von welchen das Menschengeschlecht abstammt, aus Persien, der Wiege des Menschengeschlechts, durch die anwachsende Menschenmenge genöthigt, in verschiedenen Perioden, aber meistens ohne sich zu zersplittern, nach den verschiedenen Himmelsgegenden auswanderten, und durch die ihnen nachfolgenden Menschenmassen, immer weiter, bis an die Enden der Erde, bis Irland und Schottland, – bis Japan, Kamtschatka, und endlich bis Amerika gedrängt wurden; ja, daß die am frühesten auswandernden Völker, wie die Celten, Germanen und andere, durch Vermischung mit andern Völkern, in weit von Persien entfernten Ländern, ihre Sprache erst recht formten, so daß an einen Ueberrest der Deutschen Sprache in dem Asiatischen Mittellande gar nicht zu denken ist. Das Gerücht, daß in der Gegend des Ararat Deutsch gesprochen würde (zur oder vor der Zeit, wo der Lobgesang auf den heil. Anno verfertigt wurde), erscheint mir eben so verdächtig, als die Behauptung des Hieronymus, daß die Sprache der Galater in Kleinasien, und die der Trevirer dieselbe sei. Hieronymus kannte wohl schwerlich Eine Sprache dieser Völker; er fand sie beide rauh, und hielt sie folglich für eine und dieselbe Sprache. Aber in Trier wurde Deutsch gesprochen, und die Trierer waren stolz auf ihren Deutschen Ursprung; es ist aber durchaus kein Grund da zu vermuthen, daß die Gallograeci Deutsche oder auch nur mit Deutschen Stämmen vermischt waren, denn die Rede des Cn. Manlius (Livius 38, 17) wo er sie fast ganz als Deutsche beschreibt, beweist nichts. Ob die Thatsache mit Rücksicht auf Hieronymus von mir richtig dargestellt ist, bin ich nicht im Stande zu behaupten, da ich sie vor nicht weniger als acht Jahren in einem Werke Adelungs, dessen Titel mit sogar entfallen ist, das letzte Mal las.
Der von Ihnen sehr unbillig behandelte Wilford sagt in den As. Res. Vol. 5, p. 292, als eine bekannte Sache, daß Athenäus Σανδρόκυπτος schrieb, und Sie sagen, S. 246: „Nun finde ich endlich, daß die ächte Schreibung Σανδρόκυπτος sich in den Handschriften des Athenäus erhalten hat,“ gleich als hätten Sie eine kritische Entdeckung gemacht. – Dies hat mich sehr befremdet!
Seite 252 u. f. suchen Sie die Meinung zu widerlegen, Wodan sey derselbe als Buddhu, und läugnen, daß sich im Tacitus eine Spur von Wodan finde. – Ich wage Ihnen eine Conjectur vorzulegen, die ich noch in Deutschland machte, und die ich mich nicht erinnere irgendwo gelesen oder gehört zu haben. Tacitus sagt in seinem trefflichen Werke über Deutschland, Cap. 3. – Ceterum et Ulixem quidam opinantur, longo illo et fabuloso errore in hunc Oceanum delatum, adisse Germaniae terras, Asciburgiumque, quod, in ripa Rheni situm, hodieque incolitur, ab illo constitutum. Dies kann schwerlich etwas anders als ein Mißversändniß des Römers seyn, der, als ihm der Deutsche von dem viel gewanderten, aus fernen Gegenden gekommenen Odin erzählte, keinen Zweifel hegte, daß dies Wort eine Verstümmelung des Wortes Ὀδυσσεὺς seyn müsse. Daß Odin aus fernen Ländern in die nordischen Wälder kam, erhellet aus den Isländischen Geschichtschreibern, welche bekanntlich erzählen, daß er aus Tyrkland (Turcomania?) am Caspischen Meere, nach Schweden kam, und die Stadt Sigtuna erbaute, welche die Schweden Äsegarth (Asiaten-Wohnung) nannten. Daß er mit den Römern gekämpft habe, ist offenbar ein Irrthum. Die etymologische Deutung des Worts Wodan, i. e. furor, welche Adam von Bremen angiebt, ist von wenig Gewicht. Wir wissen ja, wie erfindungsreich, aber auch wie unglücklich die Griechen waren, die ihnen unbekannten Indischen Wörter in ihrer Mythologie etymologisch zu erklären, und ganze mythologische Hirngespinste hervorzubringen! – Zwar haben die kriegerischen, und zum Theil grausamen Sitten der alten Germanen nichts mit der harmlosen Lehre des Buddhu gemein, und Wodan und Buddhu, und Wuth und Weisheit stehen sehr weit von einander ab, aber ist es nicht denkbar, daß die vertriebenen Schüler des Buddhu, (deren Häupter sich auch Buddhu nannten), in den unwirthbaren Gegenden, durch welche sie sich mit wilden Bären und noch wilderen Menschen durchschlagen mußten, den kriegerischen Geist der Völker, unter denen sie lebten, annahmen? – Ob sie gleich, nach dem Zeugniß der Isländischen Schriftsteller, durch Weisheit und Güte sich vor den Germanischen Völkern auszeichneten, und Odin ihr Gesetzgeber wurde. Eine höchst auffallende Thatsache ist die frühe und allgemeine Verbreitung der heidnischen Namen der Wochentage und unter diesen des Wodanstages. Auch im Tamulischen heißt die Mittewoche Budhun-küramei, welches, verglichen mit der Benennung desselben Tages im Sanskrit, einen unumstößlichen Beweis liefert, daß Buddhu und Wodan (oder auch Wuden), dieselbe Person ist. Nach meinem Gefühle kann der Stärke dieses Beweises nur ein Gemüth widerstehen, welches von irgend einer Lieblingsidee eingenommen ist, die sich mit dieser Thatsache nicht vereinigen läßt.
In einer Stelle, die ich gerade jetzt nicht wieder finden kann, machen Sie die interessante Bemerkung, es sei eine durch das ganze Morgenland verbreitete Meinung gewesen, daß die bösen Geister durch Wohlgerüche vertrieben würden. – Die Tamulen glauben, daß der übele Geist, pisâsu, (im Sanskrit piśâcha) den Geruch der Leichname sehr liebe, und sich daher immer in der Nähe abgeschiedener Menschen, oder in ihren Leichnamen selbst, und an den Oertern, wo solche verbrannt werden, aufhalte.
Als Nachschrift muß ich, in Rücksicht auf das, was ich vorhin vom Hieronymus sagte, mich deutlicher erklären, und erwähnen, daß ich die Galater für Gallobelgischen Stammes halte, und da die Belgier Germanischen Ursprungs waren, so möchte Hieronymus, der sich lange in Trier aufhielt, einigermaaßen Recht gehabt haben. (Siehe: Polybius Geschichte, Lib. 5. p. 425. ed. Paris. 1609. – und Steph. Byzant. sub. voc. Τεκτόσαγος). Demungeachtet war die Sprache der Kleinasiatischen Gallogriechen und die der Trierischen Germanobelgier gewiß nicht dieselbe.