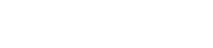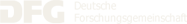Camoëns erzählt, Vasco da Gama sei auf der Ostseite Afrikas in Melinde gelandet. Der König fragte ihn, warum er eine so gefährliche Seefahrt auf einem Meere gewagt hätte, wohin noch niemals ein Mensch aus seinem Lande gekommen sei. Vasco da Gama erwiderte: ›Mein König, der im äußersten Westen wohnt, hat mir dazu Befehl erteilt.‹ Auf diese Antwort hin, sagt der Dichter, bekam der König von Melinde einen unglaublichen Respekt vor einem König, dem man noch in so weiter Ferne gehorchte.
Darin, liebe Freundin, und vielleicht in noch vielen anderen Punkten, gleichen Sie dem großen Emmanuel, daß man Ihnen unbedingt gehorcht, auch wenn man fern von Ihnen weilt. Um nichts in der Welt hätte ich in Wien ohne Ihre ausdrückliche Erlaubnis bleiben wollen – und ich konnte Ihre Aufforderungen nicht dafür nehmen, da sie auf einer Annahme beruhten, die sich leider nicht verwirklicht hat. Ich kam also zurück und zwar sehr schnell, um Sie nicht zu beunruhigen und immer zu Ihrer Verfügung zu stehen. Wirklich, Sie haben zu wenig Vertrauen zu Ihren Freunden.
Ich glaubte, Sie von einem Umstand in Kenntnis setzen zu sollen, der mich betraf. Man sagte mir ein paar höfliche Worte, die wahrscheinlich ganz oberflächlich und ohne jede Folge waren; ich antwortete höflich, aber auch ganz unbestimmt. Ich vermied, eine Stadt zu berühren, durch die mich mein Weg eigentlich hätte führen müssen, um nicht in Verhandlungen eintreten zu brauchen. Und das ist Grund zur Aufregung, als wenn es im Hause brennte? Ich finde in Ihrem Brief einen wirklich beleidigenden Satz: ›Sie gestehen es ja selber; der Grund ist der, daß man weiß, Sie haben niemanden nötig, und daß jeder sich jetzt zu Ihnen drängt.‹ Ich kann von dem allen nichts zugeben. Ich habe niemals jemanden nötig gehabt. Vor sechzehn Jahren fing ich an, von meinen literarischen Arbeiten zu leben. Seit dieser Zeit habe ich mir meinen Weg ohne Vermögen und ohne Protektion durch die Welt gebahnt. Ich habe niemals einen Fürsten um irgend etwas gebeten. Ich habe keine Stellung gesucht, das Gegenteil habe ich getan. Ich wußte genau, daß ich durch meine Schriften die selbstgefällige Eigenliebe der Mittelmäßigkeit vor den Kopf stieß, aber ich handelte nach Grundsätzen und setzte mich bewußt zu den herrschenden Ansichten in Widerspruch. Hätte ich nach rechts und links schmeicheln wollen, so hätte ich mein Glück ganz anders gemacht. Ich hätte nur die erste Erregung vorübergehen zu lassen und nicht aufs neue mir Gegner zu machen brauchen, dann wäre ich sicher gewesen, nach meinem Wert geschätzt und in die mir gebührende Stellung gebracht zu werden. Es ist wirklich liebenswürdig anzunehmen, die Meinung, die man von mir hat, könnte die Leute veranlassen, mich in irgend ein Amt zu berufen [...] Das Gegenteil ist richtig. Wenn ich in sieben Jahren keine Berufung erhielt, so liegt der Grund darin, daß man mich aus den Augen verloren hat und glaubte, ich sei anderweitig gebunden und könnte in meinem Vaterlande nichts annehmen, und das ist ja auch wahr! Sie wissen selbst am besten, daß man bei der Gründung der neuen Universität in Berlin sehr an mich gedacht hat, so daß man ganz allgemein davon sprach. Mir scheint, Sie als Freundin würden an der Ehre, die man mir irgendwo zu teil werden lassen will, stark interessiert sein. Im übrigen ist es wahr, es ist tiefe Zuneigung, Bewunderung für Ihre großen herrlichen Eigenschaften, Über- einstimmung in Gefühlen und Ansichten und endlich der Wunsch, nach bestem Vermögen dazu beizutragen, das Unrecht, unter dem Sie leiden, wiedergutzumachen, was mich an Sie fesselt, und nicht irgendein äußerer Vorteil. Ich frage Sie: Habe ich wirklich Hilfe von irgendeiner Regierung nötig, um mir ein unabhängiges, auskömmliches und meinem Geschmack entsprechendes Leben zu verschaffen? Bitte vertrauen Sie also, liebe Freundin, allein auf mein Herz, und setzen Sie sich keine Hirngespinste in den Kopf, die unser beider unwürdig sind. Ich habe doch versprochen, Sie nicht eher zu bitten, mich zu entlassen, bis Sie glücklich den Schwierigkeiten Ihrer augenblicklichen Lage entronnen und Ihre Wünsche erfüllt sind. Haben Sie jemals erlebt, daß ich ein Versprechen nicht gehalten hätte?
Sie wären bei dieser Gelegenheit mit Friedrich, den Sie so oft grundlos beschuldigten, sehr zufrieden gewesen. Zunächst vertrat er aufs entschiedenste die Ansicht, ich solle nicht über M[ünchen] fahren; ferner vertraute mir seine Frau am nächsten Morgen an, er hätte die ganze Nacht vor Unruhe nicht geschlafen, weil er sich immer einbildete, der böse Geist mache Samtpfötchen, um mich zu bestricken. – So gern er mich auch in Österreich angestellt sähe – heute wirklich für jeden Deutschen die passendste Stellung –, so sehr würde er außer sich sein, wenn ich mich an einen dieser antideutschen Könige bände, die nun einmal nicht richtig gesalbt sind. Für uns Brüder ist es aber natürlich eine große Entbehrung, so weit von einander getrennt zu sein, ohne jede Aussicht zusammenleben zu können. Vor meinem Kommen war er ganz hypochondrisch und außerordentlich niedergeschlagen gewesen; erst durch die Unterhaltung mit mir besserte sich sein Zustand. Bei meiner Abfahrt begleitete er mich und ging dann ganz allein zu Fuß über ein dürres, schattenloses Feld zurück – ein wirklich trauriges Bild unserer Trennung!
Nun komme ich zu Ihrem vorgestrigen Schreiben. Meine Stiefschwester lief ein wenig Gefahr, ihr Geheimnis zu verraten, als sie sich an Billys Schwester und Schwiegermutter auf dem Wege über die Post wandte. William sprach immer von besonderen Gelegenheiten, die man in diesen Dingen benutzen müßte; deshalb schlug ich vor, in der Nachbarschaft in ein Bad zu gehen. Aber vielleicht ist es besser, im voraus alles sicherzustellen. Wenn Billys Schwester verspricht, sich dafür einzusetzen, zweifle ich nicht mehr daran, daß man den Kreditbrief bekommt; so wäre es vielleicht richtig, sich zuerst auf den Weg zu machen, um ihr entgegenzufahren. Indessen, es eilt ja nicht, und es ist besser, zunächst in aller Ruhe seine anderen Sachen zu ordnen, weil, wenn man bei Valerie vorüberfährt, man nicht mehr Zeit hat, vor der schlechten Jahreszeit die große Reise zu machen.
So sehr ich nur kann, rate ich davon ab, die Bäder in B., vier Stunden von Friedrich entfernt, zu gebrauchen. Hiermit würde man gerade erreichen, daß man sich in aller Öffentlichkeit zeigt – ein Teil des Hofes ist da, die vornehme Welt kommt und geht, die alten Bekannten würden aus der Hauptstadt kommen, um meine Stiefschwester zu besuchen – kurz: man könnte es garnicht besser anfangen, wenn man möglichst großes Aufsehen erregen wollte. Alle diese Unannehmlichkeiten fallen bei den Bädern von T.[eplitz] weg. Man denkt nicht daran, nach der Saison die Menschen dort noch festzuhalten; auch kann man einmal nach P[rag] flüchten. Das war auch Williams Ansicht. ›Dort sind so viele berühmte Opfer‹, sagte er ... Auch hat man die Hauptstadt selber dann noch, aber ich glaube, es wäre doch vorsichtiger, nicht so anzufangen. Die Art, wie meine Stiefschwester den Winter zugebracht hat, scheint mir für sie erträglicher als ein Aufenthalt bei Valerie, wo es wenig Unterhaltung gibt und das Klima entsetzlich ist. Wenn man sich mit Billy selber verständigen und bei ihm bleiben könnte, so wäre das natürlich etwas anderes und hätte seine Vorteile.
Der Gedanke unseres ehrwürdigen Genfer Freundes deckt sich auch mit dem unseres Freundes aus Pirna, als wir die verschiedenen Möglichkeiten durchgingen, aber Herr von D...n müßte natürlich die nötigen Empfehlungen geben, und ich habe wenig Einfluß auf ihn; ich weiß nicht, ob er gern gefällig ist. Das wäre natürlich der kürzeste Weg – allerdings müßte man sich beeilen, um nicht in die schlechte Jahreszeit hineinzukommen.
Die A. haben – wenn Sie es wissen wollen – Schweizer Pässe gehabt, die unser Freund aus Pirna, wie er sagt, ihnen durch die Vermittlung ihres Landsmannes Johnson verschaffte, von dem er mir viel Gutes erzählt hat – davon habe ich ja schon mit Ihnen gesprochen. Adam Müller, der erst vor kurzem aus diesem Lande kam, behauptete, daß der Weg, den sie genommen haben, seither strenger versperrt ist und was vor drei oder vier Monaten noch möglich war, seitdem nicht mehr möglich wäre.
Der Weg, den die Cazen... ohne Zweifel von demselben Johnson beschützt und geführt – genommen haben, soll sehr mühsam sein. Unser Freund aus Pirna behauptet, daß die Reise zu Lande nichts im Verhältnis zu der schauderhaften Meerfahrt bedeutet, die man dann noch bestehen muß. Er sagt mir, daß er diesen Weg nur im äußersten Falle – also nur, wenn man verfolgt würde – wählen würde, daß aber sonst ihn nichts dazu bringen würde, die Füße über die Grenze zu setzen.
Ich verstehe vollkommen, daß der dauernde schnelle Wechsel der Ereignisse alle Pläne beeinflußt und die Menschen in größte Ungewißheit versetzt. So z. B. waren die Nachrichten aus Alb[erts] Vaterland, die man dort verbreitete, sehr ernst, und es wäre sicher sehr traurig, unter solchen Aussichten seine Laufbahn zu beginnen. Moritz [O’Donnell] schlug vor, er solle in dem Lande selbst, in dem er studiert hat, in Dienst treten; er zweifelte nicht, daß man ihn dort vorteilhaft unterbringen könnte. Wie wird Alb[ert] darüber denken? Im allgemeinen glaube ich, daß man bei besonnenem Vorgehen dort bestimmt in voller Sicherheit festen Fuß fassen wird. Zum mindesten wäre es ein Zwischenstadium. Wenn aber der wichtige Entschluß für den Augenblick zu große Schwierigkeiten und Unannehmlichkeiten mit sich brächte, so könnte man ja dort die weitere Entwicklung abwarten. Die ökonomischen Vorteile müßten doch auch ein wenig in die Waagschale fallen – aber ich will nicht zu sehr auf meinen Vorschlägen bestehen, sonst fürchte ich, man glaubt dann, meine persönlichen Neigungen beeinflußten meine Wünsche zu sehr. Ich gebe ohne weiteres zu, daß ich keine ganz befriedigenden Ratschläge geben kann. Aber man wird mich immer auf meinem Posten finden. Ich muß schließen, um die Abfahrt der Post nicht zu versäumen. Morgen schreibe ich wieder. Sie haben mir heute alle meine Zeit durch Ihre ungerechtfertigten Anklagen, ich sei abtrünnig, genommen. Ich bleibe in Zürich, bis König Emmanuel mir erlaubt, nach B[ern] zu gehen, obwohl mir das nicht sehr angenehm ist. Meine Zuflucht ist die Stadtbibliothek; ich bin auf alte Bücher gestoßen und arbeite so viel, wie man das eben im Hotel kann. Tausend Grüße an Herrn Math[ieu]; es würde mich unendlich freuen, ihn zu sehen, aber es lohnt nicht der Mühe, meinetwegen einen Umweg zu machen. Große Neuigkeiten habe ich Ihnen nicht mitzuteilen; lediglich Einzelheiten, die ich unterdrückt hatte und durch die ich in einer Unterhaltung eine Vorstellung von der Sachlage, so wie ich sie ansehe, glaube machen zu können.
Sagen Sie Frau Réc[amier], daß – wie der persische Gruß lautet – der Staub, der von ihren Füßen fällt, das kostbarste Heilmittel für meine Augen ist. Tausend Grüße!