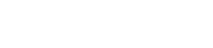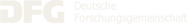Abbt, Rosette
1
Abich, Frau
1
Adams, P. (?)
1
Adersbach, Herr
4
Aditi, hinduistische Mutter- und Himmelsgöttin
1
Admete, Sagengestalt
1
Agnew, Patrick Alexander Vans
1
Alberti, Frau (Ehefrau von Georg Arnold Alberti)
2
Albruna (Seherin)
1
Allen, Fanny (?)
1
Allen, Herr und Frau (?)
1
Althof, Dorothea Henriette (geb. Kuchel)
2
Altieri, Carlo
1
Alton, Maria Friederike dʼ
1
Alton, Sophie Friederike dʼ (gesch. Buch)
1
Andreae, Ilse Sophie (geb. Müller)
1
Anetti
1
Anosi, Jean Ulric
2
Anstey, Frau
1
Anstey, Herr
1
(Anwalt von August Ferdinand Bernhardi)
2
Apollodotos I.
2
Arconati Visconti, Carlo (Carletto)
1
Arfwedson, Colonel
1
Ariantes, König der Skythen
1
Arlens, Cazenove d' (Familie)
1
Arnswaldt, Christina Catharina Charlotta von
1
Arpoxais, König der Skythen
1
(Arzt in Weimar)
1
Auersperg, Frau von
1
Auersperg, Gabriele von
4
Auersperg, Herr von
1
Augusti, Ernestine Elisabeth Charlotte (geb. Wunder)
6
Avaux, Frau d’
1
Azzurini/Azzurrini Conti, Herr
1
Backer, Anna Maria (geb. Rendorp)
4
Bagot, Mary Charlotte Anne (geb. Wellesley-Pole)
1
Baillif de Vêque, Sophie
1
Baker, George
1
Baldwin, Edmund
1
Balk-Polev, Piotr Fedorovich
13
Balmén, Herr von
1
Balzer, Herr Dr.
1
Bandini, Franziska
1
Barante, Amable-Prosper-Guillaume Brugière de
2
Barante, Charles-Alexandre-Pierre Brugière de
2
Barante, Marie Joséphine Césarine de Barante (geb. d'Houdetot)
1
Barker, Bas
1
Barnaud, Samuel L.
1
Barthélemy, Herr
1
Bartholdi, Em. Gottlieb
2
Basemann, Frau
2
Bazin, Herr (Bankier in Paris)
7
Bazin, Herr (Kaufmann in Lausanne)
1
Bazin, Herr (Sohn des Kaufmanns aus Lausanne)
1
Beaumesnil, Frau (?)
1
Beaumesnil, Herr (?)
1
Beckendorff, Herr (?)
1
Becker, Frau
4
(Bedienter in Genf)
1
Beiz, Herr
1
(Bekannter von Christian Friedrich Tieck und Wilhelm von Humboldt)
1
Bellona (römische Kriegsgöttin)
2
Belmonte-Pignatelli, Herr
1
Belmonte-Pignatelli, Prinz von
1
Bentinck, Herr von (Graf)
1
Bentinck, Willem Anton
1
Benz, Frau von
1
Berckem, Guillaume von
1
Berckem, Herr von
1
Berger, Herr von
2
Bergmann, Emil
1
Berkenburg/Berckebourg, Herr (?)
2
Berlepsch, Friedrich Carl Emil von
1
Berlepsch, Herr von
1
Bernhardi, Christine (geb. Hilke)
8
Berstecher, Herr
1
Bertouch, Stanislaw von
1
Bethmann-Metzler, Eduard
1
Bethou, Frederic (?)
3
Bethune, Henry Lindsay
3
Beugnot, Frau
1
Beust, Josepha Luise von (geb. Carlowitz)
4
Beyer, Herr
2
B., Frau von
1
B., Herr
1
Bialloblotzky, Auguste Amalia Maria (geb. Ballhorn)
6
Biermann, Herr
1
Binet, Herr
1
Bischoff, Herr (?)
1
Bischofswerder, Frau
1
Bismarck-Briest, Maria Albertine Amalie Auguste von (geb. von Flotow)
25
Bismarck-Briest, Wilhelmine von (geb. von der Schulenburg)
1
Black, Alexander
1
Blankart, Frau von
1
Blauel, Familie (Hannover)
2
Blaviere, Herr von
1
Bloch, Herr
1
Blomfield, Dorothy (geb. Cox, verwittwete Kent of Hildersham, Cambridgeshire)
1
Bluhme, Frau
1
Blum, Frau
1
Blumner, Herr
1
Boas (bibl. Figur)
1
Bode, Herr (Justizkommisarius)
12
Bodé, Herr von
1
Böhme, Franz
1
Böhmer, Dorothea Elisabeth (geb. Busse)
1
Böhmer, Frau (Hannover)
1
Böhmer, Rosalia Louisa Amalia
1
Boisserolle, Aurèle Jean de
1
Boissier, Adélaïde Catherine Louise (geb. Buisson)
1
Bolije, Fräulein (?)
1
Bonstetten, Karl David von
1
Book, Herr Prof.
2
Bopp, Andreas
2
Borgerding, Familie
1
Bornemann, Herr
7
Boten, Herr
1
Böthlingk, Herr
2
Bothmer, Frau
1
Boulgaris, Herr von
1
Bourgeois, Toussaint
2
Boysen, Herr
1
Brahe, Magnus Frederik
2
Brämer (Bremer?), Frau
1
Brämer (Bremer?), Herr
1
Brandel, Herr
1
Brandes, Frau
1
Brand, Herr
1
Brandis, Frau
1
Brassart, Herr
1
Braun, Frau
1
Braun, Herr Dr.
1
Breiger, Anna Elisabeth (Betty, geb. Trummer)
8
Bremer, Herr
1
Brem, Herr von
1
Brenken, Maria-Louise von (geb. Elmerhaus von Haxthausen)
1
Bretagne, Herr de
1
Bretari, Herr
2
Breutel, Herr
3
Briest, Friederike Marie Helene von (geb. von Luck)
10
Brockmayer, Herr von
1
Broglie, Alphonse Gabriel Octave de
2
Broglie, Beatrix de
2
Brömser, Herr
1
Bruce, Herr
1
Bruchhausen, Frau von
1
Bruchmann, Johann
5
Brückmann/Brücke, Frau
3
Brüggemann, Herr
2
Brunner, Frau
1
Büchler, Herr
6
Büchting, Christian Wilhelm
6
Büchting, Frau (Mutter von Christian Wilhelm Büchting)
1
Büchting, Margarethe Melosine (geb. Rudolph)
1
Buel, Herr von
1
Buff, Wilhelm Karl Ludwig
1
Bühler, Joseph
1
Bunge, Carl
1
Buol-Mühlingen, Josef von
3
Buol-Schauenstein, Maria Anna Alexandrine (geb. von Lerchenfeld-Köfering)
2
Burgsdorff, Fräulein von
1
Busch, Anna Catharina (geb. Droger)
3
Busch, Joseph
6
Bussche, Herr von dem
1
Butjenter, Frau
5
Buttlar, Herr von
1
Cachet, Herr
15
Cachet, Herr (Sohn)
1
Caepionis, Servilia
1
Calandrin, Frau
1
Campe, Marie Dorothee
1
Carnac, James Rivett
1
Carnap, F. von
1
Cassin, Herr
1
Castricum, Maria Henriëtte van (geb. Muilman, gen. Jetje)
11
Catel, Sophie Friederike (geb. Kolbe)
1
Cato Salonianus, Marcus Porcius, der Jüngere
1
Cazenove d'Arlens, Antoine de
1
Charles, Herr L.
2
(Charlotte, Dienstmädchen Johann Christian Bernhardis)
2
Charnock, Herr
1
Charpentier, Julie
1
Chaumont, Herr de
1
Chevkin, Alexander
1
Chevkin, Konstantin
1
Chevkin, Marie von (?)
3
Chevkin, Vladimir
2
Chotek, Herr von
1
Clarke, Fräulein
1
Clausius, Herr
1
Clifford, Fräulein
1
Clitandre (lit. Figur)
1
Cochrane, Herr
1
Cockburn-Campbell, Margaret (geb. Malcolm)
2
Cockerell, Frau (Schwester)
1
Cohen, John (?)
1
Colebrooke, Herr
1
Conderc, Herr (Bankier)
4
Conrad de Sterleto
1
Constantini, Herr
1
Corrbridge/Corbridge, Herr (?)
1
Cortemann, Frau (?)
1
Cotteret, Herr
2
Couderc, Herr
1
Coulomb, Herr
1
Coumet, Herr (?)
1
Cramm, Herr von
1
Crause, Frau (geb. Erxleben)
3
Crause/Krause, Herr
3
Cruse, Frau
2
Culme-Seymour, Maria Louisa (geb. Smith)
1
Cumming, William
1
Currie, Charlotte Judith (geb. Smith)
1
Czernin von und zu Chudenitz, Maria Theresia von
1
Czerny, Lotte
2
(Dame, Begleitung von G. M. Hermes)
1
Danckelmann, William von
1
Danco, Marianne
10
Danco, Maria Theresia
3
Dassdorf, Frau (geb. Wiedemann)
1
Dawkins, Augusta (geb. Clinton)
2
Dedel, Cornelia (geb. Corver Hooft)
1
Dedel, Jacob
1
Dedel, Salomon
1
Dedel, Willem Gerrit
1
Déjean, Herr
3
Del Furio, Herr
1
Delius, Everhard Carl
1
Demolin, Herr
3
Demoulin, Herr
2
Denecke, Frau
1
Des Cars, Madame (?)
1
Deslomy, Charles
1
Deslomy, Herr (Sohn)
1
Devraulz/Drevaulz, Herr (?)
3
Dewitz, Herr von
1
Deylen, Herr
1
Dieling, Herr
1
Dietrichs, Herr
1
Diodati, Susanne Charlotte (geb. Vernet)
1
(Direktor der Imprimerie Royale, Paris)
1
Diti (indische Göttin)
1
Ditmer, Frau
1
Döbeln, Ernst Georg Wilhelm von
1
Dokose, Herr
2
Dolgorukowa, Fürstin
1
Dolgorukow, Sergei Nikolajewitsch
1
Donnersmarck, Herr von
1
Doracus
1
(Dortchen)
2
Dösing, Herr
1
Douglas, Herr
1
Dowkins, Herr
1
Dubost, Jean Baptiste
1
Dubuc, Louis-François
1
Dümmler, Herr
1
Dumont, Herr
1
Dumoulin, Herr (?)
1
Duve, Herr
1
DʼOlri/Olrie, Herr
2
Eckenhausen, Herr
1
Eclepens, Herr O. d' (?)
1
Edlmuth, Jakob von
1
Ega-Oyenhausen, Julie von
1
Eichhorn, Frau
2
Eisenstück, Julie
1
El Bahouad, Zobeïda
2
Elias, Herr (?)
1
Ellison, Herr Dr.
1
(Emilie, Pflegetochter von Charlotte Ernst)
1
Engels, Frau
9
Engl, Josefa Maria von
1
Epstein, Herr
1
Erdődy de Monyorókerék et Monoszló, Mária (geb. Festetics de Tolna)
1
Erlach, Herr von
2
Ernst, Frau
3
Ernst, Frau (geb. Hansen)
4
Ernst, Fräulein (?)
2
Ernst, Frau (Schwester von Ludwig Emanuel Ernst)
1
Ernst, Herr (ältester Bruder von Ludwig Emanuel Ernst)
1
Ernst, Herr (Bruder von Ludwig Emanuel Ernst)
3
Ernst, Herr (Vater)
1
Ernst, Herr von
1
Erskine, Maitland (geb. Mackintosh)
1
Erskine, Töchter
1
Escher, Herr
2
Esla, Hunnenreich, Gesandter
1
Essex, Lady
2
Eticho
1
Étienne
2
Euphrosyne von Polazk
1
Faber, Frau
5
Falconet, Frau
1
Falk, Maria Josepha (geb. Meyer von Schauensee)
2
Farges, Jean
1
Faßbender, Herr
1
Fauche, Frau
1
Fauche, Herr
1
Favre, Catherine (geb. Bertrand)
1
Favre, Marguerite (geb. Fuzier Cayla)
2
Feder, Philipp
1
Feige, Frau
4
Feige, Herr (Schneider von August Ferdinand Bernhardi)
15
Feige, Kinder
7
Feit, Frau von
1
Fell, Edward
1
Ferreira, Frau
1
Ferrier, Alexander
1
Fick, Herr
2
Fiedler, Friedrich Wilhelm
6
Finckh, Ludwig
6
Fiori, Herr
1
Fiorillo, Ferdinand Ernst Carl Maximilian
1
Fiorillo, Friedrich Ignatius Johann Philipp
2
Fiorillo, Otto Centurius
2
Fischer, Frau
2
Fischer, Herr
1
Fischer, Herr
1
Fleischer, Frau
2
Fölkersahm, Herr (Bruder)
1
Forstheim, Sibilla (geb. Falkenstein)
4
Fortescue Turville, Herr
2
Fortis, Ferdinand (Mailand)
2
Fould, Herr
3
Fouquet, Herr
1
Frachster, Herr
1
Franck, Othmar
1
François (Hausverwalter Friedrich von Schlegels)
1
Frank, Herr
2
Frazer, Familie von George (?)
2
Frenzel, Frau von (geb. Ewald)
1
Freudenreich, Elisabeth von (geb. Tscharner)
3
Freudenreich, Karl Alexander von
3
Freund Friedrich Schlegels
1
Freytag, Kind (Sohn/Tochter von Georg Wilhelm Freytag)
1
Frickart, Herr
2
Frick, Frau
1
Friederike (Pflegerin von Charlotte Schlegel)
5
Friedrich (?)
1
Fries, G.
1
Frölich, Frau (Ehefrau von Heinrich Frölich)
2
Frölich, Frau (Schwester von Heinrich Frölich)
1
Fulda, Fräulein
2
Fulda, Herr
1
Fürst/König aus Odeypore
1
Gain de Montagnac, Frau de
2
Gakern, Herr Baron von (?)
2
Galatin, Herr
1
Ganss, Egbert
2
Gärtner, Fräulein
13
Gärtner, Herr (Braunschweig)
15
Gärtner, Herr (Hamburg)
1
Gaspari, Herr
1
Gaupp, Frau
1
Gautier, Marguerite Madeleine (geb. Delessert)
1
Genelli, Herr (Minister)
1
George, Herr Dr.
1
Gerber, Herr
2
Gerlach, Herr
1
Gherhardini, Giovanni
3
Gilbert, Joseph
1
Giorgi, Andreas
1
Goddé, Frau de
3
Godefroi
1
Godtschalck, Herr
1
Golbéry, Marie Anne Joséphine Amélie de
1
Golbéry, Rose Élisabeth Honorine de (geb. Merlin)
4
Goltz, August Friedrich Ferdinand von der
6
Gotter, Luise
12
Gotzig, Herr
1
Graefe, Louis
1
Graffenried de Villars, Frau
1
Graffenried de Villars, Sophie
1
Grattenauer, Anna Philippine Elisabeth (geb. Grohmann)
3
Gregory, Frederik/Friedrich (?)
2
Grenus, Herr
1
Grenzenstein, Herr von
2
Grovenstein, Herr von
1
Guerres, Herr
1
Guillaume I., Normandie, Herzog
1
Gundioch, Burgunden, König
2
Guyot, Herr
6
Hacht, Frau von
1
Hacht, Henning von
1
Hagemann, Frau
2
Hagemann, Herr
1
Hagn, Rena von
1
Hahn, Herr (Kommerzrat)
1
Haller, Katharina von (geb. Wattenwyl)
3
Haller, Maria Rosina (geb. Müslin)
39
Hammerstein, Herr von (Baron)
1
Hangard, Herr
1
Hannchen/Hanchen (Pflegetochter von Johanna Christiane Erdmuthe Schlegel)
5
Hansing, Johann Adolph
1
Harbauer, Josef
3
Hardenberg, Karoline von
7
Hartmann Herr (Konsistorialrat)
1
Hartsinck, Jan
1
Hassenpflug, Agnes
2
Hassenpflug, Kind
2
Hastings, Herr
1
Hätzel, Herr
1
Haußen [Hausen?], Herr, Dr.
1
Haussonville, Charles Louis Bernard de Cléron d'
1
Haussonville, Jeanne Marie de Cléron d' (geb. Falcoz de la Blâche)
1
Haussonville, Victor Bernard de Cléron d'
4
Haymann, L.
1
Hebler, Frau
4
Hecht, Herr von
2
Heftig (Messig?), Herr (Konsistorialrat in Straßburg)
1
Hegner, Herr
1
Heiliger, Fräulein
1
Heinly, Herr
1
Heinrich, Frau
1
Heinrichs/Hinrichs, Herr
2
Heins, Herr
1
Heinsius, Herr (Stadtrat)
1
Hempel, Herr
3
(Henriette/Jette, Dienstmädchen Sophie Bernhardis)
7
Hensler, August Wilhelm (Richard) Hensler
1
Hensler, Charlotte
1
Hensler, Wilhelmine
1
Hermes, G. M.
1
Herrmann, Frau (Bern)
3
Herrmann, Herr (Bern)
7
Herrmann, Herr (Kaufmann in Berlin)
1
Herrmann, Karl
1
Herrmann, M. G.
1
Heshusius, Johannes
1
Hetzerodt, Herr
1
Heun/Heyne, Marianne
8
Hilgen, Herr von
1
Hill, Herr
1
Hirn, Herr
1
Hoff, Herr von
1
Hoffmann, Herr
1
Hohe, Adelheid (Hubertine, geb. Sieben)
1
Holländer, zwei
1
Holscher, Pastor
1
Holzenhausen, Herr
1
Hoofmann, Herr
4
Hooft, Gerrit Jacobsz
2
Hooft, Herr
1
Hooft, Jacob Gerritsz
1
Hooft, Suzanna Cornelia (geb. Muilman)
10
Hooft van Vreeland en de Dordsche Waard, Jacob
3
Höpfner, Herr
1
Hornemann, Herr Dr.
1
Horner, Dorothea
5
Horn, Herr
1
Hottinguer, Frau
2
Huber, Clarence
1
Hudel, Herr
2
Hugdietrich (Sagengestalt)
1
Hulot d'Osery, Eugénie
5
Hülsen, Fräulein (Nichten von August Ludwig Hülsen)
2
Hülsen, Herr (Bruder von August Ludwig Hülsen. wohnhaft in Stechow)
5
Hülsen, Leopoldine Christiane Dorothea (geb. Posern)
3
Hülsen, Wilhelmine (geb. Thormählen)
2
Hummel, Herr
1
Huneef, Mahomed
1
Huttmann, William
1
Hutton, William
2
Isabé, Herr
1
Itié, Frau
3
Jacobi, Christian Leonhard
1
Jagor, Herr
1
Jahn, Friedrich Ludwig
1
Jahn, Ignaz
1
Jalauka
1
Jean
1
Jesemann, Herr
1
Joern, Herr de
1
Johnson, Herr
1
Johnston, Herr
2
Jordy, Herr
1
Joulin, Pierre Charles
1
(Julchen)
1
Jüngst, Bernhard Heinrich
1
Jüngst, Georgine Wilhelmine (geb. Croupp)
1
Jüngst, Wilhelm Friedrich
2
Kaa, Anton (?)
1
Kaiser, Fräulein
2
Kalm, Herr
1
(Kammerdiener von Anne Louise Germaine de Staël-Holstein)
3
(Kammerfrau von Anne Louise Germaine de Staël-Holstein)
1
Kampe, Herr
1
Kappenberg, Herr
1
Kapp, Herr
1
(Kathrinchen)
2
(Kaufmann in Weimar)
1
Kehr, Carl
1
Kestner, Louise Amalie Henriette Antoinette
1
Keyl, Friedrich Wilhelm
1
Kilian, Frau
1
Kind von August Ferdinand Bernhardi und Marie Alberti
1
Kirchgeßner, Frau
1
Kirchhof, Herr
1
Kirnmeyer, Herr
1
Klein, Herr
1
Klingsor (Zauberergestalt der mittelhochdeutschen Literatur)
2
Kneisel, Frau
1
Knobel, Frau von
2
Knorring, Gotthard von
9
Koch, Carolina Augusta (geb. Schindler)
8
Köhler, Herr
1
Kolaxais/Colaxais, König der Skythen
1
Kölz, Geheimrat
3
(Kommandant in Bonn)
1
König, Herr
1
Koppe, Charlotte Friederike
1
Koppe, Herr (Hildesheim)
1
Kortüm, Frau
1
Kosegarten, Emil
1
Kosegarten, Julie
1
Kosegarten, Katharina (geb. Linde)
1
Köster, Herr
1
Krassowski, Afanassi Iwanowitsch
1
Krause, Frau
1
Krause, Herr
1
Krause, Herr (Rektor)
1
Krause, Konrad Wilhelm
1
Krause, L.
3
Krohne, Frau
1
Krug, Frau
1
Kruse, Herr
1
Krusemark, Herr von
1
Krusen, Herr
1
Kuhn, Herr
1
Kulenkamp, Frau
1
Kumme, Frau (Hannover)
2
Künburg, Maria Anna von (Gräfin, geb. Gräfin Kufstein)
1
Kunßel, Familie
1
Kunze, Herr
1
Kyj
1
La Bédoyère, Charles-Marie-Philippe de
1
Laborie, Herr (frz. Verleger)
1
La Châtre, Charlotte de
1
La Douespe, Herr
1
La Garde, Herr
1
Lähr, Herr
1
Lamberz, Herr (Sohn)
1
Lampe, Heinrich
1
Lampsins, Jan Pieter Cornelis
4
Lanckorońska, Frau von
1
Landefeld, Herr (Schuhmacher in Berlin)
5
Lapteff, Herr von
2
L’Archeveque, Herr
1
Las Cases, Henriette de (geb. de Kergariou)
1
Lassaulx, Benedikte (geb. Korbach)
1
Lau, Herr
1
Launay de Tillières, Augustus von
2
Laurent, Frau
1
Laurent, Herr
4
La Vallière, Frau de
1
Lawrence, Richard James
2
Lebrun, Herr
1
Le Fort, Herr
3
(Lehrer in Coppet)
1
(Lehrer von Albert de Broglie)
1
(Lehrer von Theodor von Bernhardi)
1
Lehzen, Fräulein
2
Leipoxais, König der Skythen
1
Le Marchant, Denis
1
Le Marchant, Sarah Eliza (geb. Smith)
1
(Lene, Köchin in Jena)
3
Lenz, Herr
1
Levi, Herr
1
Ley, Herr
1
Lichtenstein, Henriette Victoire (geb. Hotho)
1
Lichtenthurn, Herr von (?)
1
Ligarius, Quintus
2
Liphart, Carl Gotthard von
4
Liphart, Frau von
3
Lobanov-Rostovsky, Dmitry Ivanovich
1
Löbel, Elisabeth Johanna
1
Löchner, Herr (?)
1
Longarini, Herr
1
Lonnin, Herr
1
Lorent, Abraham Robert
1
Lorent, Maria Wilhelmina
1
Lorenz
2
Lotte (Dienstmädchen von Johanna Christiane Erdmuthe Schlegel)
14
Louis
1
Louis, Georg Friedrich
1
Löwe, Herr
1
Lucey, Herr von
1
Ludewig, Herr
1
Ludewig, Herr (Sohn)
2
Ludwig, Herr
1
Lullin de Châteauvieux, Blanche
1
Lüschwitz, Amalie (geb. Koreff)
1
Lütz, Herr
1
Lyell, Francis (geb. Smyth)
1
Maarseveen, Frau (geb. ten Hoven)
1
Maarseveen, Herr
1
Maccauly, Thams
2
Macdonald, James
2
Mackintosh, Catherine (geb. Allen)
1
Mahrenholz, Frau von
1
Maisonfort, Maximilien Dubois-Descours de la
1
Malcolm, Anne Amelia
4
Malcolm, Catherine Wellesley
6
Malcolm, George Alexander
3
Malortie, Juliane von (geb. von Platen zu Hallermund)
1
Manning, Mary
3
Mansfield, Frederica Murray (Markham), Countess of
2
Manteuffel, Johanne von (geb. von Wagner)
1
Marczy, A. von (?)
1
Margarete von Limburg
1
Maria Anna, Österreich, Erzherzogin
25
Marialva, Herr
1
Marjoribanks, Campbell
3
Markoff; Herr
1
Marschall, Herr von
1
Martin de Blois, Herr
1
Martinengo, Catharina Josephine
2
Martinengo, Gotthard
5
Martini, M. G.
1
Marx, Herr
1
Mary
1
Massimo, Carlo
1
Masterman, John
1
Mastiaux, Johannes Godefridus von
1
Mathieu-Faviers, Jacques-Édouard
4
Mattis, Frau von
1
Maule, Wiliam M.
1
Maydell, Herr von
1
Mäyer, Frau
1
Mäyer, Herr
1
Mayer, Herr (Maler)
1
Mayer, Jakob
2
Meder, Herr
1
Medini, Herr
1
Medwigk, Herr von
1
Mehlem, P.
1
Mehring, Herr von
1
Meier, Immanuel
1
Meister, Ursula
1
Melish, Herr
1
Melkeburg, Herr von
1
Mellish of Blyth, Carolina Ernestina Friederike Sophia
2
Mendelssohn, Rosamunde Ernestine Pauline (geb. Richter)
2
Merian, Herr (Bankier)
1
Merkel, Herr
1
Messalla Niger, Marcus Valerius
3
Metzenmacher, Andreas
2
Meyendorf, Frau von
1
Meyendorff, Sophie von (geb. von Stackelberg)
1
Meyer, Amalie (geb. von Koppenfels)
1
Meyer, Familie (Hannover)
2
Meyer, Frau (Dienstmädchen von Johanna Christiane Erdmuthe Schlegel)
3
Meyer, Frau (geb. Böhmer)
1
Meyer, Recha (geb. Mendelssohn)
3
Micchelli, Herr
1
Michel, Herr
1
Miller, Herr (?)
1
Mills, Charles, 1st Baronet
1
(Mina/Minna, Küchenmädchen)
16
Mirabeau, Herr
2
Mittermaier, Frau
1
Moeller, Elisabeth Charlotte (geb. Alberti)
1
Moers, Herr von
1
Mollwitz, Frau
2
Molten, Frau (?)
1
Montague, Herr
2
Montigny de Jaucourt, Henriette Françoise de
3
Montigny de Jaucourt, Louis Charles François Lévisse de
2
Montjoye, Christine-Zoë de
1
Moor, Canon Edward James
1
Moor, Elizabeth (geb. Lynn)
1
Morand, Alphonse de
2
Morand, Clementine de
5
Morand-Dupuch, Herr
1
Moritz-Matzdorff, Christiane Friederike
1
Morris, John
1
Mounard, Herr
1
Muilman, Nicolaas Pieter (Klaas)
1
Muilman, Pieter
4
Muilman, Susanna Cornelia (geb. Mogge)
12
Mülinen, Herr von (Sohn von Nikolaus Friedrich von Mülinen)
1
Müller, Caroline
1
Müller, Emanuel (Spediteur)
2
Müller, Frau (Hannover)
1
Müller, Herr (Anwalt in Köln)
1
Müller, Herr (Bruder von Sophie Tischbein)
1
Müller, Herr (hannoverscher Gesandtschaftssekretär in Berlin)
1
Müller, Herr (Kaufmann in Dresden)
2
Müller, Herr von
1
Müller, Hofrat (Dresden)
1
Müller, Wilhelm Heinrich
1
Munck, Baronin von
1
Munter, Cornelis
2
Munter, Frau
1
Murray, Herr
1
Muspratt, John Petty
2
Müßler, Herr
1
Mylitta (Göttin)
1
Mynheer Van Papst (Familie)
1
Mynheer Van Papst, Herr
1
Naamen, Sara van (geb. van Prehn)
1
Nahrheus, Herr
1
Napoleone della Torre
1
Nasuhzade Ali Pasha
2
Natorp, Franz Joseph von (?)
6
Naville, Sophie Adélaïde Louise (geb. Boissier)
1
Necker, Alphonse Theodore Charles
1
Nettekoven, Theodor Joseph
6
Neuber(t), Herr
6
Neufville, Herr
1
Neumann, Frau
3
Neumann, Herr
3
Niebuhr, Margarete
1
Nieper, Charlotte Dorothea (geb. Boehmer)
1
Niethammer, Rosine Eleonore
13
Noailles, Alexis de
5
Noël, Andreas
1
Noel, Robert Ralph
1
Nöldeke, Herr
1
Nolte, Herr Dr. (Hannover)
1
Norman, George
1
Nunez, Virginia
1
Nuys, Fräulein van (früh verstorbene Tochter von Elisabeth Wilhelmine van Nuys)
1
Nuys, Henriette van
16
Nuys, Rudolf van
1
Obermann, Familie
1
Odier-Lecointe, Andrienne
1
Offeney, Justus August Wilhelm
2
Ogilvy, Herr
1
Oidtmann, Familie
1
Oknos (Person der griechischen Mythologie)
1
Oldenhove, Herr
1
Oldershausen, Frau von
1
Oldershausen, Herr von
1
Olvie, Herr d'
3
Opdebeck, Susan Harriet Catherine, Lady
1
Oppenhoff, Caspar Anton
2
Orell, Herr
3
Orsini, Herr
2
Ott, Johannes
2
Otto, Herr (Friseur)
4
Otway-Cave, Sophie (geb. Burdett)
1
Overbeck, Alphons Maria
1
OʼDonnell, Frédéric
1
OʼDonnell, Johann
5
OʼDonnell, Theresa
1
Pacheco, Maria
2
Paczensky, Herr
1
Pape, Frau (Kusine von Georg Wilhelm August von Pape)
2
Pape, Herr (Militärhauptmann)
1
Pape, Wenzel
1
Parbury, Charles
13
Parjanya (vedischer Regengott)
3
Parkes, Elizabeth
1
Parmantier, Herr
1
Parrot, Frau de
1
Parrot, Herr de
1
Parry, Edward
2
Parz, Frau
1
Pattison, James
1
Paulsdorff, Marianne Friederike Leopoldine von (geb. Schlegel)
1
Paulsen, Friedrich Wilhelm
2
Paulus, Wilhelm
10
Pauly, Michael Rudolf
4
Pédelaborde, Herr
1
Pereira-Arnstein, Heinrich von, der Jüngere
1
Peter, Herr
2
Peters, Herr
1
Pfenninger, Frau
1
Pfirt, Maria Franziska (geb. von Venningen)
1
Pflug, Herr
1
(Piet)
1
Piquet, Herr
1
Platen, Herr von
1
Platen, Julie Marianne Charlotte von (geb. von Hardenberg)
1
Platen zu Hallermund, Elisabeth von
1
Pleimes, Frau
1
Ploch, Herr
1
Plowden, Richard Chicheley
2
Pobecheim, H. P.
1
Pohland, Carl Christian
1
Pölchau, Herr
1
Polier, Familie de
1
Polier-Vernand, Johann Gottfried von
1
Poll, Aegidius van de
1
Poll, Susanna Cornelia van de (geb. Hooft)
2
Pompery, Herr de
1
Porsch, Herr
1
Porta, Carlos
2
Posse, Carl Henrik
1
Post, Doktor
1
Poten, Herr von
1
Potrimpos (Gott)
1
Pozzo di Borgo, Carlo Geronimo (Charles Jérôme)
2
Pozzo di Borgo, Louise Victurnienne Valentine (geb. Berton des Balbes de Crillon)
2
Praed, Herr van
1
Prangins, Herr de
1
Prehn, Henning Joachim van
3
Preisvarch, Herr
1
Prescott, Charles Elton
2
Prichard, Herr
1
Prillwitz, Johann Carl Ludwig
2
Publius Clodius
1
Pujol, Herr
6
Quantius, Andreas
1
Radde, Frau (geb. Schläger)
1
Radde, Herr
1
Rahn, Herr
1
Raikes, George
3
Rambach, Henriette
1
Ramdohr, Juliana Wilhelmine Antoinette Davide von
2
Rapatel, Paul Marie
2
Raphaël, Père
1
Rappuse
1
Rautenstock, Herr (Forstschreiber in Dessau)
1
Ravel, Herr (Seiltänzer)
1
Récamier, Jacques
1
Rechart, Herr (?)
1
Recketer, Frau (?)
1
Recketer, Herr (?)
1
Redtel, Herr von
1
Rehausen, Gotthard Mauritz von
8
Rehberg, Auguste Charlotte Marie
1
Rehberg, Carl Georg Friedrich
1
Rehberg, Frau (Mutter von August Wilhelm und Caroline Rehberg)
36
Rehfues, Julius Karl Heinrich
3
Rehkopf, Christiane Brigitte
1
Reichenbach, Frau von
1
Reichensperger, Herr
1
Reimer, Bernhard Traugott
1
Reinbold, Herr (Pastor in Döhren)
1
Reineke, Herr
1
Rendenbach, Franz
1
Rendorp, Anna Maria (geb. Dedel)
1
Rendorp, Johanna Ferdinanda (geb. van Collen, gen. Hansje)
4
Rettel, Herr von
2
Reuß, Herr von
2
Reventlow-Criminil, Charlotte Juliane von (geb. von Platen zu Hallermund)
1
Rew, John
1
Rheden, Herr von
1
Rheinsberg, Herr Graf von
1
R., Herr
1
Ribbentrop, Herr
1
Riccardi, Frau (?)
2
Riccardi, Herr (?)
2
Richter (Familie in Jena)
1
Riemann, Herr
1
Rilliet, Frédéric
1
Ritter, Heinrich Josef von
1
Rizzardi, Herr
1
Robinson, Herr
1
Rocca, Charles
2
Rocheux, Herr
4
Rodais, Pierre-André Geoffrenet de
1
Roeder, Frau
1
Roerich, Herr (?)
1
Roggenstiel, Franzsika
1
Rohr, Herr
1
Rolffs, Frau
2
Roose, Frau
2
Roose, Robert von
2
(Rose)
24
Rosenzweig, Fräulein
1
Rospigliosi, Maria Ottavia (geb. Odescalchi)
1
Rothenburg, Frau von
1
Roth, Friedrich
1
Rothschild, Caroline von (geb. Stern)
3
Röttgen, Heinrich
4
Rous, Anselme Jean
1
Rouyer, Herr
1
Royer-Collard, M.
1
Rua, Hunnenreich, König
1
Ruedorffer, Robert von
1
Ruffo, Kardinal
1
Rühling, Herr
1
Ruperti, Herr
1
Russell, Lady William (Elizabeth Anne)
2
Rut (bibl. Figur)
1
Ryser, Herr (?)
1
Sainte-Aulaire, Egédie Wilhelmine de
5
Sainte-Aulaire, Joseph-Louis-Camille Beaupoil de
1
Sainte-Aulaire, Marie de
2
Saint-Julien, Jean-Louis Bancal de
1
Saint-Priest, Louise (geb. de Riquet de Caraman-Chimay)
1
Saladin, Fräulein
1
Salfeld, Frau
1
Salfeld, Johanne Christine
4
Salis, Herr von
1
Salm-Reifferscheid, Maria Antonia zu
3
Sanderson, Frau
1
Sanguszko, Prinzessin
1
Sartorius, Frau
1
Saussure, Herr de
1
Schall, Herr (?)
1
Scharf, Herr
1
Schede, Carl
5
Schede, Caroline (geb. Wucherer)
7
Schede, Frau
1
Schede, Herr
1
Scheel, D.
1
Schelling, Amtsschreiber
2
Schelling, Gottlieb
1
Schelling, Gottliebin Marie (geb. Cleß)
4
Schelling, Herr (Generaladjutant)
2
Scherenburg (Scheerenberg), Reinhard
2
Scherz, Johann Georg
3
Schick, Herr (Sohn)
2
Schickler, Herr
2
Schiergens, Leonard
1
Schier, Herr von
1
Schierstadt, Frau (?)
1
Schierstedt-Reichenwalde, Albertine Ulrike Luise von (geb. Finck von Finckenstein)
4
Schierstedt-Reichenwalde, August Wilhelm von
12
Schierstedt-Reichenwalde, Friederike Amalie Ernestine von (geb. Finck von Finckenstein)
4
Schiferli, Frau
2
Schiffenhuber-Hartl, Anna (Nina, nach Overbeck)
19
Schikler, Herr
1
Schindler, Adolph Ferdinand
8
Schindler, Augusta Sophia (geb. Weiße/Weise)
6
Schindler, Carl August
7
Schindler, Carl Philipp
6
Schindler, Frau (geb. Weiße/Weise, jun.)
2
Schindler, Herr
2
Schindler, Johann Friedrich
7
Schinner und Klinger
4
Schirmer, Ludwig
11
Schläger, Luise
2
Schläger, Seneca (?)
1
Schlammersdorff, Frau von
2
Schleich, Anna Maria von
1
Schleich, Elisabeth von
1
Schleich, Katharina von
1
Schleiden, Elise van (geb. Nuys)
9
Schmid, Herr
1
Schmidt, Carl Ernst
1
Schmidt, Frau (Braunschweig)
1
Schmidt, Frau (Hannover)
1
Schmidt, Herr (Hannover)
3
Schmiedel, Michael
1
Schneider, Herr (Anwalt)
1
Schneider, Wilhelm
1
Scholz, Herr
1
Schöps, Friedrich Karl von
2
Schouffelberger, Daniel-François
1
Schrader, Herr
1
Schreiber, Herr
3
Schroeter, Herr von
1
Schuferti, Herr
2
Schulenburg, Anna Charlotte Ferdinandine von der (geb. von der Asseburg)
1
Schulenburg, Edo Friedrich Christoph Daniel von der
5
Schulenburg, Helene Alexandrine Charlotte Florentine von der (geb. von Schöning-Jahnsfelde)
5
Schüller, Herr
1
Schultz, Frau (Geheimrätin)
1
Schultz, Herr (Geheimrat)
1
Schulzenheim, Herr von
2
Schulz, Herr (Berlin)
1
Schulz, Herr (Leipzig)
1
Schulz/Schutze, Herr (Nennhausen)
2
Schumacher, Gebrüder
1
Schütz, Frau
1
Schütz, Georg Ferdinand
1
Schwaabe, Herr
1
Schwadke, Karl Wilhelm
2
Schwartz, Friedrich von
1
Schwarz, Herr
1
(Schwedischer Graf in Amsterdam)
1
Schweinitz, Hans Julius von
10
Schweizers
1
Schweppe, Levin Friedrich
1
Schwerin, Herr von
3
Seebeck, Frau
1
Seebeck, Herr
1
Seegers, Herr
1
Seidler, Frau
1
Seidler, Herr
1
Sekretär von August Wilhelm von Schlegel
3
Serigny, Frau
3
Seyler, Abel
1
Seymour, Frances (Fanny, geb. Smith)
1
Seymour, Herr
1
Shank, Henry
1
Siedler, Herr (Leipzig)
1
Siersdorpff, Marie Sophie von
3
Signeul, Elof
8
Simon, Herr
1
Sinclair, Carl Gustav von
1
Six, Jacoba Maria (geb. Deutz)
1
Six, Nicolaas
1
Skinner, Mary (geb. Routledge)
2
Skinner, Samuel
2
Smith, Belinda (geb. Colebrooke)
1
Smith, George
5
Smith, George Thomas
10
Smith, Herr
4
Smölders, Herr
1
Solms-Laubach, Reinhardt zu
3
Somerset, Emily Harriet (geb. Wellesley-Pole)
1
Sommerfeld, Juliane Auguste Theodora von (geb. Gehser)
1
(Sophie)
14
Söthel, Frau (?)
1
Spall, Anna Pauline
39
Spall, Carl Adolph
32
Spall, Heinrich
18
Spall, Wilhelm Ernst Friederich
7
Sparre af Rossvik, Bengt Erik Ludvig
1
Sparre af Rossvik, Carl Ulrik
1
Sparre af Rossvik, Ebba Margareta (geb. De Geer af Leufsta)
1
Sparr, Herr
1
Späthe, Herr
1
Springstok, Herr
1
Staël-Holstein, Charles de
1
Staë͏̈l-Holstein, Herr (?)
4
Staël-Holstein, Herr (General)
1
Staël-Holstein, Joseph de
1
Stäheli, Herr Dr.
3
Stahl, H.
1
Stampel, Herr
1
Starhemberg, Franz Josef von
2
Steigner, Herr (jun.)
1
Steigner, Herr (sen.)
1
Steinberger, Johann Adolph Joseph
2
Steinbrech, Herr
1
Steinhauß, Herr
1
Steinwirker, Herr
1
Stelling, Herr
1
Stenzler, Lorenz
3
Stieglitz, Herr (1. Sohn)
1
Stieglitz, Herr (2. Sohn)
1
Stieglitz, Sophie Jeanette (Jente, geb. Ephraim)
6
Stoll, Herr
1
Stoll, Josef Ludwig
19
Strassoldo, Leopold von
1
Strohmeyer, Johann Andreas
1
Stromeyer, Louise, geb. Louis
1
Strube, Herr
2
Stupan, Bernhard (?)
1
Swertkow, Frau von
1
Swertkow, Herr von
1
Symonds, Nathaniel Warner
1
Tages (Gott)
1
Tarchon
1
Taylor, Herr
1
Teichmann, Frau
1
Temple, Lady
2
Temple, Lord
1
Theiß, Herr
1
Themmer, Herr
1
Thompson, William
1
Thormann, Frau
1
Thornhill, John
3
Thornton, Magdalena Wilhelmina Amalia (geb. Kohp)
2
Thurneysen, Johann Rudolf
10
Thym, Herr
1
Tinney, William
1
Tischbein, Frau (geb. Glockenbringk)
2
Titinius
1
Tobin, Frau
2
Tod, Julia (geb. Clutterbuck)
1
Tönniges, Elise
1
Tönniges, Familie von
1
Tönniges, Johann Friedrich
1
Tottie, Frau
1
Trebra, Augusta Sophia von (geb. von Hartitzsch)
1
Trembler, Herr
1
Treuttel, Charles
2
Trimborn, Friedrich Ferdinand
1
Troschel, Ernst Leberecht
10
Trostheim, Familie
1
Troxler, Wilhelmine (geb. Polborn)
1
Trummer, Frau
1
Trummer, Frau (Madame Trummer)
1
Trummer, Frau (Mutter von Charlotte Schlegel)
1
Trummer, Johann Paul
2
Tucker, Henry St. George
1
Tuck, Herr van der
1
Tümpling, Herr
2
Turner, J. M.
1
Turrettini, Albertine Sophie Bénédicte (geb. Necker)
1
Turrettini, Herr
2
Ucalegon
2
Uginet, Joseph (genannt Eugène)
26
Uginet, Olive (geb. Complainville)
2
Uhle, Frau
3
Usedom, Charlotte Olympia von (geb. Malcolm)
4
Uttenhofen, Herr von
1
Veit, Flora (geb. Ries)
1
Velden, Johanna Margaretha van den (geb. Lampsins)
1
Velfi, Pietro (?)
1
Velthausen, Familie
1
Vergier de La Rochejaquelein, Louis du
1
Vernet, Marie Anne (geb. Pictet)
6
Veyrac, Frau de
1
Veyrac, Herr de
1
Vieth von Golssenau, Emilie Sophie Henriette
1
Vieth von Golssenau, Karl Wilhelm
1
Villers, Herr de (Bruder von Charles de Villers)
1
Villiers, Herr
1
Villiers, Herr (Direktor)
1
Vincent, Herr
1
Vincent, Herr von
1
Vogt, Frau
1
Vogt, Herr
1
Volkhausen, Herr
1
Volkmann, Friedrich August
1
Vologaeses I.
1
Vom Stein Zum Altenstein, Herr (Sohn)
1
Von der Lahr, Jean Pierre
3
Von der Lahr, J. Raymond
6
Vonones II.
1
Vorsteher (in Köln)
1
Wächter, Friedrich Christoph
1
Wagener (oder: Wegener), Herr
1
Wagner d’Yverdon, Julie de
5
Wahrendorf, Frau
1
Waitz, Herr von
1
Wallmoden, Karl August Ludwig von
1
Wallmoden-Liechtenstein, Luise Christiane von
2
Walter, Clara (geb. Menningen)
1
Walter, F. A.
1
Wangenheim, Frau von
1
Wangenheim, Herr von
2
Washington, Eleonora (geb. Askew)
1
Wassmer, Fräulein
1
Wasthald
1
Watteville, Emar de
9
Watteville, Frau
3
Watteville, Frau
1
Watteville, Herr
1
Watteville, Herr
1
Wbrna, Anna Flora von
1
Weber, Fräulein
4
Weddik, Herr
1
Wedekind, Sophia Magdalena
1
Wedekind, Wilhelmine Ludovika (Luise)
1
Wedell, Charlotte von (geb. Pückler-Gröditz)
2
Weede, Willem van
1
Weerth, Herr
1
Wegener/Weger, Herr
3
Wehner, Ludolph David
1
Wehrden, Heinrich von
45
Weidmann, J.
4
Weise, Herr (Magdeburg)
1
Weiße, Familie (Dresden)
2
Weiße, Familie (Magdeburg)
2
Weissen, Auguste Sophie (?)
1
Weissen, Herr (?)
1
Welthuysen, Herr (?)
2
Wenner, Franz
2
Werden, R. von
1
Werner, Herr (Hofmeister)
1
Westmorland, John Arthur Fane
1
Wetzlar von Plankenstern, Johann Adam, Freiherr
1
Whitmore, Frau
1
Whitmore, John
1
Wichmann, Wilhelmine (Mine/Miene; Dienstmädchen von Sophie Bernhardi in Berlin)
7
Wiedemann, August
1
Wiedemann, Fräulein
2
Wiedemann, Konrad Eberhard
1
Wigram, William
2
Wilder, Augusta (geb. Smith)
1
Wild, Franz Peter
6
Wilford, Francis
5
(Wilhelm, Diener in Coppet)
1
Wilhelmi, Johann Conrad II
3
Wilken, Familie (Hannover)
1
Willig, Herr
1
Wilson, Charles Thomas
1
Wilson-Patten, Elizabeth (geb. Hyde)
1
Wimpje (?)
1
Winckelmann, Frau
1
Winckelmann, Frau
1
Winckelmann, Herr
2
Windisch-Graetz, Aglae Eleonora von
1
Windisch-Graetz, Alfred Nicolaus von
1
Windisch-Graetz, Eleonore von (geb. von Schwarzenberg)
1
Windisch-Graetz, Victorin Leopold von
1
Winkler, Frau
1
Winkler, Herr
1
Winkler, Th. F.
1
Winter, Christian
2
Wirseen, Herr von
1
Wocher zu Oberlochen und Hausen, Franz Joseph von
2
Wolfdietrich (Sagengestalt)
1
Wölfel, Herr
1
Wolff, Abraham Hirsch
3
Wolff, Babette (Bertha, geb. Türck)
3
Wolff, J. (Bankier)
1
Wolff, Rosa (geb. Landau)
2
Wolff, Samuel
22
Wolf, Herr von
2
Wollheim, Anton Edmund
3
Wolper, Hermann
45
Wolter, Herr
2
Wrisen, Herr von
1
Wüllen, Frau (Hannover)
1
Wust, Frau
1
Wust, Herr (Schneider in Berlin)
8
Wüst, H. J. S.
1
Xavier, Francisco
1
Yarde-Buller, Elizabeth (geb. Wilson-Patten)
1
Yarde-Buller, John, 1st Baron Churston
1
Yates, Herr
1
Young, Peter Thomas
1
Young, William
2
Zapf, Johann Justin
2
Zeerleder, Charlotte von (geb. von Haller)
1
Zehender, F. R.
1
Zeuner, Fräulein
1
Zichy-Vásonykeő, Sophie von
2
Zickler (Familie in Jena)
1
Zimmermann, Herr
1
Zimmermann, Luise Margarethe (geb. von Berger)
2
Zirkel, Herr
1
Zitman, Herr
1
Zopyros I.
1
Akademischer Ausschuß zur Herausgabe der Werke Friedrich des Großen in Berlin
5
Amsterdamer Akademie der Dichtkunst und schönen Wissenschaften
2
Archiv des kaiserlichen und Reichskammergerichtes (Aschaffenburg)
1
Bankhaus Cahn (Bonn)
3
Bengal Army
1
Bishop’s College (Kalkutta)
1
Board of Commissioners for the Affairs of India (London)
2
Bonn-Cölner Eisenbahn-Gesellschaft
3
Britische Regierung
3
Bürgerschule Siegburg
2
Burkersrodaer Fräuleinstift (Dresden)
5
C. E. Wiedemann & Sohn
1
Chinesisches Kabinett (Gotha)
1
Concordia et libertate (Amsterdam)
1
Dambray Fils
2
Deutscher Verein (London)
2
Drummond Bank
6
East India Company College (Hailey, Hertfordshire; Haileybury and Imperial Service College)
16
Erziehungs- und Unterrichtsanstalt der Gebrüder Schumacher (Köln)
2
Fould, Oppenheim & Co
1
France. Ministère des affaires ecclésiastiques et de l’instruction publique
5
(Frauen-Verein, Bonn)
1
Gautier fils (Metz)
2
Gebrüder Benecke (Berlin)
1
Gebrüder Kehr & Niessen
1
Giles, Son & Sidgwick (London)
3
Goll und Söhne (Frankfurt am Main)
1
Great Britain. Army.
1
(Griechen-Verein, Bonn)
1
Guyot (Guiot?) et Co., Bern
3
Haller und Co.
2
Hesshuizen & Comp. (Naarden)
2
Hoogduitse Schouwburg (Deutsches Theater, Amsterdam)
1
I. M. Gellers Söhne (Braunschweig)
1
(Industrieschule für Mädchen, Hannover)
3
Irren-Heilanstalt Bayreuth
1
Jahns Traiteurie
1
Josiah Wedgwood & Sons Ltd
1
Jugend-Vereinsorden (?)
1
Karl Winterʼs Universitätsbuchhandlung
1
König & Comp. (Hannover)
1
Königliche Akademie der Bildenden Künste und Mechanischen Wissenschaften zu Berlin (1790-1809)
2
GND
Königliches Katholisches Gymnasium (Oppeln)
1
Königliche Stadtdirektion Stuttgart
1
Königliche Steuer-Kasse (Bonn)
1
Königlich-Preußische Gesandtschaft (Frankfurt am Main)
1
Königlich-Preußische Gesandtschaft (Paris)
2
Konsistorium (Breslau)
1
Konsistorium (Koblenz)
1
Literary Union Club (Clarence Club)
2
Lithographische Anstalt (Koblenz)
1
Lithographische Anstalt (Köln)
1
London Theatre
1
Molini (Florenz)
1
Muilman & Soonen (Amsterdam)
3
Natione Germanica apud Bononiam
1
New London College
1
Oelsisches Corps
1
Pall Mall Libraries
1
Peter Metzler (Weinhandel in Frankfurt a. M.)
1
Piatti (Florenz)
1
Putz & Gougeon (Metz)
1
Raleigh Club (London)
1
Remington & Co. (Bombay)
1
Renault & Bettinges (Sierck-les-Bains)
1
Rennes et Co. (Lyon)
3
Römischer Hof (Berlin)
2
Russische Gesandtschaft (London)
1
Sala Tarone & Co
1
Sammlung Giustiniani
1
(Schachspiel-Gesellschaft, Bonn)
2
Scherer und Tingerlin
1
Sellschopp & Huart (Amsterdam)
6
Senn, Guebhard & Co. (Livorno)
2
Societät für Wissenschaftliche Kritik (Berlin)
7
Späthensche Druckerei
2
St-Louis-en-l’Île (Paris)
1
Tottie & Arfwedson
6
Tottie und Compton
29
Verein für Beethovens Denkmal (Bonn)
11
Veuve Bénoit
1
Weinhandlung Pleunissen Köln
3
W. H. Allen & Co. (est. 1835)
4
Whig Party
2
Zollamt (Bonn)
1
Aruküla (Arroküll)
2
Baden bei Wien
1
Barkloughly Castle
2
Bolenzano (Provinz Lodi)
1
Broglie (Eure)
22
Brunstein/Brunnstein (?)
2
Bryn Estyn (Wrexham)
1
Burgruine Rottenburg (Buch in Tirol)
2
Büyükdere
1
Candé-sur-Beuvron
1
Červená Hora (Rothenburg)
1
Château de Fleury-en-Bière
1
Crans (Jura)
1
Ervita (Järva/Koeru)
2
Faubourg Saint-Germain (Paris)
1
Grossen (?)
1
Havelberg
1
Heldenburg (Burg Salzderhelden)
1
Kinnordy (Forfarshire)
1
Kirriemuir
1
La Grange (La Longine, Haute-Saône)
2
Lambton, Tyne and Wear
2
Les Ormes
2
Marienburg (Malbork)
1
Morgenthal
2
Nagasaki
1
Niederjugelheim
1
Oldenhave (Ruinen, Drenthe)
1
Palais des Prinzen Heinrich (Berlin)
1
Perd
1
Polvellan (Looe, Cornwall)
1
Pontefract Castle
2
Ravenspurn
2
Ravensworth Castle (Tyne and Wear)
1
Rostarzewo (Rothenburg an der Obra)
1
Schawel
1
Schloss Monbrillant (Hannover)
1
Schwalbach
1
Siegersdorf (Zebrzydowa, Niederschlesien)
2
Udaipur (Madhya Pradesh)
1
Walwen (?)
1
Zewitz
1
Acerbi, Giuseppe: Travels through Sweden, Finland and Laplan to the North-Cape in the years 1798 and 1799
2
Ackermann, Paul: Dictionnaire des antonymes ou contremots
1
Ackermann, Paul: Du principe de la poésie et de lʼéducation du poète
1
Adelung, Friedrich von: An Historical Sketch of Sanscrit Literature [...]. Ü: David Alphonse Talboys
1
Adelung, Friedrich von: Nachrichten von altdeutschen Gedichten, welche aus der Heidelbergischen Bibliothek in die Vatikanische gekommen sind
2
Adelung, Friedrich von: Versuch einer Literatur der Sanskrit-Sprache
2
Adelung, Johann Christoph: Älteste Geschichte der Deutschen, ihrer Sprache und Litteratur, bis zur Völkerwanderung
1
Adelung, Johann Christoph: Jacob Püterich von Reicherzhausen
2
Adelung, Johann Christoph: Mithridates, oder allgemeine Sprachkunde mit dem Vater Unser als Sprachprobe in bey nahe fünf hundert Sprachen und Mundarten
2
GND
Adelung, Johann Christoph: Umständliches Lehrgebäude der deutschen Sprache
1
Aeschylus: Die Schutzgenossinnen [Ü: August Wilhelm von Schlegel] (Teilübersetzung, in: Athenaeum)
2
Aeschylus: Kassandra, aus dem Agamemnon [Ü: Heinrich Voß]
1
Aeschylus: Orestie. Eumeniden. [Ü: August Wilhelm von Schlegel] (Teilübersetzung)
5
Aeschylus: Orestie. Eumeniden [Ü: Wilhelm von Humboldt]
1
Aeschylus: Seelenwägung (dritter Teil der verschollenen Triliogie)
1
Aeschylus: Tragoediae [Ü: Christian Gottfried Schütz]
9
Aeschylus: Trilogie (verschollen)
1
Aeschylus: Vier Tragödien [Ü: Friedrich Leopold zu Stolberg-Stolberg]
7
Aeschylus: Werke
1
Ahlefeld, Charlotte von: Gedichte von Natalie
2
Ahlwardt, Christian Wilhelm: Zur Erklärung der Idyllen Theokrits
1
Aimonus, Floriacensis: Historia Francorum
1
Aimonus, Floriacensis: Vita et martyrium S. Abbonis abbatis
1
Akenside, Mark: Hymn to the Naiads
3
Åkerblad, Johan David: Iscrizione greca sopra una lamina di piombo trovata in un sepolcro nelle vicinanze di Atone
1
Åkerblad, Johan David: Notice sur deux inscriptions runiques, trouvées à Venise
2
Alberti, Maria: Bildnis von Auguste Böhmer
2
Alberti, Maria: Bildnis von Karl von Hardenberg
1
Alembert, Jean Le Rond dʼ: Œuvres philosophiques, historiques et litteraraires
1
Alfredus, Beverlacensis: Chronicon regum Angliae ab adventu Bruti usque ad A. C. 1129
1
Alter, Franz Karl: Mélanges philologiques et critiques
1
Althof, Ludwig Christoph: Einige Nachrichten von den vornehmsten Lebensumständen Gottfried August Bürgers
1
Alton, Eduard dʼ: (Abhandlung)
1
Alton, Eduard dʼ: Oldenbarneveld gewarnt. Kupferstich nach: Anonymus: Die Familie Olden-Barneveld. Sieben Figuren in Lebensgröße (zeitweise Peter Paul Rubens zugeschrieben)
1
Alxinger, Johann Baptist von: Doolin von Maynz
5
Ammonius, Alexandrinus: Harmonia Evangeliorum
1
Ancillon, Johann Peter Friedrich: Über Souveränität und Staatsverfassungen
1
André, Johann; Dalayrac, Nicolas: Nina oder Wahnsinn aus Liebe
2
André, Johann: Der alte Freier
1
Andréossy, Antoine-François: Délassement (Fragment)
2
Andrés, Giovanni: Dellʼorigine, progressi e statu attuale dʼogni letteratura
1
Angelico (Fra): Die Krönung der Maria
2
Anonymer Brief aus Paris. In: Indische Bibliothek
1
Anonymi Belae regis notarii, Historia Hungarica de septem primis Ducibus Hungariae
1
Anonymus: Apologie der Versuche durch Elementar-Philosophie und Wissenschafts-Lehre die Kritische Philosophie zur Wissenschaft katʼ exochen zu erheben
1
Anonymus: Auguste-Guillaume de Schlegel. In: Nouvelle Revue germanique; recueil littéraire et scientifique
1
Anonymus: A Yorkshire Tragedy (Thomas Middleton zugeschrieben; zeitweise William Shakespeare zugeschrieben)
2
Anonymus, Belae Regis Notarius: Gesta Hungarorum
1
Anonymus: Berg, Franz: Lob der allerneuesten Philosophie
4
Anonymus: (Brief an Victor Hugo)
1
Anonymus: Der Thurm zu Babel, oder die Nacht vor dem neuen Jahrhundert
2
Anonymus: (Der Tod Abels, Gemälde)
3
Anonymus: Die Familie Olden-Barneveld (zeitweise Peter Paul Rubens zugeschrieben)
1
Anonymus: Die Nichten (Manuskript)
3
Anonymus: Die Xenien in Schillers Almanache für das Jahr 1797.
1
Anonymus: Friedrich August Landvoigt. In: Neuer Nekrolog der Deutschen, Vierzehnter Jahrgang, zweiter Teil
1
Anonymus: George a Green, the Pinner of Wakefield (Robert Green zugeschrieben)
1
Anonymus: Goethe's Life of Himself (Rezension zu: Goethe, Johann Wolfgang von: Aus meinem Leben. Dichtung und Wahrheit). In: The Edinburgh Review. Bd. 26, Juni 1816, S. 304-337
1
Anonymus: Gruppe von drei Figuren: einer bejahrten Frau, einem jungen Mädchen, und einem Knaben (zeitweise Antonio Allegri da Correggio zugeschrieben)
1
Anonymus: Herodias
1
Anonymus: Histoire générale et particulière de Bourgogne
1
Anonymus: Huius nympha loci
1
Anonymus: Joggeli und Änneli
1
Anonymus: Lohengrin
1
Anonymus: Nieuw Nederlandsch Keukenboek, ten dienste van koks, keukenmeiden en jonggehuwde vrouwen (1838)
1
Anonymus: Recueil de cartes géographiques, plans, vùes et médailles de lʼancienne Grèce, relatifs au voyage du jeune Anarcharsis
1
Anonymus: Reinfried von Braunschweig
1
Anonymus: Relation von dem durch die Xenien veranlaßten Wesen und Unwesen in der litterärischen Welt; in Briefen an einen außerhalb dieser Welt lebenden Freund (1797)
1
Anonymus: Schattenspiele (bei Fr. Maurer)
1
Anonymus: Schelling, Friedrich Wilhelm Joseph von: Zeitschrift für spekulative Physik; Schelling, Friedrich Wilhelm Joseph von; Hegel, Georg Wilhelm Friedrich: Kritisches Journal der Philosophie (Rezension)
1
Anonymus: Schlegel, August Wilhelm von: Essais littéraires et historiques (Rezension)
2
Anonymus: Schlegel, August Wilhelm von: Réflexions sur lʼétude des langues asiatiques (Rezension)
1
Anonymus: Schlegel, August Wilhelm von: Über dramatische Kunst und Litteratur. Vorlesungen. Bd. 1 (Rezension in der „Zeitung für die elegante Welt“ Nr. 24 v. 26.09.1809)
1
Anonymus: Schreiben eines Ungenannten an die Herausgeber der Allgemeinen Literatur-Zeitung
1
Anonymus: Schreiben eines Vaters an seinen studierenden Sohn über den Fichtischen und Forbergischen Atheismus
1
Anonymus: Ternite, Wilhelm: Le Couronnement de la Saint Vierge, et les miracles de Saint Dominique. [...] Avec une notice sur la vie du peintre et une explication du tableau par Auguste-Guillaume de Schlegel (Rezension)
1
Anonymus: The London Prodigal (u.a. William Shakespeare zugeschrieben)
2
Anonymus: The Merry Devil of Edmonton (zeitweise William Shakespeare zugeschrieben)
1
Anonymus: The Puritan, or the Widow of Watling Street (Thomas Middleton, John Marston oder William Shakespeare zugeschrieben)
2
Anonymus: The True Cronical Historie of The Whole Life and Death of Thomas Lord Cromwell
2
Anonymus: Ueber den Briefsteller Jacobi an Fichte
1
Anonymus: Urtheil über Falks satirischen Almanach
1
Anonymus: Von eines küniges tochter von frankreich ein hübsches lesen wie der künig sie selbs zu dʼEe wolt hon [...]
1
Anonymus: Walther von Aquitanien
3
Anonymus: Zeichnung von Auguste Böhmer
1
Anton, Karl Gottlob: Geschichte der teutschen Landwirtschaft von den ältesten Zeiten bis zu Ende des funfzehnten Jahrhunderts
1
Anton, Karl Gottlob: Über Sprache in Rücksicht auf Geschichte der Menschheit
1
Anville, Jean Baptiste Bourguignon dʼ: Géographie ancienne abrégée
1
Apel, Johann August: Polyïdos
2
Apel, Johann August: Schiller, Friedrich: Die Jungfrau von Orleans (Rezension)
2
Apelles: Venus Anadyomene
1
Apudy, A. L.; Chézy, Antoine Léonard de: Anthologie érotique d’amarou
3
Archenholz, Johann Wilhelm von: Sobiesky
1
Aretin, Johann Christoph von: Systematische Anleitung zur Theorie und Praxis der Mnemonik
1
Aretino, Pietro: Sonette
4
Ariosto, Ludovico: Aus dem ersten Gesange des Rasenden Roland [Ü: Johann Diederich Gries]
1
Ariosto, Ludovico: Eilfter Gesang des rasender Roland [Ü: August Wilhelm von Schlegel]
10
Ariosto, Ludovico: Rasender Roland Bd. 1 [Ü: Johann Diederich Gries]
1
Ariosto, Ludovico: Rasender Roland Bd. 2 [Ü: Johann Diederich Gries]
1
Ariosto, Ludovico: Rasender Roland [Ü: Johann Diederich Gries]
17
Ariosto, Ludovico: Roland der Wüthende ein Heldengedicht von Ludwig Ariost dem Göttlichen [Ü: Wilhelm Heinse]
1
Aristophanes: Comoediae, auctoritate libri praeclarissimi saeculi decimi emendatae a Philippo Invernizio, iurisconsulto romano (1794)
4
Aristophanes: Die Lustspiele [Ü: Hieronymus Müller]
1
Aristophanes: Die Ritter [Ü: Christoph Martin Wieland]
1
Aristophanes: Die Wolken [Ü: Christoph Martin Wieland]
1
Aristophanes: Komödien [Ü: Johann Gustav Droysen]
1
Aristophanes [Ü: Johann Heinrich Voß]
1
Aristophanes: Werke
2
Aristophanes: Wolken [Ü: Friedrich August Wolf]
2
Aristoteles: Poëticae [Ü: Jakob Josef von Haus]
3
Armstrong, John: Of Benevolence
1
Arndt, Carl Friedrich Ludwig: Glossar zu dem Urtexte des Liedes der Nibelungen und der Klage
1
Arndt, Ernst Moritz: Die Glocke der Stunde in 3 Zügen
1
Arndt, Ernst Moritz: Gedichte
1
Arndt, Ernst Moritz: Geist der Zeit
1
Arndt, Ernst Moritz: (Pasquill gegen August Wilhelm Schlegel)
1
Arnim, Achim von: Beylage zur Zeitung für Einsiedler
1
Arnim, Achim von; Brentano, Clemens: Wunderhorn Bd. 1
2
Arnim, Achim von; Brentano, Clemens: Wunderhorn Bd. 2
2
Arnim, Achim von; Brentano, Clemens: Wunderhorn Bd. 3
1
Arnim, Achim von: Nachwort zu Jean Pauls „Friedenspredigt an Deutschland“
1
Arnim, Achim von: Schlegel, Friedrich von: Gedichte (Rezension)
2
Artus-Stoff
4
Äschylos (Aeschylus) [Ü: Heinrich Voß]
2
Asinari die Camerano, Federico: La Gismonda
1
Ast, Friedrich: Krösus
2
Ast, Friedrich: System der Kunstlehre
1
Atlas antiquus dʼAnvillanus
1
Auguste-Jean-Baptiste Defauconpret: Anecdotes sur la cour et lʼinteriéur de la famille de Napoléon Bonaparte
1
Austin, John: Vorlesungen
1
Aventinus, Johannes: Annales ducum Boiariae
1
Ayrer, Jakob: Opus Theatricum
8
Baader, Franz von: Schriften
2
Baader, Franz von: Über das durch die französische Revolution herbeigeführte Bedürfnis einer neuen und innigen Verbindung der Religion mit der Politik
1
Baader, Franz von: Über die Analogie des Erkenntnis- und Zeugungstriebes
2
Baader, Franz von: Über Starres und Fließendes
1
Baber, Henry Hervey (Hg.): Vetus Testamentum Graecum e codices Ms. Alexandrino
1
Babo, Joseph Marius von: Die Mahler
1
Babo, Joseph Marius von: Otto von Wittelsbach Pfalzgraf in Bayern
3
Bābū Rāma (Hg.): Mānavadharmaśāstra
1
Bābū Rāma (Hg.): Śrīmad Bhagavad Gītā
4
Bach, Johann August: Historia Jurisprudentiae Romanae
1
Bach, Johann Nicolaus: De Marco Aurelio Antonio, imperatore philosophante ex ipsius commentariis scripto philologica
2
Bach, Johann Nicolaus (Hg.): Mimnermi colophonii carminum quae supersunt
1
Baggesen, Jens: Der Karfunkel oder Klingelklingel-Almanach
2
Bähr, Johann Christian Felix: Geschichte der Römischen Literatur
1
Bailey-Fahrenkrügerʼs Wörterbuch der englischen Sprache
2
Bailey, Nathan: (Wörterbuch)
1
Bailleul, Jacques-Charles: Examen critique le lʼouvrage de Mme de Staël
4
Baillie, Joanna: The Bride
1
Balde, Jakob: Gedichte
1
Baldi, Francesco Antonio: Incognitorum hactenus vaticiniorum de cruce
1
B.: An einen Freund
1
Barante, Amable-Guillaume-Prosper Brugière de: Notice biographique et littéraire sur Schiller
2
Barante, Amable-Guillaume-Prosper Brugière de: Tableau de la littérature française au XVIIIe siècle
3
Bardili, Christoph Gottfried: Grundriß der ersten Logik
2
Baronio, Cesare: Annales ecclesiastici a Christo nato ad annum 1198
4
Basilius, Caesariensis: Opera
1
Bastero, Antonio: La crusa Provenzale
2
Bayle, Pierre: Dictionnaire historique et critique
2
Beaufort, Louis de: Dissertation sur l’incertitude des cinq premiers siècles de l’histoire romaine
2
Beaumarchais, Pierre Augustin Caron de: Eugenie
1
Beck, Christian Daniel: Anleitung zur Kenntniß der allgemeinen Welt- und Völker-Geschichte für Studirende (4 Bde., 1787–1807; 2. Aufl. v. Bd. 1: 1813)
2
Beck, Christian Daniel; Morus, Samuel Friedrich Nathanael: Euripidis Tragoediae
1
Becker, Karl Ferdinand: Der Organismus der Sprache (1827)
1
Becker, Karl Ferdinand: Die deutsche Wortbildung oder die organische Entwickelung der deutschen Sprache in der Ableitung
2
Becker, Wilhelm Gottlieb: Darstellungen
1
Beck, Heinrich: Das Chamäleon
6
Beer, Wilhelm; Mädler, Johann Heinrich von: Beiträge zur physischen Kenntniss der himmlischen Körper im Sonnensysteme (1841)
1
Bellarmino, Roberto: De scriptoribus ecclesiasticis
1
Benary, Ferdinand: Nalodaya
2
Benary, Ferdinand: Werke
1
Benecke, Georg Friedrich (Hg.): Minnelieder
2
Benecke, Georg Friedrich, Lachmann, Karl (Hg.): Iwein, der Ritter mit dem Lewen
3
Benkowitz, Karl Friedrich: Der Messias von Klopstok, ästhetisch beurtheilt und verglichen mit der Iliade, der Aeneide und dem verlornen Paradiese
4
Bentley, John: A Historical View of the Hindu Astronomy, from the earlist dawn of that science in India, to the present time
1
Bentley, Richard: Opuscula philologica
1
Beresford, Benjamin: A Collection of German Ballads and Songs with their original Music, done into English by the Translator of the German Erato
5
Beresford, Benjamin: A Supplement to the German Erato, containing a Collection of Favourite Songs, with their Music, translated by the same Hand
3
Beresford, Benjamin: The German Erato
5
Beresford, Benjamin: Translations of German Poems, extracted from the musical publications of the author of the German Erato
1
Beresford, Benjamin: Werke
3
Berger, Christoph Heinrich von: Commentatio de personis vulgo larvis seu mascheris
1
Berger, Johann Erich von: Der Baum des Lebens
1
Berg, Franz: Lob der allerneuesten Philosophie
6
Bérinus
1
Berlepsch, Emilie von: Caledonia
1
Berlichingen, Götz von: Lebens-Beschreibung Herrn Gözens von Berlichingen, zugenannt mit der Eisernen Hand
4
GND
Bernhardi, August Ferdinand: An Sophie
1
Bernhardi, August Ferdinand: (Aufsatz)
1
Bernhardi, August Ferdinand: Bambocciaden
13
Bernhardi, August Ferdinand: Der Traum
7
Bernhardi, August Ferdinand: Die gelehrte Gesellschaft
2
Bernhardi, August Ferdinand: Gedichte
3
Bernhardi, August Ferdinand: Herder, Johann Gottfried von: Verstand und Erfahrung. Eine Metakritik zur Kritik der reinen Vernunft (Rezension)
13
Bernhardi, August Ferdinand: Hermann, Gottfried: Handbuch der Metrik (Rezension)
3
Bernhardi, August Ferdinand: Merkel, Garlieb Helwig: Briefe an ein Frauenzimmer (Rezension)
1
Bernhardi, August Ferdinand: Merope, Trauerspiel in fünf Akten nach Voltaire von (Friedrich Wilhelm) Gotter (Theaterkritik)
1
Bernhardi, August Ferdinand: Musenalmanach für das Jahr 1802 (Rezension)
1
Bernhardi, August Ferdinand: Sprachlehre
12
Bernhardi, August Ferdinand: Sprachlehre. Erster Theil: Reine Sprachlehre
1
Bernhardi, August Ferdinand: Sprachlehre. Zweyter Theil: Angewandte Sprachlehre
5
Bernhardi, August Ferdinand: (Theaterkritiken)
1
Bernhardi, August Ferdinand: Tieck, Ludwig: Leben und Tod der heiligen Genoveva (Rezension)
3
Bernhardi, August Ferdinand: Tieck, Ludwig: Romantische Dichtungen (Rezension)
2
Bernhardi, Felix Theodor von: La Russie et la Pologne
3
Bernhardi, Sophie: Ballade
5
Bernhardi, Sophie; Bernhardi, Felix Theodor von: (L’Oricalco risuona)
1
Bernhardi, Sophie; Bernhardi, Friedrich Wilhelm: (Quando la Primavera)
1
Bernhardi, Sophie: Bilder der Kindheit
8
Bernhardi, Sophie: Die Liebesgenesung
1
Bernhardi, Sophie: Donna Laura
19
Bernhardi, Sophie: Dramatische Fantasieen
12
Bernhardi, Sophie: Egidio und Isabella
31
Bernhardi, Sophie: Euphrosyne und Theodore (Fragment)
1
Bernhardi, Sophie: Evremont
1
Bernhardi, Sophie: Flore und Blanscheflur
68
Bernhardi, Sophie: (Gedicht)
3
Bernhardi, Sophie: Klagen I.–IV.
2
Bernhardi, Sophie: Lebensansicht
2
Bernhardi, Sophie: Lebenslauf
7
Bernhardi, Sophie: Oft entbrannt mein Herze wilde
1
Bernhardi, Sophie: (Romanze)
1
Bernhardi, Sophie; Schlegel, August Wilhelm von: Variationen
1
Bernhardi, Sophie: Vorrede zu „Flore und Blanscheflur“
1
Bernhardi, Sophie: Werke
1
Bernhardi, Sophie: Wunderbilder und Träume in eilf Märchen
15
Bernhardi, Sophie: Zwey Gesänge zum Amadis
2
Berni, Francesco: Orlando rifatto
1
Bernstein, Georg Heinrich (Hg.): Hitopadaesi Particula et glossarium Sanskrito-Latinum
10
Besser, Johann von: Werke
1
Bewick, Thomas: A general history of quadrupeds, the figures engraved on wood
1
Bewick, Thomas; Somerville, William: The chase (illustriert)
1
Bibel. Altes Testament
2
Bibel. Evangelien
2
Bibel. Hoheslied. Ü: Johann Gottfried von Herder
1
Bibel. Neues Testament
1
Bibliotheca classica latina sive collectio auctorum classicorum latinorum cum notis et indicibus
1
Bibliotheca Herderiana
1
Bibliothèque Britannique XXXV
1
Bidpai: Fabeln
4
Bidpai: Les Fables de Pilpay philosophe indien [Ü: Gilbert Gaulmin]
1
Bildnis einer Schwester des Kurfürsten Joseph Clemens (Köln, Erzbischof) in weißem Kleid mit Fürstenmantel (vermutl. Violante Beatrix (Toskana, Großherzogin))
3
Bildnis von Bertheau François Diederich
1
Biographie universelle et portative des contemporains ou Dictionnaire Historique des hommes vivants et des hommes morts depuis 1788 jusquʼa nos jours
1
Blum, Carl: Erziehungs-Resultate oder guter und schlechter Ton
1
Bobrik, Eduard: Vorlesungen
3
Boccaccio, Giovanni: L’Urbano
1
Böckh, August: De fragmento inscriptionis Atticae rationes operum publicorum continentis
1
Böckh, August: De titulis Melitensibus spuriis
2
Böckh, August: De ὑποβολῃ Homerica
1
Böckh, August: Graecae tragoediae principum
5
Böckh, August: Metrologische Untersuchungen über Gewichte, Münzfüße und Maße des Altertums in ihrem Zusammenhange
2
Böckh, August: Philolaos des Pythagoreers Leben
1
Böckh, August: Über die Versmaße des Pindarus
5
Böckh, August: Urkunden über das Seewesen des attischen Staates
1
Bode, Theodor Heinrich August: Gigantomachia
1
Bodmer, Johann Jacob; Breitinger, Johann Jakob: Critische Betrachtungen und freye Untersuchungen zum Aufnehmen und zur Verbesserung der deutschen Schau-Bühne
1
Bodmer, Johann Jakob; Breitinger, Johann Jakob (Hg.): Literarische Denkmale von verschiedenen Verfassern
1
Bodmer, Johann Jakob; Breitinger, Johann Jakob (Hg.): Martin Opitzens von Boberfeld Gedichte
4
Bodmer, Johann Jakob, Breitinger, Johann Jakob (Hg.): Sammlung von Minnesingern aus dem schwäbischen Zeitpuncte
10
Bodmer, Johann Jakob; Breitinger, Johann Jakob: Proben der alten schwäbischen Poesie des Dreyzehnten Jahrhunderts
4
Bodmer, Johann Jakob: Literarische Pamphlete
1
Bodmer, Johann Jakob: Sammlung Critischer, Poetischer, und andrer geistvollen Schriften
1
Bodmer, Johann Jakob: Wilhelm von Oranse in zwey Gesängen
1
Bohlen, Peter von: Bhartriharis Sententiae et carmen quod chauri nomine circumfertur eroticum (1833)
6
Böhl von Faber, Johann Nikolaus: Werke
1
Böhme, Jakob: Morgenröthe im Aufgang
1
Böhme, Jakob: Theosophia revelata
1
Böhme, Jakob: Werke
3
Bohte, Johann Heinrich: Handbibliothek der deutschen Literatur
11
Boiardo, Matteo Maria: Orlando innamorato
1
Boiardo, Matteo Maria: Verliebter Roland [Ü: Johann Diederich Gries]
1
Boileau Despréaux, Nicolas: Satires
1
Boileau Despréaux, Nicolas: Werke
1
Boisserée, Sulpiz: Ansichten, Risse und einzelne Theile des Doms von Köln
8
Boisserée, Sulpiz (Hg.): Denkmale der Baukunst vom 7ten bis zum 13ten Jahrhundert am Niederrhein
1
Bonstetten, Karl Viktor von: Voyage sur la scene des six derniers livres de lʼÉnéide
3
Bopp, Franz: Allgemeine Geschichte der Sprachen (WS 1824/1825)
1
Bopp, Franz: Analytic Comparison of the Sanskrit, Greek, Latin and Teutonic Languages
6
Bopp, Franz (Hg.): Ardschunas Reise zu Indras Himmel
11
Bopp, Franz (Hg.): Nalus, carmen sanscritum e Mahabharato
38
Bopp, Franz (Hg.): Nalus Maha-Bharati episodium
13
Bopp, Franz: Sanskrit-Grammatik (WS 1824/1825)
1
Bopp, Franz: Schlegel, August Wilhelm von (Hg.): Bhagavad-Gita (Rezension)
3
Bopp, Franz: Schlegel, August Wilhelm von: Indische Bibliothek (Rezension)
1
Bopp, Franz: Über das Conjugationssystem der Sanskritsprache in Vergleichung mit jenem der griechischen, lateinischen, persischen und germanischen Sprache
6
Bopp, Franz: Vergleichende Grammatik des Sanskrit, Zend, Griechischen, Lateinischen, Litauischen, Gotischen und Deutschen (1833–1852)
3
Bopp, Franz: Von den Wurzeln und Pronominen erster und zweiter Person
4
Bosch, Jeronimo de: Carmen de aequalitate hominum
1
Bosch, Jeronimo de: Hieronymi de Bosch descriptio edendae anthologiae Graecae, ab Hugone Grotio Latinis versibus redditae
1
Bossi, Luigi: Lettre à Mr. le Professeur Schlegel sur deux inscriptions prétendues runiques trouvées à Venise
3
Bothe, Friedrich Heinrich: Gigantomachia das ist heilloser Krieg einer gewaltigen Riesenkorporation gegen den Olympus
5
Bothe, Friedrich Heinrich (Hg.): Aeschylus: Dramata
1
Böttiger, Carl August: Entwickelung des Ifflandschen Spiels in vierzehn Darstellungen
4
Böttiger, Carl August; Göschen, Georg Joachim (Hg.): Bibliothek der lateinischen Klassiker für den begüterten Mann von Geschmack (Plan)
1
Böttiger, Carl August: Griechische Vasengemälde
1
Böttiger, Carl August: P. Terentii Afri commoediae
2
Böttiger, Carl August: Schlegel, August Wilhelm von: Ion (Rezension)
2
Böttiger, Carl August: Weimarische Kunstausstellung und Preisvertheilung
2
Bouche, Honoré: Histoire de Provence
1
Bouquet, Martin: Recueil des historiens des Gaules et de la France
4
Bourbon-Conti, Stéphanie-Louise de: Mémoires historiques
1
Bouterwek, Friedrich: Briefe an Theokles
1
Bouterwek, Friedrich: Gedichte
2
Bouterwek, Friedrich: Geschichte der Poesie und Beredsamkeit seit dem Ende des dreizehnten Jahrhunderts
11
Bouterwek, Friedrich: Geschichte der Poesie und Beredsamkeit seit dem Ende des dreizehnten Jahrhunderts. Erster Band
1
Bouterwek, Friedrich: Geschichte der Poesie und Beredsamkeit seit dem Ende des dreizehnten Jahrhunderts. Sechster Band
1
Bouterwek, Friedrich: Geschichte der Poesie und Beredsamkeit seit dem Ende des dreizehnten Jahrhunderts. Vierter Band
1
Bouterwek, Friedrich: Graf Donamar. Briefe, geschrieben zur Zeit des siebenjährigen Krieges in Deutschland
6
Bouterwek, Friedrich: Huberulus Murzuphlus oder der poetische Kuss
1
Bouterwek, Friedrich: Ideen zu einer allgemeinen Apodiktik
4
Bouterwek, Friedrich: Murzuphlus der Kritiker
1
Bouterwek, Friedrich: Paullus Septimius oder das letzte Geheimnis des Eleusinischen Priesters
1
Bouterwek, Friedrich: Schlegel, August Wilhelm von: Vorlesungen über dramatische Kunst und Litteratur (Rezension)
1
Bouterwek, Friedrich: Wie man sich irren kann
1
Boutet de Monvel, Jacques Marie: Philippe und Georgette [Ü: Caroline von Schelling]
1
Brachmann, Louise: An Aug. Wilh. Schlegel
1
Brachmann Louise: Gedichte
5
Brachmann Louise: Laidion
1
Brachmann Louise: Märchen (Werkplan)
1
Brachmann, Louise: (Sonett auf Sidonie von Hardenbergs Genesung)
1
Brandes, Ernst: Betrachtungen über den Zeitgeist in Deutschland in den letzten Decennien des vorigen Jahrhunderts
4
Brandes, Ernst: Über die Leserei der Modebücher und ihre Folgen in einigen Klassen der höheren Stände
1
Brandes, Ernst: Ueber einige bisherige Folgen der französischen Revolution in Rücksicht auf Deutschland
1
Brandis, Christian August: Handbuch der Geschichte der Griechisch-Römischen Philosophie (Bd. 1, 1835)
1
Breiger, Gottlieb Christian: Trost und Lehre bey dem Grabe der Unsrigen
1
Brentano, Clemens: Gustav Wasa
1
Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe in den Jahren 1794 bis 1805
4
Briefwechsel zwischen Schiller und Wilhelm v. Humboldt
2
Brockhaus, Friedrich Arnold: Conversations-Lexicon oder enzyklopädisches Handwörterbuch für gebildete Stände
4
Brockhaus, Hermann (Hg.): Katha sarit sagara
1
Brockhaus, Hermann: Vorlesungen
1
Broglie, Achille-Léon-Victor de: Développement d'une proposition faite à la Chambre par M. le duc de Broglie, et relative à l'exécution des lois prohibitives de la traite des noirs
1
Broglie, Achille-Léon-Victor de: Opinion de M. le duc de Broglie sur l'article 17 du projet de loi relatif à la répression des délits commis par la voie de la presse, ou par tout autre moyen de publication
1
Broglie, Achille-Léon-Victor de: Opinion de M. le duc de Broglie sur le projet de loi relatif à la répression des délits commis par la voie de la presse, ou par tout autre moyen de publication
1
Brown, John: Elementa medicinae
3
Bruns, Paul Jakob (Hg.): Romantische und andere Gedichte in Altplattdeutscher Sprache aus einer Handschrift der Akademischen Bibliothek zu Helmstädt
2
Bruun-Neergaard, Tønnes Christian: Voyage pittoresque et historique dans le nord de lʼItalie
2
Bucelin, Gabriel: Germania sacra
1
Buch der Liebe (1578 u. 1587)
14
Buchholz, Friedrich: Bekenntnisse einer schönen Seele
1
Buchholz, Friedrich: Der neue Leviathan
1
Bucke, Charles: On the Beauties, Harmonies, and Sublimities of Nature
1
Buhle, Johann Gottlieb: Aratu Soleos Phainomena kai Diosēmeia = Arati Solensis Phaenomena et Diosemea
1
Buhle, Johann Gottlieb: Aristotelis Opera Omnia Graece
1
Bülow, Georg Christian Ludwig von: Meine Dienstentlassung
1
Bulwer-Lytton, Edward: Pelham
1
Bunsen, Philipp Ludwig: Die letzten Seufzer eines Selbstmörders
1
Bunsen, Philipp Ludwig: Neujahrswunsch an Hrn. G. J. Rath Erxleben
1
Bürger, Gottfried August: Actenstücke über einen poetischen Wettstreit
1
Bürger, Gottfried August: An August Wilhelm Schlegel (Sonett)
2
Bürger, Gottfried August: An den Apollo
1
Bürger, Gottfried August: Auf einen Zeitschriftsteller, der [...] Kopf- Herz- und Geschmacklos schrieb
1
Bürger, Gottfried August: Balladen
1
Bürger, Gottfried August: Bellin
1
Bürger, Gottfried August: Das Lied vom braven Manne
1
Bürger, Gottfried August: Das Lied von Treue
1
Bürger, Gottfried August: Das Pantheon des Geschmacks und der Kritik desselben
1
Bürger, Gottfried August: Der Raubgraf
1
Bürger, Gottfried August: Der Vogel Urselbst, seine Recensenten und der Genius
1
Bürger, Gottfried August: Der wohlgesinnte Liebhaber
1
Bürger, Gottfried August: Die Erscheinung
1
Bürger, Gottfried August: Fürbitte eines ans peinliche Kreuz der Verlegenheit genagelten Herausgebers eines Musenalmanachs
1
Bürger, Gottfried August: Gedichte
6
Bürger, Gottfried August: Heloise an Abelard
3
Bürger, Gottfried August: Hübnerus redivivus
1
Bürger, Gottfried August: Lehrbuch des Deutschen Styles
1
Bürger, Gottfried August: Sämtliche Werke
1
Bürger, Gottfried August; Schlegel, August Wilhelm von: Auf die Morgenröte
1
Bürger, Gottfried August: Vorläufige Antikritik und Anzeige
3
Bürger, Gottfried August: Werke
2
Buri, Christian Karl Ernst Wilhelm: Gedichte
1
Burke, Edmund: Reflections on the Revolution in France
1
Burnes, Alexander: Travels through Central Asia, Journey to the North of India, Overland from England Through Russia, Persia, and Affghanistan by A. Conolly; Travels into Bokhara, Being the Account of a Journey from India to Cabool, Tartary, and Persia
1
Burnouf, Eugène: Commentaire sur le Yaçna, l'un des livres liturgiques des parses : ouvrage contenant le texte zend expliqué pour la première fois le variantes des quatre manuscrits de la bibliothèque royale et la version sancrite inédite de nérios
1
GND
Burnouf, Eugène (Hg.): Le Bhagavata Purana ou Histoire poétique de Krishna
2
Burnouf, Eugène (Hg.): Vendidad-Sadé, lʼun des livres de Zoroastre
8
Burnouf, Eugène; Lassen, Christian (Hg.): Essai sur le Pali ou langue sacrée de la presquʼîle au-delà du Gange
15
Burnouf, Eugène: Werke
2
Bury, Friedrich: August Wilhelm von Schlegel
5
Bury, Friedrich: Der Kampf Achills mit den Flüssen
1
Bury, Friedrich: Der triumphierende Amor
1
Bury, Friedrich: Friederike Voss
1
Bury, Friedrich: Johann Wolfgang von Goethe
1
Bury, Friedrich: Portrait von Ivanovna Baryatinskaya Tolstoy
2
Bury, Friedrich: Portrait von Johann Wolfgang von Goethe
5
Bury, Friedrich: Schwur der Schweizer
1
Bury, Friedrich: Zeichnung nach dem Portrait von Johann Wolfgang von Goethe
1
Büsching, Anton Friedrich: Magazin für Historiographie und Geographie
1
Büsching, Anton Friedrich: Zuverläßige Beyträge zu der Regierungs-Geschichte Königs Friedrich II von Preußen
1
Büsching, Johann Gustav Gottlieb: Das Lied der Nibelungen metrisch in das jetzige Deutsch übertragen
3
Büsching, Johann Gustav Gottlieb: Der arme Heinrich, eine altdeutsche Erzählung
1
Büsching, Johann Gustav Gottlieb; Docen, Bernhard Joseph; Hagen, Friedrich Heinrich von der et al (Hg.): Sammlung für altdeutsche Literatur und Kunst
1
Büsching, Johann Gustav Gottlieb; Hagen, Friedrich Heinrich von der (Hg.): Buch der Liebe
10
Büsching, Johann Gustav Gottlieb; Hagen, Friedrich Heinrich von der (Hg.): Deutsche Gedichte des Mittelalters
3
Büsching, Johann Gustav Gottlieb; Hagen, Friedrich Heinrich von der (Hg.): Literarischer Grundriß zur Geschichte der deutschen Poesie
8
Büsching, Johann Gustav Gottlieb; Hagen, Friedrich Heinrich von der (Hg.): Sammlung deutscher Volkslieder
4
Busch, Peter: Bildnis von August Wilhelm Schlegel
2
Busch, Peter: Bildnis von Ludwig Tieck
1
Busch, Peter: (Drei rauchende Knaben)
1
Busch, Peter: Werke
1
Büste der Henriette von Arnstein
1
Buste dʼAntinoüs, dit Antinoüs dʼÉcouen
2
Butler, Samuel: Hudibras
3
Buttlar, Augusta von: (Altarbild für eine Kirche in Böhmen)
1
Buttlar, Augusta von: (Apotheose des Homer, Zeichnung)
4
Buttlar, Augusta von: (Bildnis der Kinder der Frau von Ésterhazy)
1
Buttlar, Augusta von: (Bildnis der Kinder der Frau von Windischgrätz)
1
Buttlar, Augusta von: (Bildnis der Kinder von Albertine de Broglie)
3
Buttlar, Augusta von: (Bildnis des Sohnes der Gabriele von Auersperg)
1
Buttlar, Augusta von: (Bildnis von Sophie von Zichy-Vásonykeő)
1
Buttlar, Augusta von: (Das Kind von Henry Brougham)
2
Buttlar, Augusta von: (Die drei göttlichen Tugenden nach Raffael)
1
Buttlar, Augusta von: (Die heilige Familie nach Jacopo Palma il Vecchio (Palma, Jacopo, il Vecchio))
3
Buttlar, Augusta von: (Eine Tochter von Rudolph Ackermann)
2
Buttlar, Augusta von: (Heilige Anna)
2
Buttlar, Augusta von: (Kinderporträt)
1
Buttlar, Augusta von: (Kleine Madonna)
2
Buttlar, Augusta von: (Kopie nach Jacopo Palma il Vecchio)
3
Buttlar, Augusta von: (Lithographie nach einem Portrait von Dorothea von Schlegel)
1
Buttlar, Augusta von: (Marie Antoinette mit ihren Kindern, Kopie)
1
Buttlar, Augusta von: (Porträt der Dorothea von Schlegel)
1
Buttlar, Augusta von: (Porträt der Fürstin Czatoryska)
2
Buttlar, Augusta von: (Porträt der Gabriele von Auersperg)
1
Buttlar, Augusta von: (Porträt der Gräfin Ludolf)
2
Buttlar, Augusta von: (Porträt der Madame de Staël nach François Gérard)
3
Buttlar, Augusta von: (Porträt der Maria Anna Leopoldina, Sachsen, Königin)
2
Buttlar, Augusta von: (Porträt der Prinzessin Johann (Amalie Friederike Auguste, Sachsen, Prinzessin)
1
Buttlar, Augusta von: (Porträt der Victorine de Sainte-Aulaire)
2
Buttlar, Augusta von: (Porträt des kleinen Rudolf, 1823)
1
Buttlar, Augusta von: (Porträt eines Kindes der Lady Essex, Werkplan)
2
Buttlar, Augusta von: (Porträt eines Knaben, 1823)
1
Buttlar, Augusta von: (Porträt eines Mädchens, 1823)
1
Buttlar, Augusta von: (Porträt von Alexander James Beresford-Hope)
1
Buttlar, Augusta von: (Porträt von August Wilhelm von Schlegel)
4
Buttlar, Augusta von: (Porträt von Friedrich von Schlegel)
1
Buttlar, Augusta von: (Porträt von Heinrich Ludwig von Buttlar)
1
Buttlar, Augusta von: (Porträt von Konstantin von Ludolf)
1
Buttlar, Augusta von: (Porträt von Ludwig Tieck)
2
Buttlar, Augusta von: (Porträt von Maria Albertine Amalie Auguste von Flotow)
1
Buttlar, Augusta von: (Porträt von Wilhelm H. C. R. A. von Ungern-Sternberg)
1
Buttlar, Augusta von: (Poträt der Frau Unger mir ihrem Knaben)
1
Buttlar, Augusta von: (Selbstporträt)
2
Buttlar, Augusta von: (Sibille)
1
Buttlar, Augusta von: (Zeichnung nach der Natur der Johanna dʼArc von der Prinzeßin Marie von Orleans)
1
Buttmann, Philipp: Ausführliche griechische Sprachlehre
3
Buttmann, Philipp: Griechische Grammatik
1
Buttmann, Philipp: Lexilogus oder Beiträge zur Worterklärung für Homer und Hesiod
1
Buttmann, Philipp: Moschylos, der feuerspeiende Berg auf Lemnos
1
Buttura, Antonio: I quattro poeti italiani
1
Caesar, Gaius Iulius: Commentarii de bello civili
1
Caesar, Gaius Iulius: Commentarii de bello Gallico
1
Caesar, Gaius Iulius: Jahrbücher [Ü: Adolf Wagner]
1
Calderón de la Barca, Pedro: Comedias
2
Calderón de la Barca, Pedro: Comedias del celebre poeta español
1
Calderón de la Barca, Pedro: Das Leben ein Traum [Ü: Friedrich Hildebrand von Einsiedel]
1
Calderón de la Barca, Pedro: Der Gartenunhold [Ü: Ernst von der Malsburg]
1
Calderón de la Barca, Pedro: Der standhafte Prinz [Ü: August Wilhelm von Schlegel]
30
Calderón de la Barca, Pedro: Die Andacht zum Kreuze [Ü: August Wilhelm von Schlegel]
24
Calderón de la Barca, Pedro: Die Brücke von Mantible [Ü: August Wilhelm von Schlegel]
21
Calderón de la Barca, Pedro: Die große Zenobia [Ü: Johann Diederich Gries]
1
Calderón de la Barca, Pedro: Die Locken des Absalons [Ü: August Wilhelm von Schlegel] (Teilübersetzung)
2
Calderón de la Barca, Pedro: Die Schärpe und die Blume [Ü: August Wilhelm von Schlegel]
9
Calderón de la Barca, Pedro: Discurso sobre los quadro novisimos, en Octavas
1
Calderón de la Barca, Pedro: Echo und Narcissus [Ü: Ernst von der Malsburg]
2
Calderón de la Barca, Pedro: Eco y Narciso
1
Calderón de la Barca, Pedro: El mayor encanto amor
4
Calderón de la Barca, Pedro: El monstruo de los jardines [Ü: Ernst von der Malsburg]
1
Calderón de la Barca, Pedro: El principe constante
10
Calderón de la Barca, Pedro: La aurora en Copacabana
1
Calderón de la Barca, Pedro: La devoción de la cruz
8
Calderón de la Barca, Pedro: La puente de Mantible
7
Calderón de la Barca, Pedro: Las manos blancas no ofenden
4
Calderón de la Barca, Pedro: La Vanda y la flor
3
Calderón de la Barca, Pedro: La vida es sueño
1
Calderón de la Barca, Pedro: Los cabellos de Absalon
2
Calderón de la Barca, Pedro: Obras
1
Calderón de la Barca, Pedro: Saynetes
1
Calderón de la Barca, Pedro: Schauspiele Bd. 1 [Ü: August Wilhelm von Schlegel]
32
Calderón de la Barca, Pedro: Schauspiele Bd. 2 [Ü: August Wilhelm von Schlegel]
81
Calderón de la Barca, Pedro: Schauspiele. Spanisches Theater. Bd. 1. Ü: August Wilhelm von Schlegel (Rezension)
1
Calderón de la Barca, Pedro: Schauspiele. Spanisches Theater. Bd. 2. Ü: August Wilhelm von Schlegel (Rezension)
1
Calderón de la Barca, Pedro: Schauspiele [Ü: August Wilhelm von Schlegel]
99
Calderón de la Barca, Pedro: Schauspiele [Ü: Ernst von der Malsburg]
2
Calderón de la Barca, Pedro: Schauspiele [Ü: Johann Diederich Gries]
4
Calderón de la Barca, Pedro: Über allen Zauber Liebe [Ü: August Wilhelm von Schlegel]
10
Calderón de la Barca, Pedro: Weiße Hände kränken nicht
4
Calderón de la Barca, Pedro: Werke
6
Calker, Johann Friedrich August van: Denklehre oder Logik und Dialektik nebst einem Abriss der Geschichte und Literatur derselben
1
Calmet, Augustin: Commentaire littéral sur tous les livres de lʼAncien et du Nouveau Testament
1
Calvin, Johannes: Genfer Psalter [Ü: Ambrosius Lobwasser]
2
Caminade, Marc Alexandre: Premiers Élémens de la langue française, ou grammaire usuelle et complette
1
GND
Camões, Luiz de: Die Lusiaden [Ü: August Wilhelm von Schlegel]
2
Camões, Luiz de: Die zwölf von Engellande [Ü: August Wilhelm von Schlegel]
1
Camões, Luiz de: Sete anos de pastor Jacob servia
1
Campbell, Alexander Duncan: A dictionary of the Teloogoo language
1
Campe, Johann Heinrich: Wörterbuch der Deutschen Sprache
1
Campe, Johann Heinrich: Wörterbuch zur Erklärung und Verdeutschung der unserer Sprache aufgedrungenen Fremdwörter
1
Camper, Petrus: De Hominis Varietate
1
Camper, Petrus: Verhandeling over het natuurlijk verschil der wezenstrekken in menschen
1
Canisius, Heinrich: Lectiones antiquae
1
Canova, Antonio: Grabdenkmal für die Tochter des Marquis de St. Croix
1
Canova, Antonio: Kolossalstatue Napoleons
1
Canova, Antonio: Paris
1
Canova, Antonio: Perseus
1
Canova, Antonio: Statue einer Tänzerin
1
Canova, Antonio: Theseus, Besieger des Centaurs Pheneus
1
Carey, William: A Grammar of the Sungskrit Language
10
Carlyle, Thomas: History of German Literature (Werkplan)
1
Carlyle, Thomas: The Life of Friedrich Schiller
2
Carracci, Annibale: Christus
1
Casaubon, Isaac: Epistolae
1
Casiri, Miguel: Bibliotheca arabico-hispana Escurialensis
1
Castell, Edmund: Lexicon heptaglotton
1
Cervantes Saavedra, Miguel de: Don Quijote [Ü: Dietrich Wilhelm Soltau]
6
Cervantes Saavedra, Miguel de: Don Quijote [Ü: Friedrich Justin Bertuch]
1
Cervantes Saavedra, Miguel de: Leben und Thaten des scharfsinnigen Edlen Don Quixote von La Mancha [Ü: Ludwig Tieck]
39
Cervantes Saavedra, Miguel de: Leben und Thaten des sinnreichen Don Quijote von der Mancha [Ü: Hieronymus Müller]
1
Cervantes Saavedra, Miguel de: Lehrreiche Erzählungen [Ü: Dietrich Wilhelm Soltau]
2
Cervantes Saavedra, Miguel de: Novelas ejemplares [Ü: Ludwig Tieck]
2
Cervantes Saavedra, Miguel de: Numacia [Ü: Friedrich de La Motte-Fouqué]
4
Chamfort, Sébastien Roch Nicolas: Oeuvres de Chamfort
1
Champollion, Jean-François: Précis du système hieroglyphique des anciens Égyptiens
1
Characteristics of Goethe [Ü: Sarah Austin]
1
Charrier-Sainneville, Sebastian Claude: Compte rendu des événements qui se sont passés à Lyon
1
Chefs-dʼœuvre de theâtres étrangers
5
Chézy, Antoine Léonard de: Die Einsiedelei des Kandu, nach dem Brahma-Purana, einer epischen Dichtung aus dem höchsten Alterthum. Eine akademische Vorlesung
6
Chézy, Antoine Léonard de: Discours prononcé au Collège Royal de France à lʼouverture du cours de langue et de littérature Sanskrite
2
Chézy, Antoine Léonard de: La Reconnaissance de Sacountala, Drame Sanscrit et Pracrit de Calidasa
8
Chézy, Antoine Léonard de: Medjnoun et Leila, poëme traduit du Persan de Dschamy
1
Chézy, Antoine Léonard de: Ode de Djami, traduite
1
Chézy, Antoine Léonard de: Théorie de Sloka ou mêtre heroique sanskrit
1
Chézy, Antoine Léonard de: Vorlesungen
2
Chézy, Antoine Léonard de: Werke
1
Chézy, Antoine Léonard de: Yadina datta-Badha
3
Chézy, Helmina von (Bearb.): Szenen aus Calderóns Schauspiel „El galan Fantasma“, für die Bühne bearbeitet
1
Chézy, Helmina von: Das Mädchen und die Welle
1
Chézy, Helmina von: Die Wundernacht in Arabien
2
Chézy, Helmina von: Elisens Geburtstag
1
Chézy, Helmina von: Gedichte
7
Chézy, Helmina von: Gesang vom Morgenlande
1
Chézy, Helmina von: Leben und Kunst in Paris seit Napoleon dem Ersten
3
Chézy, Helmina von: (Ode, aus dem Persischen übersetzt)
1
Chézy, Helmina von: Reise des Dichters Anwary nach Bagdad, nach dem persischen Originaltexte von Anwary
2
Chézy, Helmina von: Werke
2
Chronica poloniae maioris
1
Chunda Stotra: Hymns to Chandi
1
Church Missionary Society: Reports
1
Ciampi, Sebastiano; Benvenuti, Baldassarre: Notizie della vita letteraria e degli scritti numismatici di Giorgio Viani
1
Ciampi, Sebastiano: Estratto delle osservazioni sopra la epitome di Dionisio d’Alicarnasso
2
Cicero, Marcus Tullius: Epistolarum ad atticum
1
Cicognara, Leopoldo: Storia della scultura dal suo risorgimento in Italia sino al secolo di Napoleone per servire di continuazione alle opere di Winckelmann e di d’Agincourt
1
Cirkel, Jakob Vincent: Gedichte
1
Clairon, Claire Josèphe Hippolyte Leris de LaTude: Mémoires d’Hyppolite Clairon et réflexions sur l’art dramatique
1
Clary und Aldringen, Leopold von: Geistreiche Federzeichnungen zu Fouquéʼs Undine
1
Claudius, Matthias: Urians Nachricht von der neuen Aufklärung oder Urian und die Dänen
2
Claudius, Matthias: Werke
1
Clémencet, Charles; Dantine, Maur; Durand, Ursin: L’Art de vérifier les dates, depuis l’année 1770 jusqu’à nos jours
4
Clüver, Philipp: Italia antiqua
1
Cockerell, Charles Robert: Une feuille dessinée et gravée par luimême
1
Cockerell, Charles Robert: Zeichnung der Gruppe der Niobe
9
Colebrooke, Henry T.: A grammar of the Sanscrit language
4
Colebrooke, Henry T.: Algebra, with Arithmetic and Mensuration, from the Sanscrit of Brahmegupta and Bhascara
1
Colebrooke, Henry T.: Amara Simha, Cósha or Dictionary of Sanscrit Language
14
Colebrooke, Henry T: (Hg.): Hitópadésa or Salutary Instruction
14
Colebrooke, Henry T.: Miscellaneous Essays
1
Colebrooke, Henry T.: On Sanscrĭt and Prácrĭt Poetry
3
Colebrooke, Henry T.: On the Philosophy of the Hindus
9
Colebrooke, Henry T.: On the Religious Ceremonies of the Hindus
1
Colebrooke, Henry T.: On the Valley of the Setlej River, in the Himalaya Mountains, from the Journal of Captain A. Gerard, with Remarks
1
Colebrooke, Henry T.: Werke
3
Collin, Heinrich Joseph von: Bradamante
1
Collin, Heinrich Joseph von: Coriolan
1
Collin, Heinrich Joseph von: Gedichte
1
Collin, Heinrich Joseph von: Mäon
1
Collin, Heinrich Joseph von: Regulus
4
Collin, Heinrich Joseph von: Vorrede zu: Schlegel, August Wilhelm von: Vergleichung der Phädra des Racine mit der des Euripides. Ü: Heinrich Joseph von Collin
1
Collin, Matthäus von: Nachgelassene Gedichte, ausgewählt und mit einem biographischen Vorworte begleitet von Joseph von Hammer
1
Condorcet, Jean Antoine Nicolas de Caritat de: Esquisse dʼun tableau historique des progrès de lʼesprit humain
2
GND
Constant, Benjamin: Cours de politique constitutionnelle
1
Constant, Benjamin: De l'esprit de conquête et d l'usurpation dans leurs rapports avec la civilisation européenne
2
GND
Constant, Benjamin: De la religion, considerée dans sa source, ses formes et ses développements
2
GND
Constant, Samuel de: Camille oder Briefe zweyer Mädchen aus unserm Zeitalter [Ü: Johann Friedrich Jünger]
1
Conti, Giovanni Battista (Hg.): Collección de Poesías Castellanas, traducidas en verso toscano
1
Conze, Johann: Gedichte
1
Conz, Karl Philipp: Die Stufen der Menschen
1
Cornelius, Peter von: Bilder zu Goethes Faust
1
Cornelius, Peter von: Darstellungen aus dem Lied der Nibelungen
6
Cornelius, Peter von: Zeichnungen
2
Correggio, Antonio Allegri da: Der Tag
1
Courtenay, Thomas Peregrine: Memoirs of the life, works and correspondence of Sir William Temple, Bart
1
Cousin, Victor: Rapport sur l’état de l’instruction publique dans quelques pays de l’Allemagne et particulièrement en Prusse
1
Coxe, William: History of the House of Austria
5
Cramer, Carl Friedrich: Über mein Schicksal
1
Cramer, Carl Gottlob: Schattenspiele
1
Cratepoil, Petrus: Omnium Archiepiscoporum Coloniensium Catalogus
1
Crawfurd, John; Raffles, Thomas Stamford: An Inscription from the Kawi or ancient Javanese language, taken from a stone found in the district of Surabaya on Java, translated into the Modern Idiom by Nata Kusuma, Panambahan of Sumanap
1
Crescimbeni, Giovanni Mario: La Vite de più celebri poeti Provenzali
1
Crescimbeni, Giovanni Mario: Storia della volgar poesia
1
Creuzer, Friedrich: Symbolik und Mythologie der alten Völker
4
Creve, Johann Carl Caspar Ignatius Anton: Vom Metallreize, einem neuentdeckten untrüglichen Prüfungsmittel des wahren Todes
1
Ctesias (Cnidius): Indiká
1
Cumberland, Richard: Der Jude
1
Cuspianus, Johannes: De caesaribus atque imperatoribus romanis
1
Cuvier, Frédéric Georges: Analyses des travaux de lʼAcadémie royale des sciences mathématiques et physiques de lʼInstitut, Partie physique
1
Cyprianus, Thascius Caecilius: Schriften
2
Daguerre, Louis Jacques Mandé: Diorama
1
Dähling, Heinrich Anton: Acht Kupfer, darstellend Szenen aus den Wahl-Verwandtschaften
1
Dalayrac, Nicolas: Adolphe et Clara ou Les deux Prisonniers
1
Dalberg, Johann Friedrich Hugo von: Gita-Govinda oder die Gesänge Jayadevaʻs, eines altindischen Dichters
2
Dalberg, Johann Friedrich Hugo von: Scheik Mohammed Faniʻs Dabistan
1
Dalberg, Wolfgang Heribert von: Julius Cäsar oder die Verschwörung des Brutus
1
Dandolo, Girolamo: All’autore delle osservazioncelle risposta del Co. G. A. Dandolo patrizio veneto
1
Dante, Alighieri: Divina commedia. Composto da Giovanni Flaxman (John Flaxman) scultore inglese
10
Dante, Alighieri: Divina commedia [Ü: August Wilhelm von Schlegel] (Teilübersetzung)
15
Dante, Alighieri: Divina commedia [Ü: Friedrich Wilhelm Joseph von Schelling] (Teilübersetzung)
2
Dante, Alighieri: Divine Comedy [Ü: Ichabod Charles Wright]
1
Dante, Alighieri: (Ihr Pilger, die ihr in Gedanken gehet) [Ü: August Wilhelm von Schlegel]
1
Dante, Alighieri: The Canzoniere of Dante Alighieri, including the poems of the Vita Nuova and the Convito [Ü: Charles Lyell]
2
Dante, Alighieri: Werke
1
Dapper, Olfert: Asia [Ü: Johan Christoff Beern]
1
Das helden buch mit synen figuren
1
Daub, Carl: Judas Ischarioth oder das Böse in Verhältniß zum Guten
1
David DʼAngers, Pierre Jean: Medaillon von August Wilhelm von Schlegel
4
Dawes, Richard: Miscellanea Critica
1
Debure, Guillaume-François: Bibliothèque instructive ou Traité de la connaissance des livres rares et singuliers
1
Degen, Johann: Bambergisches Gesangbuch
1
Delbrück, Ferdinand: (Aufsatz)
1
Denina, Carlo: La Clef des langues ou Observations sur l’origine et la formation des principales langues qu’un parle et qu’on écrit en Europe
1
Deppen, Otto von: Schach-Politik oder Grundzüge zu der Kunst, seinen Gegner im Schach bald zu besiegen
1
Der immer in der Welt herum wandernde Jude, das ist Bericht von einem Juden aus Jerusalem, mit Namen Ahasverus, welcher vorgiebt, er sey bey der Creuzigung Christi gewesen [...] (1800)
1
Der Nibelungen Liet. In: Christoph Heinrich Müller: Samlung deutscher Gedichte aus dem XII., XIII. und XIV. Jahrhundert. Erster Band
1
Der Prophet Jesaia [Ü: D. Wilhelm Gesenius]
1
Der Todtentanz (mit Holzschnitten nach Hans Holbein)
2
Destouches, Néricault: La fausse Agnes, ou, Le poète campagnard
1
Diane de Versailles
2
Díaz del Castillo, Bernal: Denkwürdigkeiten des Hauptmanns Bernal Diaz del Castillo [Ü: Philipp Joseph von Rehfues]
1
Dictionnaire de lʼacademie française. Cinquième édition
2
Dictionnaire de lʼacademie française. Sixième Edition
2
Diderot, Denis: Œuvres postumes
1
Diderot, Denis: Rameauʼs Neffe [Ü: Johann Wolfgang von Goethe]
7
Die Eineidt. In: Müller, Christoph Heinrich: Samlung deutscher Gedichte aus dem XII., XIII. und XIV. Jahrhundert
1
(Die Fabeln des Luqmān) [Ü: Armand Pierre Caussin de Perceval]
1
Die geuerlichkeiten und eins teils der geschichten des löblichen streitbaren und hochberühmten helds und Ritters Tewrdanncks
3
GND
Diez, Friedrich Christian: Die Poesie der Troubadours
3
Diez, Friedrich Christian: Grammatik der romanischen Sprachen
1
Dilschneider, Johann Joseph: Verslehre der deutschen Sprache
1
Dio, Chrysostomus: Werke
1
Diodorus, Siculus: Bibliotheca historica
1
Dis ist von der Wibe List. In: Müller, Christoph Heinrich: Samlung deutscher Gedichte aus dem XII., XIII. und XIV. Jahrhundert
1
Docen, Bernhard Joseph: Erstes Sendschreiben über den Titurel
18
Docen, Bernhard Joseph: Über den Unterschied und die gegenseitigen Verhältnisse der Minne- und Meistersänger
1
Docen, Bernhard Joseph: Ueber die Selbstständigkeit und Reinerhaltung unserer Literatur und Sprache
1
Docen, Bernhard Joseph: Vorläufige Anzeige einer alten Handschrift des Liedes der Nibelungen
1
Dodsley, Robert (Hg.): A Select Collection of Old Plays
4
Döllinger, Ignaz von: Geschichte der christlichen Kirche
1
Domenichi, Lodovico: Orlando riformato
1
Donaldson, John William: The Theatre of the Greeks
1
Donati, Alessandro: Roma vetus ac recens
1
Donatus provincialis
1
Doppelmayr, Johann Gabriel: Historische Nachricht von den Nürnbergischen Mathematicis und Künstlern
1
GND
Döring, Carl August; Niemeyer, Gottlieb Anton Christian: Gedichte
1
Döring, Friedrich Wilhelm: Anleitung zum Uebersetzen aus dem Deutschen ins Lateinische
1
Dorow, Wilhelm (Hg.): Facsimile von Handschriften berühmter Männer und Frauen aus der Sammlung des Herausgebers
1
Dorow, Wilhelm: Opferstätte und Grabhügel der Germanen und Römer am Rhein
1
Drake, Friedrich: Möser-Denkmal
2
Drake, Nathan: Shakespeare and his Times
2
Dubois, Jean A. (Hg.): Le Pantscha-Tantra ou les cinq ruses
1
Du Buat-Nançay, Louis-Gabriel: Histoire ancienne des peuples de l'Europe
1
Du Chesne, André: Historiae Francorum scriptores
1
Duncombe, John: An Evening Contemplation in a College
1
Dupin, André-Marie-Jean-Jacques: Discours prononcé par M. Dupin ainé, pour sa réception à l’Académie Française
1
Du Pont de Nemours, Pierre Samuel: Mémoires sur différents sujets dʼhistoire naturelle
1
Durga Stotra
1
Dursch, Georg Martin (Hg.): Ghatakarparam oder das zerbrochene Gefäss [Ü: Georg Martin Dursch]
1
Du Verdier, Antoine: La Bibliothèque dʼAntoine Du Verdier
1
Eberhard, Johann August: Synonymisches Handwörterbuch der deutschen Sprache
4
Eberhard von Sax: Lobgesang auf die Jungfrau Maria
1
Ebers, John: Vollständiges englisch-deutsches und deutsch-engliches Handwörterbuch
1
Eckhart, Johann Georg von: Commentarii de rebus Franciae orientalis et episcopatus Wirceburgensis
3
Eckhart, Johann Georg von: Corpus historicum medii aevi, sive Scriptores res in orbe universo praecipue in Germania [...]
1
Eckhart, Meister: Deutsche Schriften
1
Eckhart, Meister: Lateinische Schriften
1
Eckhart, Meister: Predigten
1
Elias, Wilhelm: Gedichte
1
Elisabeth (Nassau-Saarbrücken, Gräfin, 1393-1456) (Hg.): Hug Schapler
2
Elisabeth (Nassau-Saarbrücken, Gräfin, 1393-1456): Loher und Maller
1
Elphinstone, Mountstuart: An Account of the Kingdom of Gaubul and its dependencies in Persia, Tartary, and India
1
Engel, Johann Jakob: Anfangsgründe einer Theorie der Dichtungsarten aus deutschen Mustern entwickelt
2
Engel, Johann Jakob: Der Philosoph für die Welt
1
Engel, Johann Jakob: Entzückung des Las Casas
1
Engel, Johann Jakob: Herr Lorenz Stark
1
Entzelt, Christoph: Chronicon oder kurtze einfeltige Vorzeichenus darinne begriffen wer die Alte Marck und nechste Lender darbey sind der Sindtfluth bewonet hat
1
Ernesti, Johann Christian Gottlieb: Lexicon Technologiae Graecorum rhetoricae
1
Ernesti, Johann Heinrich Gottfried: Die wohleingerichtete Buchdruckerei
1
Erste öffentliche Sitzung der königlichen Akademie der Wissenschaften zu München nach ihrer Ernennung
1
Erxleben, Johann Christian Polykarp: Werke
1
Eschenburg, Johann Joachim: Beispielsammlung zur Theorie und Literatur der schönen Wissenschaften
2
Eschenburg, Johann Joachim: Denkmäler altdeutscher Dichtkunst
1
Eschenburg, Johann Joachim: Entwurf einer Theorie und Literatur der schönen Redekünste
2
Eschen, Friedrich August: An Louise
1
Eschen, Friedrich August: Die Lehre der Bescheidenheit
1
Eschen, Friedrich August: Hymnen aus dem Griechischen
1
Eschenmayer, Carl August von: Briefe an Prof. Röschlaub die Verbindung der Philosophie mit der Heilkunde betreffend von seinem Freunde X
1
Eschenmayer, Carl August von: Dedukzion des lebenden Organism
1
Eschenmayer, Carl August von: Hufeland, Christoph Wilhelm von: System der praktischen Heilkunde (Rezension)
1
Eschenmayer, Carl August von: Schelling, Friedrich Wilhelm Joseph von: Erster Entwurf eines Systems der Naturphilosophie (Rezension)
1
Estienne, Henri: Thesaurus Graecae linguae
1
Etherege, George: She would if she could
1
Euripides: Alceste. Edidit, diatribe recognita et annotatione perpetua illustravit Adolf Wagner
1
Euripides: Medea [Ü: Hieronymus Müller]
1
Euripides: Phaedra
6
Ewald, Heinrich: Schlegel, August Wilhelm von: Réflexions sur lʼétude des langues asiatiques (Rezension)
2
Ewald, Heinrich: Vorlesungen
1
Exaudet, André-Joseph: Menuet d'Exaudet
1
Eylert, Rulemann Friedrich: Charakter-Züge und historische Fragmente aus dem Leben des Königs von Preußen Friedrich Wilhelm III.
1
Fabricius, Johann Albert: Bibliotheca Graeca
1
Fabricius, Johann Albert: Bibliotheca Latina Mediae et Infimae Aetatis
1
Fabricius, Johann Albert ; Ernesti, Johann August: Bibliotheca Latina
1
Falk, Johann Daniel: An die Cosmopoliten über meine persönlichen Angriffe
2
Falk, Johann Daniel: Der Mensch und die Helden
1
Falk, Johann Daniel: Die Charakterisierer
1
Falk, Johann Daniel: Die heiligen Gräber zu Kom und die Gebete
3
Falk, Johann Daniel: Die Weiber; frey nach Juvenal
1
Falk, Johann Daniel: Mansos Tod
2
Falk, Johann Daniel: Reisen zu Wasser und zu Lande von Scaramuz
1
Fatawa-i-Alamgiri
2
Fauriel, Claude C.: Chants populaires de la Grèce moderne
4
Fauriel, Claude C.: De lʼorigine de lʼÉpopée chevaleresque du moyen âge
3
Fauriel, Claude C.: Histoire de la Gaule méridionale sous la domination des conquérans germains
3
Favre, Guillaume: Analyse des observations sur la langue et la littérature provençale. In: Bibliothèque Universelle, Juni 1819
1
Favre, Guillaume: Denys d'Halicarnasse. In: Bibliothèque Universelle, Januar 1818
1
Favre, Guillaume: Ouvrages publiés par M. l'abbé Angelo Mai. In: Bibliothèque Universelle, September 1817
1
Favre, Guillaume: Werke
1
Feldborg, Andreas Andersen: Cursory remarks on the meditated attack on Norway
1
Fénelon, François de Salignac de La Mothe: Werke
1
Fergusson, Robert: History of the Progress ant the Termination of the Roman Republic
1
Fernow, Carl Ludwig: Römische Studien
1
Ferrer, Joaquín María de (Hg.): Biblioteca de clásicos españoles, impresa bajo el cuidado de D. Joaquin Maria Ferrer
1
Fichte, Johann Gottlieb: Ankündigung der neuen Darstellung der Wissenschaftslehre
3
Fichte, Johann Gottlieb: Antwortschreiben an Herrn Professor Reinhold auf dessen Sendschreiben an den erstern
4
Fichte, Johann Gottlieb: Appellation an das Publicum über die durch ein Kurf. Sächs. Confiscationsrescript ihm beigemessenen atheistischen Äußerungen
1
Fichte, Johann Gottlieb: Bardili, Christoph Gottfried: Grundriß der ersten Logik (Rezension)
1
Fichte, Johann Gottlieb: Beitrag zur Berichtigung der Urtheile des Publikums über die französische Revolution
1
Fichte, Johann Gottlieb: Das System der Sittenlehre, nach den Prinzipien der Wissenschaftslehre
5
GND
Fichte, Johann Gottlieb: Der Herausgeber des philosophischen Journals gerichtliche Verantwortungsschriften gegen die Anklage des Atheismus
1
Fichte, Johann Gottlieb: Die Wissenschaftslehre
11
Fichte, Johann Gottlieb: Die Wissenschaftslehre in ihrem allgemeinen Umriss
1
Fichte, Johann Gottlieb: Die Wissenschaftslehre in ihrem ganzen Umfange
1
Fichte, Johann Gottlieb: Entwurf zu einem Plane über ein zu errichtendes kritisches Institut
1
Fichte, Johann Gottlieb: Friedrich Nicolaiʼs Leben und sonderbare Meinungen
18
Fichte, Johann Gottlieb: Grundlage des Naturrechts nach Principien der Wissenschaftslehre
3
Fichte, Johann Gottlieb: Idylle
4
Fichte, Johann Gottlieb: Schriften
2
Fichte, Johann Gottlieb: Sonnenklarer Bericht an das größere Publikum über das eigentliche Wesen der neuesten Philosophie
8
Fichte, Johann Gottlieb: Über das Wesen des Gelehrten und seine Erscheinungen im Gebiete der Freiheit
5
Fichte, Johann Gottlieb: Über den Grund unseres Glaubens an eine göttliche Weltregierung
4
Fichte, Johann Gottlieb: Von der Sprachfähigkeit und dem Ursprung der Sprache
2
Ficoroni, Francesco de': Le maschere sceniche e le figure comiche d'antichi romani
1
Fink von Finkenstein, Friedrich Ludwig Karl: Arethusa oder die bukolischen Dichter des Altertums
2
Fiorillo, Johann Dominik: Geschichte der zeichnenden Künste in Deutschland und den vereinigten Niederlanden
1
Fiorillo, Johann Dominik: Geschichte der zeichnenden Künste von ihrer Wiederauflebung bis auf die neuesten Zeiten
10
Fiorillo, Johann Dominik: Geschichte der zeichnenden Künste von ihrer Wiederauflebung bis auf die neuesten Zeiten. Dritter Band
1
Fiorillo, Johann Dominik: Geschichte der zeichnenden Künste von ihrer Wiederauflebung bis auf die neuesten Zeiten. Erster Band
4
Fiorillo, Johann Dominik: Geschichte der zeichnenden Künste von ihrer Wiederauflebung bis auf die neuesten Zeiten. Zweiter Band
5
Firmenich-Richartz, Johann Matthias: Lied
1
Fischer, Friedrich Christoph Jonathan: De prima expeditione Attilae
3
Fischer, Friedrich Christoph Jonathan: Einige Worte von der einzigen Ausgabe des Liedes der Nibelungen und einer zweiten Bearbeitung desselben
1
Fischer, Johann Carl Christian: Graf Pietro dʼAlbi und Gianetta
2
Fischer, Johann Carl Christian: Lebensbeschreibung Opitzens
1
Fischer, Johann Carl Christian: Taschenbuch für Freunde des Riesengebirgs mit Kupfern und einer Charte
1
Flaxman, John: (Illustrationen zur Ilias)
1
Flaxman, John: (Illustrationen zur Odysee)
1
Flaxman, John: Werke
3
Fleischmann, Johann F. A.: Die Geisterinsel
2
Fleming, Paul: An Herrn Hartmann Grahmann
1
Fleming, Paul: Herrn Pauli Flemingi der Med. Doct. Grabschrift, so er ihm selbst gemacht in Hamburg, den XXXIIXX. Tag des Merzen MDXL auf seinem Todbette, drei Tage vor seinem seligen Absterben
1
Fletcher, John: Faithful Shepherdess
1
Florian, Jean-Pierre Claris de: La Chenille
1
Florian, Jean-Pierre Claris de: La Poule de caux
2
Florian, Jean-Pierre Claris de: Œuvres
1
Forberg, Friedrich Karl: Entwicklung des Begriffs der Religion
2
Forbin, Auguste de: Voyage dans le levant
1
Förster, Ernst: Beiträge zur neueren Kunstgeschichte
1
Förster, Ernst: Die Wandgemälde der St. Georgen-Kapelle zu Padua
1
Förster, Ernst: Werke
1
Forster, Georg: Szenen aus dem Sacontala, oder dem unglücklichen Ring, einem indischen, 2000 Jahre alten Drama
1
Fouqué, Caroline de La Motte-: Drei Mährchen. Von Serena
3
Fouqué, Caroline de La Motte-: Edelsteine
2
Fouqué, Caroline de La Motte-: Perlen
2
Fouqué, Caroline de La Motte-: Roderich
3
Fouqué, Friedrich de La Motte-: Alwin
3
Fouqué, Friedrich de La Motte-: Aquilin
2
Fouqué, Friedrich de La Motte-: Aslauga
4
Fouqué, Friedrich de La Motte-: Caesar und Ariovist
1
Fouqué, Friedrich de La Motte-: Das Mädchen und der Lützow'sche Jäger
1
Fouqué, Friedrich de La Motte-: Das Reh
4
Fouqué, Friedrich de La Motte-: Der Abschied
1
Fouqué, Friedrich de La Motte-: Der alte Held
2
Fouqué, Friedrich de La Motte-: Der Falke
4
Fouqué, Friedrich de La Motte-: Der gehörnte Siegfried in der Schmiede
3
Fouqué, Friedrich de La Motte-: Der Ritter und der Mönch
2
Fouqué, Friedrich de La Motte-: Der Zauberring. Ein Ritterroman
2
Fouqué, Friedrich de La Motte-: Des heiligen Johannis Nepomuceni Märtyrer-Tod
3
Fouqué, Friedrich de La Motte-: Die Minnesinger
2
Fouqué, Friedrich de La Motte-: Don Carlos
1
Fouqué, Friedrich de La Motte-: Dramatische Spiele von Pellegrin
17
Fouqué, Friedrich de La Motte-: Gedichte
5
Fouqué, Friedrich de La Motte-: Heinrich
4
Fouqué, Friedrich de La Motte-: Heinrich in Canossa
4
Fouqué, Friedrich de La Motte-: Heinrichs Tod
4
Fouqué, Friedrich de La Motte-: Heinrich und die Sachsen
4
Fouqué, Friedrich de La Motte-: Heinrich und Rudolf
3
Fouqué, Friedrich de La Motte-: Historie vom edlen Ritter Galmy und einer schönen Herzogin aus Bretagne, von Pellegrin
5
Fouqué, Friedrich de La Motte-: Karls des Großen Geburt und Jugendjahre
1
Fouqué, Friedrich de La Motte-: Legende vom heiligen Bonifatius
3
Fouqué, Friedrich de La Motte-: Liebe und Streit
2
Fouqué, Friedrich de La Motte-: Ondine [Ü: Isabelle de Montolieu]
1
Fouqué, Friedrich de La Motte-: Romanzen vom Thale Ronceval
6
Fouqué, Friedrich de La Motte-: Rübezahl
5
Fouqué, Friedrich de La Motte-: Sigurd, der Schlangentödter
11
Fouqué, Friedrich de La Motte-: Sigurds Rache
5
Fouqué, Friedrich de La Motte-: Streit und Liebe
1
Fouqué, Friedrich de La Motte-: Werke
1
Fouqué, Friedrich de La Motte-: (Wer triebʼ allein, unkundig der Behandlung...)
2
Foy, Louis-Étienne de: Lettres du baron de Busbec
1
Fragment dʼun poeme sur Boece
2
Fragmento de Bello Caroli Magni contra Saracenos
1
Fragmentum de Bello Caroli Magni contra Saracenos. Schilter, Johann Georg: Thesaurus antiquitatum
1
François, de Sales: Werke
1
Frankenthalischer Lust-Garten, das ist: beschreibung der Wallfahrt zu denen vierzehn Hailigen Noth-Helfern, die in den Kayserl. Hoch-Stifft Bamberg gelegen, und dem Closter Langheim des Heil. Cisterciensen Ordens einverleibt
4
Frank, Othmar: Chrestomathia Sanscrita
16
Frank, Othmar: De Persidis
1
Frank, Othmar: Fragmente eines Versuchs über dynamsiche Spracherzeugung nach Vergleichen der Persischen, Indischen und Teutschen Sprachen und Mythen
2
Fraser, James Baillie: The History of Nadir-Shah
1
Fraser, James Baillie: Views in the Himala Mountains
2
Freytag, Georg Wilhelm: Lexicon Arabico-Latinum
1
Friedrich August Wolf (Hg.): Platonis dialogorum delectus
2
Friedrich II., Preußen, König: Au Sieur Noël, maître d’hôtel
1
Friedrich II., Preußen, König: (Dissertations historiques)
1
Friedrich II., Preußen, König: Histoire de mon temps
8
Friedrich II., Preußen, König: La Choiseullade
1
Friedrich II., Preußen, König: Mémoire de M. le marquis de Fénelon, ambassadeur du roi de France
1
Friedrich II., Preußen, König: Mémoires de la guerre de 1778
1
Friedrich II., Preußen, König: Mémoires depuis la paix de Hubertsbourg 1763, jusquʼa la fin du partage de la Pologne
1
Friedrich II., Preußen, König: Mémoires pour servir a lʼhistoire de la maison de Brandebourg
1
Friedrich II., Preußen, König: Œuvres
69
Friedrich II., Preußen, König: Œuvres poétiques
2
Friedrich II., Preußen, König: Œuvres posthumes
17
Friedrich II., Preußen, König: (Scherzgedichte)
2
Friedrich II., Preußen, König: Werke
27
Friedrich Wilhelm III., Preußen, König: An mein Volk
1
Friedrich Wilhelm Riemer (Hg.): Briefwechsel zwischen Goethe und Zelter in den Jahren 1796 bis 1832
2
Fries, G.: Kritische Untersuchungen über einige Wörter, Redensarten und Redetheile der deutschen Sprache, mit einem Anhange über das ck und über das ß
1
Fuchs, Georg Daniel: Bibliothek der Kirchenversammlungen des vierten und fünften Jahrhunderts
1
Funck, Karl Wilhelm Ferdinand von: Geschichte Kaiser Friedrich des Zweiten
3
Fürstenwaerther, Moritz: Der Deutsche in Nord-Amerika
1
Fürstenwaerther, Moritz von: Ansichten von Spanien während eines sechsjährigen Aufenthaltes in diesem Lande
1
Gabler, Christian Ernst: Schellings Schrift über die Jenaische allgemeine Literatur-Zeitung
1
Gain de Montagnac, Jean Raymond de: Charles-Quint à St-Just
1
Gain de Montagnac, Jean Raymond de: Théâtre
3
Gallia christiana
1
Gangloff, Karl Wilhelm: Chriemhilde an der Bahre Sigfrieds
2
Gansauge, Hermann von: Kriegswissenschaftliche Analekten in Beziehung auf frühere Zeiten und auf die neuesten Begebenheiten
1
Ganss, Egbert: Kupferstich von Johann Adolf Schlegel (?)
2
Garat, Dominique-Joseph: Mémoires historiques sur Suard et le vocat
1
García de la Huerta, Vicente Antonio: Theatro hespañol
1
Gareis, Franz: Werke
5
Garve, Christian: Versuche über verschiedene Gegenstände aus der Moral, Litteratur und dem gesellschaftlichen Leben
2
Gattel, Claude Marie: Dictionnaire espagnol et françois, françois et espagnol
1
Gatterer, Johann Christoph: Weltgeschichte in ihrem ganzen Umfange
1
Gattinara, Domenico: Lettere inedite del Sig. Abbate Pietro Metastasio Romano Poeta Cesareo tra gli Arcadi Artino Corasio a Rinato Pindario Compastore Arcade
1
Gau, Franz Christian: Antiquités de la Nubie
2
Gauttier dʼArc, Édouard (Hg.): Les Mille et une Nuits, contes arabes traduits en français par Galland, nouvelle édition revue, augmentée, accompagnée de notes
3
Gaveaux, Pierre; Herklots, Karl Alexander: Der kleine Matrose
1
Gebauer, August (Hg.): Deutscher Dichtersaal von Luther bis auf unsere Zeiten
1
Gedike, Friedrich: Ueber die Hülfswörter und über die Tempora des Verbums
1
Gellert, Christian Fürchtegott: Der Hund
1
Gellert, Christian Fürchtegott: Fabeln und Erzählungen
4
Genelli, Hans Christian: Bühnenbildentwurf für August Wilhelm Schlegels "Ion"
4
Genelli, Hans Christian: Das Theater zu Athen, hinsichtlich auf Architectur, Scenerie und Darstellungskunst überhaupt
2
Genelli, Hans Christian: Exegetische Briefe über des Marcus Vitruvius Pollio Baukunst
4
Genelli, Hans Christian: Schlegel, August Wilhelm von: Ion (Rezension)
4
Gentili, Alberico: De jure belli commentatio prima
1
Gérard, François: Bélisaire
1
Gérard, François: (Bildnis der Albertine de Broglie)
3
Gérard, François: Corinne au Cap Misène
12
Gérard, François: Einzug Heinrichs IV. in Paris
1
Gérard, François: Gemälde der Corinna
3
Gérard, François: (Lithographie)
1
Gérard, François: (Portrait der Madame de Staël)
5
Gesenius, Wilhelm: Neues Hebräisch-deutsches Handwörterbuch über das Alte Testament mit Einschluß des biblischen Chaldaismus
1
Gesner, Johann Matthias: Novus linguae latinae Thesaurus. Bd. 4
1
Geßner, Georg: Ruth oder die gekrönte häusliche Tugend
1
Geßner, Salomon: Der Tod Abels
1
Gibbon, Edward: Miscellaneous Works, with Memoirs of his Life and Writings
5
Gildemeister, Johann: Beiträge zu dem Bremischen Magazin der Herren Paniel, Weber und Paulus
1
Gildemeister, Johann: Blendwerke des Vulgaren Rationalismus zur Beseitigung des Paulinischen Anathema
1
Gildemeister, Johann: Die falsche Sanscritphilologie, an dem Beispiel des Herrn Dr. Hoefer in Berlin aufgezeigt
1
Gildemeister, Johann: Dissertationis de rebus Indiae, quo modo in Arabum notitiam venerit, pars prior, quam una cum Masudii loco ad codd. Parisiens. fidem recensito
4
Gildemeister, Johann (Hg.): Kalidasae Meghaduta et Çringaratilaka
1
Ginguené, Pierre Louis: Histoire littéraire d’Italie
2
Giordani, Pietro: Lettera sopra il Dionisio trovato dall'abate Mai
1
Girtanner, Christoph: Historische Nachrichten und politische Betrachtungen über die französische Revolution
1
Gladwin, Francis: Ayeen Akbery
1
Gleich, Johann Andreas: Annales Ecclesiastici
2
Gloeckle, Ferdiand: Lohengrin, ein altdeutsches Gedicht nach der Abschrift des Vaticanischen Manuscriptes
2
Gluck, Christoph Willibald: Iphigénie en Tauride
2
Godtschalck, Georg Moritz: Pfingst-Geschenk, oder das Leben Jesu Christi von seiner Geburt bis zu seiner Himmelfahrt
1
Goethe, Johann Wolfgang von: Amor als Landschaftsmaler
1
Goethe, Johann Wolfgang von: An Schwager Kronos
3
Goethe, Johann Wolfgang von: Arnim, Achim von; Brentano, Clemens: Des Knaben Wunderhorn (Rezension)
2
Goethe, Johann Wolfgang von: Auf die Geburt des Apollo
1
Goethe, Johann Wolfgang von: (Cäcilia)
1
Goethe, Johann Wolfgang von: Das Neueste von Plundersweilern
1
Goethe, Johann Wolfgang von: Das Wiedersehn
1
Goethe, Johann Wolfgang von: Der Besuch
1
Goethe, Johann Wolfgang von: Der Chinese in Rom
1
Goethe, Johann Wolfgang von: Der neue Pausias
3
Goethe, Johann Wolfgang von: Der Sammler und die Seinigen
1
Goethe, Johann Wolfgang von: Der Sänger
1
Goethe, Johann Wolfgang von: Dichten ist ein lustig Metier
1
Goethe, Johann Wolfgang von: Diderots Versuch über die Malerei
2
Goethe, Johann Wolfgang von: Die guten Frauen, als Gegenbild der bösen Weiber
1
Goethe, Johann Wolfgang von: Die romantische Poesie
1
Goethe, Johann Wolfgang von: Episteln
2
Goethe, Johann Wolfgang von: Euphrosyne
1
Goethe, Johann Wolfgang von: Faust 1 [Ü: Abraham Hayward]
2
Goethe, Johann Wolfgang von: Faust. The First Part [Ü: Jonathan Birch]
1
Goethe, Johann Wolfgang von: Faust. The Second Part [Ü: Jonathan Birch]
1
Goethe, Johann Wolfgang von: Faust [Ü: Jonathan Birch]
1
Goethe, Johann Wolfgang von: Goethes neueste Gedichte
3
Goethe, Johann Wolfgang von: Goetheʼs Wilhelm Meisterʼs travels [Ü: Thomas Carlyle]
2
Goethe, Johann Wolfgang von: Heiß mich nicht reden, heiß mich schweigen
1
Goethe, Johann Wolfgang von: Helena-Teil
3
Goethe, Johann Wolfgang von: Mahomet
8
Goethe, Johann Wolfgang von: Neue Schriften
4
Goethe, Johann Wolfgang von: Paläofron und Neoterpe
5
Goethe, Johann Wolfgang von: Sammlung zur Kenntnis der Gebirge von und um Karlsbad
1
Goethe, Johann Wolfgang von: Schäfers Klagelied
1
Goethe, Johann Wolfgang von: Tancred
3
Goethe, Johann Wolfgang von: Vier Jahreszeiten
1
Goethe, Johann Wolfgang von: Was wir bringen
4
Goethe, Johann Wolfgang von: Winckelmann und sein Jahrhundert
7
Goethe, Johann Wolfgang von: Woher im Mantel so geschwinde
1
Goethe, Johann Wolfgang von: Zum 30. Januar 1802
1
Golbéry, Marie Philippe Aimé de: Antiquités de l'Alsace, ou Châteaux, églises et autres monuments des départemens du Haut et du Bas-Rhin
1
Golbéry, Marie Philippe Aimé de: Notice historique sur la vie et les ouvrages de B. G. Niebuhr, conseiller d'État, membre de l'Académie des sciences de Berlin
2
Golbéry, Marie Philippe Aimé de: Notice sur M. A. G. de Schlegel et sur les écrits qu'il a publiés jusqu'à ce jour
4
Golbéry, Marie Philippe Aimé de: Schlegel (Auguste-Guillaume de)
9
Golbéry, Marie Philippe Aimé de: Schlegel (Frédéric)
2
Góngora y Argote, Luis de: Obras
1
Gorresio, Gaspare: Ramayana
1
Gorresio, Gaspare: Rāmāyaṇa, Band 1
1
Görres, Joseph von: Der gehörnte Siegfried und die Nibelungen
1
Görres, Joseph von: Johann Heinrich Voß und seine Totenfeier in Heidelberg
1
Görres, Joseph von: Teutschland und die Revolution
1
Göschen, Georg Joachim: Reise von Johann
1
Gotter, Friedrich Wilhelm: Der Dorfjunker
1
Gotter, Friedrich Wilhelm: Der schöne Geist oder das poetische Schloß
4
Gotter, Friedrich Wilhelm: Die Geisterinsel
3
Gotter, Friedrich Wilhelm: Die Geisterinsel
11
Gotter, Friedrich Wilhelm: Esther
1
Gotter, Friedrich Wilhelm: Gedichte
1
Gotter, Friedrich Wilhelm: Mariane, ein bürgerliches Trauerspiel in drey Aufzügen
3
Gotter, Friedrich Wilhelm: Werke
1
Gottfried, von Straßburg: Tristan und Isolde / Handschrift / München / Bayerische Staatsbibliothek / Cgm 51
1
GND
Göttling, Karl Wilhelm: Über das Geschichtliche im Nibelungenliede
2
Gottsched, Johann Christoph: Grundlegung einer deutschen Sprachkunst
1
Götze, Johann Christian: Die Merckwürdigkeiten der Königlichen Bibliothek zu Dreßden
1
Gozzi, Carlo: Opere
3
Grabener, Christian Gottfried: De libro heroico
2
Graberg af Hemsŏ, Jacob: Su la falsità dell’origine scandinava data ai popoli detti barbari che distrussero l’Impero di Roma
2
Gracián y Morales, Baltasar: Werke
1
Graevius, Johannes Georgius: Thesaurus Antiquitatum Romanarum
1
Graff, Eberhard Gottlieb: Die althochdeutschen Präpositionen
1
Graff, Eberhard Gottlieb: Diutiska
2
Gray, Thomas: Elegy Written in a Country Churchyard
1
Grebner, Thomas: Compendium historiae universalis et pragmaticas Romani imperii et ecclesiae Christianae
1
Griboedov, Aleksandr S.: Leiden durch Bildung [Ü: Karl Gregor von Knorring]
1
Gries, Johann Diederich: Der Wanderer
1
Gries, Johann Diederich: Die Gallier in Rom
3
Gries, Johann Diederich: Die heiligen drei Könige, an Caroline, mit einem Pack Göttinger Würste
1
Gries, Johann Diederich: (Gedicht an Auguste Böhmer)
1
Gries, Johann Diederich: Gedichte und poetische Übersetzungen
1
Gries, Johann Diederich: Phaethon
4
Grimm, Jacob: Altdeutsche Wälder
8
Grimm, Jacob: Aufsätze
1
Grimm, Jacob: Das bairische Armenien
2
Grimm, Jacob: Deutsche Rechtsaltertümer
2
Grimm, Jacob; Grimm, Wilhelm (Hg.): Die beiden ältesten deutschen Gedichte aus dem achten Jahrhundert
1
Grimm, Jacob: Reinhart Fuchs
4
Grimm, Jacob: Saxnote
2
Grimm, Jacob: Über das Nibelungen Liet
1
Grimm, Jacob: Über den altdeutschen Meistergesang
9
Grimm, Wilhelm: Altdänische Heldenlieder, Balladen und Märchen [Ü: Wilhelm Grimm]
5
Grimm, Wilhelm: Hagen, Friedrich Heinrich von der: Das Lied der Nibelungen (Rezension)
1
Groeben, Carl von der: (Zeichnung von Albertine Ida Gustavine de Broglie)
1
Grohmann, Johann Christian August: Ästhetische Beurtheilung des Klopstockischen Messias
5
Gros, Antoine-Jean: Die Apotheose der heiligen Genoveva
1
Gros, Antoine-Jean: Embarquement de la Duchesse d'Angoulême à Pauillac
1
Gruber, Johann Gottfried: Friedrich Schiller
1
Gründung der Stadt Pataliputra und Geschichte der Upakosa [Ü: Hermann Brockhaus]
2
Gruterus, Janus: Inscriptiones Antiquae
1
Guarini, Battista: Der treue Hirte [Ü: August Wilhelm von Schlegel]
1
Guarini, Battista: Il pastor fido
3
Guarini, Battista: Rime
1
Guarini, Battista: Sonette
1
Gūḍhārtha-Dīpikā
1
Guggisberglied
1
Guibert, von Nogent: Gesta dei per Francos
1
Guicciardini, Francesco: Storia d'Italia. Hg. v. Giovanni Rosini
1
Guigniaut, Joseph Daniel: De la Théogonie dʼHésiode
1
Guigniaut, Joseph Daniel: Homère et Hésiode
1
Guigniaut, Joseph-Daniel: Réligions de l’antiquité considérées Principalement dans Leurs Formes Symboliques et Mythologiques [Ü: Friedrich Creuzer]
1
Guiot, de Provins: La Bible Guiot
1
Guizot, François: Des moyens de gouvernement et d’opposition dans l’état actuel de la France. Du gouvernement de la France et du ministère actuel. Histoire du gouvernement représentatif en Europe
1
Guizot, François: Werke
1
Günthner, Sebastian: Geschichte der literarischen Anstalten in Bayern
1
Gutzkow, Karl: Patkul
1
Guyon, Jeanne Marie Bouvier de la Motte: Discours chrétiens et spirituels sur divers sujets qui regardent la vie intérieure
2
Guyon, Jeanne Marie Bouvier de la Motte: Justifications du Moien Court et de lʼExplication du Cantique des Cantiques
2
Guyon, Jeanne Marie Bouvier de la Motte: La Bible traduite en françois avec des explications et des réflexions qui regardent la vie intérieure
2
Guyon, Jeanne Marie Bouvier de la Motte: Werke
1
Hagedorn, Friedrich von: Johann der Seifensieder
1
Hagedorn, Friedrich von: Poetische Werke
1
Hagen, Friedrich Heinrich von der; Habicht, Christian Maximilian; Schall, Carl (Hg.): 1001 Nacht, in arabischer Sprache, nach einer tunesischen Handschrift
2
Hagen, Friedrich Heinrich von der (Hg.): Der Helden Buch
19
Hagen, Friedrich Heinrich von der (Hg.): Der Nibelungen Lied
24
Hagen, Friedrich Heinrich von der (Hg.): Der Nibelungen Lied in der Ursprache mit den Lesarten der verschiedenen Handschriften
8
Hagen, Friedrich Heinrich von der (Hg.): Narrenbuch
1
Hagen, Gottfried: Dat Boich von der stede Colne
1
Hähnel, Ernst Julius: Beethoven-Denkmal
12
Halem, Gerhard Anton von: Gemil und Zoe
1
Halhed, Nathaniel Brassey: A Code of Gentoo Laws, or, Ordinations of the Pundits
1
Hallam, Henry: Introduction to the Literature of Europe in the Fifteenth, Sixteenth, and Seventeenth Centuries
1
Haller, Franz Ludwig: Helvétie sous les Romains
1
Hamberger, Georg Christoph; Meusel, Johann Georg (Hg.): Das gelehrte Teutschland [Deutschland] oder Lexikon der jetzt lebenden teutschen [deutschen] Schriftsteller
1
Hamilton, Alexander: Catalogue des manuscrits sanscrits de la bibliothèque impérial
2
Hamilton, Alexander: The Hitopadesa in Sanscrita Language
28
Hamilton, Francis: Genealogical Tables of the Deities, Princes, Heros and Remarcable Personages of the Hindus, extracted from the Sacred Writings of that People
2
Hamilton, Francis: Genealogies of the Hindus, extracted from their Sacred Writings
2
Hamilton, William Richard: Letter from W.R. Hamilton, to the Earl of Elgin, on the new Houses of Parliament
2
Hamilton, William Richard: Second letter from W.R. Hamilton, Esq. to the Earl of Elgin, on the propriety of adopting the Greek style of architecture in the construction of the new Houses of Parliament
2
Hamilton, William Richard: Third letter from W.R. Hamilton, Esq. to the Earl of Elgin, on the propriety of adopting the Greek style of architecture in preference to the Gothic, in the construction of the new Houses of Parliament
2
Hammarskjöld, Lars: Werke
1
Hammer-Purgstall, Joseph von: Contes inédites des Mille et Une Nuits, extraits de lʼoriginal arabe, traduits en français par Guillaume S. Trébutien
2
Hammer-Purgstall, Joseph von: Der Tausend und eine Nacht noch nicht übersetzte Märchen
7
Hammer-Purgstall, Joseph von: Mines de l'Orient
1
Hammer-Purgstall, Joseph von: Mysterium Baphometis Revelatum
1
Hammer-Purgstall, Joseph von: Schlegel, August Wilhelm von: Réflexions sur lʼétude des langues asiatiques (Rezension)
3
Hammer-Purgstall, Joseph von: Sur le langage des fleurs
1
Hammer-Purgstall, Joseph von: Werke
1
Hannoverisches Gesangbuch
4
Hansiz, Marcus: Germaniae sacrae
2
Hans Sachs, folio (1558–1579)
2
Hanūmat: Mahānāṭaka
1
Hardenberg, Karl von: Der Frühling
2
Hardenberg, Karl von: Die Pilgrimmschaft nach Eleusis
6
Hardenberg, Karl von: Gedichte
6
Ḥarīrī, al-Qāsim Ibn-ʿAlī al-: Les Cinquantes Sánces [Ü: Armand Pierre Caussin de Perceval]
1
Harless, Adolf Gottlieb Christoph: Brevior Notitia Litteraturae Romanae in primis scriptorum Latinorum
1
Harless, Adolf Gottlieb Christoph; Fabricius, Johann Albert: Biblioteca Graeca
4
Harless, Hermann: Die höhere Humanitätsbildung in ihren Hauptstufen
1
Hartmann, Ferdinand: (Die Fußwaschung Christi)
1
Hartmann, Ferdinand: (Satire auf Weimarer Kunstschule)
1
Hātifī, ʿAbdallāh: Layli o Majnun
1
Haughton, Graves (Hg.): Mánava-Dherma Sástra or The Institutes of Menu
37
Haughton, Graves: Rudiments of Bengálí Grammar
1
Haughton, Graves: Werke
1
Haus, Josef Jakob von: Poeticae Aristotelis Nova versio Ex Graeco Exemplari Editionis Novissimae Haud Paucis Tamen In Locis Si Diis Placet Emendato
1
Haxthausen, Werner von: Neugriechische Volkslieder
1
Hayward, Abraham: Schlegel, August Wilhelm von: Réflexions sur lʼetude des langues asiatiques, addressées à Sir James Mackintosh; suivies dʼune lettre a M. Horace Hayman Wilson (Ankündigung)
4
Head, Francis Bond: Bubbles from the brunnen of Nassau
1
Head, Francis Bond: Rough notes taken during some rapid journeys across the Pampas and among the Andes
1
Hebel, Johann Peter: Schatzkästlein des rheinischen Hausfreundes
1
Heeren, Arnold H. L.: Etwas über meine Studien des alten Indiens
2
Heeren, Arnold H. L.: Handbuch der Geschichte der Staaten des Alterthums
1
Heeren, Arnold H. L.: Ideen über die Politik, den Verkehr und den Handel der vornehmsten Völker der Alten Welt
3
Heeren, Arnold H. L.: Ideen über die Politik, den Verkehr und den Handel der vornehmsten Völker der Alten Welt. Erster Theil: Asiatische Völker
2
Heeren, Arnold H. L.: Ideen über die Politik, den Verkehr und den Handel der vornehmsten Völker der Alten Welt. Zweyter Theil: Africanische Völker
1
Heeren, Arnold H. L.: Ioannis Stobaei Eclogarum Physicarum et Ethicarum
1
Heeren, Arnold H. L.: Zusätze und Umarbeitungen aus der vierten Ausgabe der Ideen über die Politik und den Handel der vornehmsten Völker des Alterthums
1
Hegel, Georg Wilhelm Friedrich: Differenz des Fichteschen und Schellingschen Systems der Philosophie
1
GND
Hegel, Georg Wilhelm Friedrich: Dissertationi philosophicae de orbitis planetarum premissae theses [...]
1
Hegel, Georg Wilhelm Friedrich: Glauben und Wissen oder die Reflexionsphilosophie der Subjectivität in der Vollständigkeit ihrer Formen als Kantische, Jacobische und Fichtesche Philosophie
2
GND
Hegel, Georg Wilhelm Friedrich: Über die wissenschaftlichen Behandlungsarten des Naturrechts, seine Stelle in der praktischen Philosophie und sein Verhältnis zu den positiven Rechtswissenschaften
1
Hegewald, Leonhard: Werke
1
Heinecke, Johann Gottlieb: Antiquitates romanas jurisprudentiam illustrantes
1
Heinecke, Johann Gottlieb: Institutiones
1
Heine, Gustav: Die Cadetten
1
Heinse, Wilhelm: Ardinghello und die glückseeligen Inseln
1
Heinse, Wilhelm: Hildegard von Hohenthal
1
Hempel, Herr: (Übersetzung der Werke Friedrichs II. von Preußen)
4
Hemsterhuis, Frans: Alexis, oder vom goldnen Weltalter, ein Gespräch
3
Hemsterhuis, Frans: Alexis, oder vom goldnen Weltalter [Ü: Friedrich Heinrich Jacobi]
2
Hemsterhuis, Frans: Description philosophique du caractere de feu Mr. F. Fagel
1
Hemsterhuis, Frans: Œuvre philosophiques
1
Henke, Carl Joseph: Neue Englische Sprachlehre nach Johnson’s und Murray’s Grundsätzen [...] (1825)
1
Herakleides von Syrakus
1
Herder, Johann Gottfried von: Der rauschende Strom
1
Herder, Johann Gottfried von: Gott. Einige Gespräche über Spinoza’s System nebst Shaftesbury’s Naturhymnus
1
GND
Herder, Johann Gottfried von: Homer (Homerus), ein Günstling der Zeit
1
Herder, Johann Gottfried von: Homer (Homerus) und Ossian
1
Herder, Johann Gottfried von: Leukotheaʼs Binde
1
Herder, Johann Gottfried von: Madera
1
Herder, Johann Gottfried von: Stimmen der Völker in Liedern
2
Herder, Johann Gottfried von: Terpsichore
10
Herder, Johann Gottfried von: Volkslieder
5
Herder, Johann Gottfried von: Zerstreute Blätter
1
Hérissant, Louis-Théodore: Observations historiques sur la littérature allemande
1
Hermann, Carl Heinrich; Förster, Ernst; Götzenberger, Jakob: (Fresco-Gemälde in der academischen Aula zu Bonn)
3
Hermann, Gottfried: De metris poetarum graecorum et romanorum
1
Hermann, Gottfried: Dissertatio de mythologia Graecorum antiquissima
1
Hermann, Gottfried: Handbuch der Metrik
5
Hermann, Gottfried: Handbuch der Mythologie aus Homer und Hesiod mit Anmerkungen von Heyne
1
Hermann, Gottfried: Opuscula
3
Hermann, Gottfried: Über das Wesen und die Behandlung der Mythologie
2
Hermann, Johann Gottfried; Creuzer, Friedrich: Briefe über Homer und Hesiodus vorzüglich über die Theogenie
1
Hermesianax, Colophonius: Die Elegie des Hermesianax [Ü: August Wilhelm von Schlegel]
2
Herodotus: Historiae
1
Hesiodus: Werke und Orfeus der Argonaut [Ü: Johann Heinrich Voß]
4
Hesse, Franz Hugo: Die preußische Pressgesetzgebung, ihre Vergangenheit und Zukunft
1
Hess, Jean Gaspard: Vie dʻUlrich Zwingle, Reformateur de la Suisse
1
Heßler, Franz: Susrutas Ayurvedas
1
Heydenreich, Karl Heinrich: System der Ästhetik
3
Heyne, Christian Gottlob: Ankündigung des Prorectorat-Wechsels [Ü: August Wilhelm von Schlegel]
1
Heyne, Christian Gottlob: Apollodori Atheniensis bibliothecae
1
Heyne, Christian Gottlob: Friedrich von Schlegel: Über die Sprache und Weisheit der Indier (Rezension)
2
Heyne, Christian Gottlob (Hg.): Albii Tibulli Carmin
1
Heyne, Christian Gottlob: Litterarum artiumque inter antiquiores Graecos conditio ex Musarum aliorum
1
Heyne, Christian Gottlob: Werke
1
Heyse, Johann Christian August: Theoretisch-praktische deutsche Grammatik oder Lehrbuch zum reinen und richtigen Sprechen, Lesen und Schreiben der deutschen Sprache
1
Hickes, George: Linguarum veterum septentrionalium thesaurus grammatico-criticus et aechaeologicus
3
(Hier liege ich Julia Alpinula)
1
Hildesheim, Johann von: Die Legende von den heiligen drei Königen
1
Hippel, Theodor Gottlieb von: Der Mann nach der Uhr oder Der ordentliche Mann
1
Hirt, Aloys Ludwig: Laokoon
2
Hirt, Aloys Ludwig: Über das Pantheon
1
Histoire littéraire de la France
1
Historia de vita Caroli Magni et Rolandi eius nepotis
3
Hoffmann, Joseph: Achill auf Scyros
2
Hogarth, William: Kupferstiche
2
Hohelied
1
Hohenems-Münchener Handschrift A
3
Holbein, Franz Ignaz von: Der Tyrann von Syrycus
1
Holbein, Franz Ignaz von: Fridolin
1
Holbein, Hans: Der Todtentanz
2
Holtzmann, Adolf: Ramajana
1
Homann, Johann Baptist: Großer Atlas über die ganze Welt
1
Homerus: Carmina
1
Homerus: Ilias [Ü: Johann Heinrich Voß]
7
Homerus: Odüßee [Ü: Johann Heinrich Voß]
12
Homerus: Odyssee [Ü: August Ludwig Wilhelm Jacob]
1
Homerus: Werke
3
Homerus: Werke übersetzt [Ü: Johann Heinrich Voß]
1
Homerus: Werke [Ü: Ernst Wiedasch]
1
Homerus: Werke [Ü: Johann Heinrich Voß]
15
Höpfner, Ludwig Julius Friedrich: Heineccii institutiones
1
Hoppenstedt, Carl Wilhelm: Actenmäßige Darstellung der Vorfälle, welche im letztverflossenen Sommer auf der Universität zu Göttingen stattgefunden haben
1
Horatius Flaccus, Quintus: Epistulae [Ü: Christoph Martin Wieland]
1
Horatius Flaccus, Quintus: Lyrische Gedichte [Ü: Friedrich August Eschen]
4
Horatius Flaccus, Quintus: Saturae [Ü: Christoph Martin Wieland]
1
Horatius Flaccus, Quintus: Werke [Ü: Johann Heinrich Voß]
4
Hormayr, Joseph von: Carl der Fünfte
1
Hormayr, Joseph von: Correspondenz zwischen dem römischen und französisch-kaiserlichen Hofe
1
Hormayr, Joseph von: Geschichte der gefürsteten Grafschaft Tirol
2
Hormayr, Joseph von: Österreichischer Plutarch
6
Hormayr, Joseph von: Taschenbuch für die vaterländische Geschichte
1
Horn, Franz: Geschichte und Kritik der deutschen Poesie und Beredsamkeit
1
Horn, Franz: Kampf und Sieg
1
Horn, Franz: Raphael von Salvatara, oder der Mann ohne Liebe
1
Horsfield, Thomas: Notice of a new genus of Mammalia found in Sumatra by Sir T. Stamford Raffles
1
Houben, Philipp; Fiedler, Franz: Denkmaeler von Castra Vetera und Colonia Traiana in Ph. Houbenʼs Antiquarium zu Xanten
1
Houdon, Jean-Antoine: Büste von Jacques Necker
2
Houwald, Ernst von: Das Bild
1
Hrabanus, Maurus: De inventione linguarum
2
Huber, Leopold: Die Teufelsmühle am Wienerberg
1
Huber, Ludwig Ferdinand: Athenaeum (Rezension)
6
Huber, Ludwig Ferdinand: Ergebenste Bitte an den gelehrten Hn. Recensenten des hyperboreischen Esels in No. 415 der A.L.Z
1
Huber, Ludwig Ferdinand: Erzählungen
3
Huber, Ludwig Ferdinand: Goethe, Johann Wolfgang von: Schriften (Rezension)
1
Huber, Ludwig Ferdinand: Nicolai, Friedrich: Vertraute Briefe von Adelheid B. an ihre Freundin Julie S. (Rezension)
1
Huber, Ludwig Ferdinand: Schlegel, Friedrich von: Lucinde (Rezension)
3
Huber, Therese (Hg.): Johann Georg Forster’s Briefwechsel
1
Hufeland, Christoph Wilhelm von: Makrobiotik oder die Kunst das menschliche Leben zu verlängern
1
GND
Hufeland, Christoph Wilhelm von: System der praktischen Heilkunde
3
Hugo, Victor: La Préface de Cromwell
1
Hülsen, August Ludwig: Aufsatz (?)
1
Hülsen, August Ludwig: Naturbetrachtungen auf einer Reise durch die Schweiz
5
Hülsen, August Ludwig: Prüfung der von der Akademie der Wissenschaften zu Berlin aufgestellten Preisaufgabe
1
Hülsen, August Ludwig: Ueber die natürliche Gleichheit der Menschen
5
Hülsen, August Ludwig: Werke
1
Humboldt, Alexander von: Asie centrale
2
Humboldt, Alexander von; Bonpland, Aimé; Kunth, Carl Sigismund: Synopsis plantarum, quas in itinere ad plagum aequinoctialem orbis novi
1
Humboldt, Alexander von; Bonpland, Aimé: Nova genera et species plantarum
1
Humboldt, Alexander von: Central-Asien [Ü: Wilhelm Mahlmann]
1
Humboldt, Alexander von: De distributione geographica plantarum, secundum coeli temperiem et altitudinem montium
1
Humboldt, Alexander von: Die Lebenskraft oder der Rhodische Genius
1
Humboldt, Alexander von: Examen critique de l’histoire de la géographie du nouveau continent et des progrès de l’astronomie nautique aux quinzième et seizième siècles
1
Humboldt, Alexander von: Französische Schriften
2
Humboldt, Alexander von: Ideen zu einer Physiognomik der Gewächse
1
Humboldt, Alexander von; [Kohlrausch, Henriette]: Physikalische Geographie. Vorgetragen von Alexander von Humboldt. [Berlin], [1828]. [= Nachschrift der ‚Kosmos-Vorträge‛ Alexander von Humboldts in der Sing-Akademie zu Berlin, 6.12.1827–27.3.1828.]
1
Humboldt, Alexander von: Über die Haupt-Ursachen der Temperatur-Verschiedenheit auf dem Erdkörper
1
Humboldt, Alexander von: Ueber die Verschiedenartigkeit des Naturgenusses und die wissenschaftliche Entwickelung der Weltgesetze (Vortrag, Jena 1836)
1
Humboldt, Wilhelm von: An die Sonne (1820)
1
Humboldt, Wilhelm von: An essay on the best means of ascertaining the affinities of oriental languages
2
Humboldt, Wilhelm von: Anhang zu Rückerts Recension von Durschs Ghatakarparam
2
Humboldt, Wilhelm von: Goethes Zweiter römischer Aufenthalt (Rezension). In: Jahrbücher für wissenschaftliche Kritik
1
Humboldt, Wilhelm von: Jacobi, Friedrich Heinrich: Woldemar (Rezension)
1
Humboldt, Wilhelm von: Mémoire sur la séparation des mots dans les textes samscrits
2
Humboldt, Wilhelm von: Prüfung der Untersuchungen über die Urbewohner Hispaniens vermittelst der Vaskischen Sprache
7
Humboldt, Wilhelm von: Rom
3
Humboldt, Wilhelm von; Schulz, Friedrich Eduard: Über die Buchstabenschrift und ihren Zusammenhang mit dem Sprachbau / Sur l’écriture alphabétique et ses rapports avec la structure du langage
1
Humboldt, Wilhelm von: Über das Entstehen der grammatischen Formen und ihren Einfluß auf die Ideenentwicklung
4
Humboldt, Wilhelm von: Über das vergleichende Sprachstudium in Beziehung auf die verschiedenen Epochen der Sprachentwicklung
2
Humboldt, Wilhelm von: Über den Geschlechtsunterschied und dessen Einfluß auf die organische Natur
2
Humboldt, Wilhelm von: Über die männliche und weibliche Form
2
Humboldt, Wilhelm von: Über die unter dem Namen Bhagavad-Ghítá bekannte Episode des Mahá-Bhárata
8
GND
Humboldt, Wilhelm von: Über die Verschiedenheit des menschlichen Sprachbaus und ihren Einfluss auf die geistige Entwicklung des Menschengeschlechts
3
Humboldt, Wilhelm von: Ueber den Dualis
1
Humboldt, Wilhelm von: Ueber die Aufgabe des Geschichtschreibers
1
Humboldt, Wilhelm von: Ueber die Bhagavad Gitâ
9
Humboldt, Wilhelm von: Ueber die Buchstabenschrift und ihren Zusammenhang mit dem Sprachbau
3
Humboldt, Wilhelm von: Ueber die in der Sanskrit-Sprache durch die Suffixa twâ und ya gebildeten Verbalformen
15
Humboldt, Wilhelm von: Untersuchungen über die Amerikanischen Sprachen
2
Humboldt, Wilhelm von: Vorerinnerung über Schiller und den Gang seiner Geistesentwicklung
2
Humboldt, Wilhelm von: Wie weit darf sich die Sorgfalt des Staats um das Wohl seiner Bürger erstrecken?
1
Hummel, Johann Erdmann: Achill auf Scyros
2
Hummel, Johann Erdmann: Der Kampf Achills mit den Flüssen
2
Hummel, Ludwig: Befreiung der Andromeda durch Perseus
1
Hund, Wiguleus, Gewold, Christoph: Metropolis Salisburgensis
1
Hurtado de Mendoza, Diego (zugeschr.): La vida de Lazarillo de Tormes y de sus fortunas y adversidades
2
Hystorien vom Amadis aus Frankreich (1569ff.)
1
Ideler, Ludwig: Colebrooke, Henry T.: Algebra, with Arithmetic and Mensuration, from the Sanscrit of Brahmegupta and Bhascara (Rezensionsplan)
1
Ideler, Ludwig: Über den Ursprung des Tierkreises
3
Ideler, Ludwig: Über die Zeitrechnung der Chinesen (1839)
1
Iffland, August Wilhelm: Das Erbtheil des Vaters
1
Iffland, August Wilhelm: Der Mann von Wort
1
Iffland, August Wilhelm: Die Hagestolzen
2
Iffland, August Wilhelm: Meine theatralische Laufbahn
2
Ilgen, Karl David: Chorus graecorum tragicus qualis fuerit et quare usus eius hodie revocari nequest
1
Ilgen, Karl David: Opuscula varia Philologica
1
Inghirami, Francesco: Estratto del libro intitolato De Pateris Antiquorum con aggiunte di osservazioni e note
2
Iordanes, Gotus: Die Gotengeschichte
2
Isaac Reed (Hg.): The Plays of William Shakespeare
1
Isalde. In. Buch der Liebe
1
Isocrates: Panegyricus [Ü: Christoph Martin Wieland]
1
Iwain, ein Heldengedicht vom Ritter Hartmann, der nächst um die Zeiten K. Friedrichs des Rothbarts lebte
2
Jacobi, Friedrich Heinrich: Brief an (Johann Gottlieb) Fichte Eutin 3. März 1799
1
Jacobi, Friedrich Heinrich: Der Kunstgarten
1
Jacobi, Friedrich Heinrich: Über eine Weissagung Lichtenbergs
3
Jacobi, Friedrich Heinrich: Über gelehrte Gesellschaften, ihren Geist und Zweck
2
Jacobi, Friedrich Heinrich: Ueber das Unternehmen des Kriticismus
1
Jacobi, Friedrich Heinrich: Zufällige Ergießungen eines einsamen Denkers in Briefen an vertraute Freunde
1
Jacobs, Friedrich: Elementarbuch der griechischen Sprache für Anfänger und Geübtere
2
Jacobs, Friedrich: Tempe
2
Jagemann, Ferdinand: Befreiung der Andromeda durch Perseus
1
Jahn, Friedrich Ludwig: Deutsches Volksthum
1
Jameson, Anna: Characteristics of the female characters of Shakespeare
1
Jameson, Anna: Shakespeareʼs Frauengestalten [Ü: Levin Ludwig Schücking]
1
Jansen, Hendrik: De l'invention de l'imprimerie
1
Jansen, Hendrik: Essai sur l'origine de la gravure en bois
1
Jäsche, Gottlob Benjamin: Immanuel Kants Logik
2
Jean Paul: Blumen-, Frucht- und Dornenstücke oder Ehestand, Tod und Hochzeit des Armenadvokaten F. St. Siebenkäs im Reichsmarktflecken Kuhschnappel
4
GND
Jean Paul: Fouqué, Friedrich de La Motte-: Sigurd, der Schlangentödter (Rezension)
2
Jean Paul: Hesperus
2
Jean Paul: Staël-Holstein, Anne Louise Germaine de: Corinne ou lʼItalie (Rezension)
1
Jenisch, Daniel: Diogenes Laterne
1
Jerusalem, Johann Friedrich Wilhelm: Betrachtungen über die vornehmsten Wahrheiten der Religion
1
GND
Johann Gottlob Schneider (Hg.): Vitruvius de architectura
1
Johnson, Samuel; Steevens, George: Supplement to the edition of Shakespeareʼs plays
2
Jones, Edward: The Bardic Museum of Primitive British Literature; and other admirable Rarities; forming the Second Volume of the Musical, Poetical and Historical Relicks of the Welsh Bards and Druids
1
Jones, William: A grammar of the Persian language
1
Jones, William: Histoire de Nader-Chah
1
Jones, William: Hitopadesa Of Vishnu Sarman
8
Jones, William: Institutes of Hindu law or the ordinances of Menu
6
Jones, William: The Works
1
Jonson, Ben: Works
1
Juan, de Mena: Las obras del famoso poeta Juan de Mena
1
Junius, Franciscus; Stiernhielm, Georg: Evangelia ab Ulfila
1
Kaaz, Carl Ludwig: (Golf von Neapel)
1
Kähler, Ludwig August: Herrmann von Löbeneck oder Geständnisse eines Mannes
1
Kālidāsa: Ghatakarparam
1
Kālidāsa: Nalodaya
3
Kālidāsa: Raghuvansa
13
Kalkreuth, Heinrich W. von: Die Idee
1
Kalkreuth, Heinrich W. von: Werke
1
Kalthoff, Johann Heinrich: Jus matrimonii veterum Indorum cum eodem Hebraeorum jure subinde comparatum
1
Kanngießer, Peter Friedrich: Die alte komische Bühne in Athen
1
Kant, Immanuel: Erklärung in Beziehung auf Fichtes Wissenschaftslehre
1
Kant, Immanuel: Sämmtliche kleine Schriften
5
Kant, Immanuel: Sämmtliche kleine Schriften, Bd. 4
1
Kant, Immanuel: Über die Buchmacherey
2
Kayser, Karl Philipp: Philetae Coi fragmenta quae reperiuntur
1
Keil, Johann Georg (Hg.): Bibliotheca italiana
1
Keller, Heinrich: Judith
7
Kemble, John Mitchell: The anglosaxon poems of Beovulf, the travellers song and the battle of Finnesburg
1
Kempelen, Wolfgang von: Mechanismus der menschlichen Sprache nach der Beschreibung seiner sprechenden Maschine
1
Kiesewetter, Johann Gottfried Carl Christian: Logik zum Gebrauch für Schulen
1
Kiesewetter, Johann Gottfried Carl Christian: Prüfung der Herderschen Metakritik
1
Kinderling, Johann Friedrich August: Geschichte der Nieder-Sächsischen oder sogenannten Plattdeutschen Sprache
1
Kinderling, Johann Friedrich August: Werke
1
King, Edward; Aglio, Agostino; Dupaix, Guillermo: Antiquities of Mexico
1
Kjaempeviser
1
Klaproth, Heinrich Julius: Asia polyglotta
3
Klaproth, Heinrich Julius, Merian, Andreas von (Hg.): Tripartitum seu de analogia linguarum libellus
1
Klaproth, Heinrich Julius: Verzeichniss der chinesischen und mandshuischen Bücher und Handschriften der Königlichen Bibliothek zu Berlin
2
Kleist, Ewald Christian von: Sämmtliche Werke nebst des Dichters Leben aus seinen Briefen an Gleim
2
Kleist, Franz Alexander von: Liebe und Ehe in drei Gesängen
1
Klinger, Friedrich Maximilian von: Der Derwisch
1
Klinger, Friedrich Maximilian von: Der verbannte Göttersohn
1
Klinger, Friedrich Maximilian von: Fausts Leben, Thaten und Höllenfahrt
2
Klinger, Friedrich Maximilian von: Schauspiele
1
Klopstock, Friedrich Gottlieb: Drey Gebete, eines Freygeistes, eines Christen und eines guten Königs
1
Klopstock, Friedrich Gottlieb: Gedichte
3
Klopstock, Friedrich Gottlieb: Grammatische Gespräche
14
Klopstock, Friedrich Gottlieb: Hermanns-Schlacht
1
Klopstock, Friedrich Gottlieb: Hermannʼs Tod
2
Klopstock, Friedrich Gottlieb: Selma und Selmar
1
Klopstock, Friedrich Gottlieb: Ueber die deutsche Rechtschreibung
1
Klopstock, Friedrich Gottlieb: Ueber Sprache und Dichtkunst
3
Klopstock, Friedrich Gottlieb: Vater unser
1
Klopstock, Friedrich Gottlieb: Vom deütschen Hexameter
1
Klopstock, Friedrich Gottlieb: Vom gleichen Verse
1
Klopstock, Friedrich Gottlieb: Von der Nachahmung des griechischen Sylbenmaßes
1
Klotz, Christian Adolf (Hg.): Saxonis Grammatici Historiae Danicae libri XVI
1
Knight, Richard Payne: An Analytical Essay on the Greek Alphabet
1
Knight, Richard Payne: Prolegomena ad Homerum sive de carminum Homericorum origine auctore et aetate, itemque de priscae linguae progressu et praecoci maturitate
2
Koch, Joseph Anton: Heroische Landschaft mit dem Regenbogen
1
Koch, Joseph Anton: Zeichnungen zu Dantes Inferno und Purgatorio
3
Koch, Joseph Anton: Zeichnungen zum Ossian
1
Köhler, Johann David: Bequemer Schul- und Reisen-Atlas
1
Köhler, Johannn David: Disquisitio de inclyto libro poetico Theuerdank
1
König Cophetua (altschottische Ballade)
1
Konrad (von Würzburg): Trojanerkrieg
1
Konstitution der Königlichen Akademie der bildenden Künste
2
Konstitutions-Urkunde der Königlichen Akademie der Wissenschaften
2
Köppen, Johann Heinrich Justus: Einleitung in die erklärenden Anmerkungen oder Homers Leben und Gesänge
1
Koreff, Johann Ferdinand: (Frühlingsfantasien)
1
Koreff, Johann Ferdinand: Gedichte
1
Koreff, Johann Ferdinand: Lied der Weihe an Luise, Königin von Preußen, bei Übersendung der Oper „Die Vestalin“
1
Körner, Christian Gottfried: Ideen über Deklamation
1
Körner, Christian Gottfried: Meyers Boten
1
Körner, Christian Gottfried: Über Charakterdarstellung in der Musik
1
Körner, Christian Gottfried: Über Wilhelm Meisters Lehrjahre
2
Kőrösi Csoma, Sándor: A Dictionary Tibetan and English
2
Kőrösi Csoma, Sándor: A Grammar of the Tibetan Language, in English
2
Körte, Wilhelm: Gleims Leben
1
Körte, Wilhelm (Hg.): Briefe deutscher Gelehrten aus Gleims Nachlaß
1
Körte, Wilhelm (Hg.): Briefe zwischen Gleim, Wilhelm Heinse und Johann von Müller
3
Körte, Wilhelm (Hg.): Gleims Sämtliche Werke
1
Kosegarten, Gotthard Ludwig: An das Abendroth
1
Kosegarten, Gotthard Ludwig: Ein Lied an Jenny
1
Kosegarten, Gotthard Ludwig: Gedichte
2
Kosegarten, Gotthard Ludwig: Poesien
2
Kosegarten, Johann Gottfried Ludwig: Arabische Chrestomathie und Grammatik
1
Kosegarten, Johann Gottfried Ludwig: Nala
3
Kosegarten, Ludwig Gotthard: An die Zeitgenossen
1
Kosegarten, Ludwig Gotthard: Ida von Plessen
1
Kotzebue, August von: Bayard
2
Kotzebue, August von: Das merkwürdigste Jahr meines Lebens
1
Kotzebue, August von: Das Zauberschloß
2
Kotzebue, August von: Die deutschen Kleinstädter
3
Kotzebue, August von: Die französischen Kleinstädter
1
Kotzebue, August von: Die Kreuzfahrer
2
Kotzebue, August von: Die Spanier in Peru oder Rollaʼs Tod
1
Kotzebue, August von: Doctor Bahrdt mit der eisernen Stirn
8
Kotzebue, August von: Erklärung des Verfassers der Schrift: Doktor Bahrdt mit der eisernen Stirn
2
Kotzebue, August von: Gustav Wasa
2
Kotzebue, August von: Johanna von Montfaucon
3
Kotzebue, August von: Kotzebue, August von: Der hyperboreeische Esel (Rezension)
2
Kotzebue, August von: Pachter Feldkümmel von Tippelskirchen
2
Kotzebue, August von: Rochus Pumpernickel auf eine andere Manier
2
Kotzebue, August von: Werke
3
Kratter, Franz: Mädchen von Marienburg
1
Kratter, Franz: Schauspiele
1
Krebs, Johann Philipp: Anleitung zum Lateinischschreiben in Regeln und Beispielen zur Uebung
1
Kupferstiche aus der Sammlung von August Wilhelm von Schlegel
1
Kurowski-Eichen, Friedrich von: Die Sonnentempel des alten Europäischen Nordens und deren Kolonien
1
Kyd, Thomas: The Spanish Tragedy
1
Laborde, Alexandre de: Itinéraire descriptif de lʼEspagne
1
Lachmann, Karl (Hg.): Der Nibelunge Not mit der Klage in der ältesten Gestalt mit den Abweichungen der gemeinen Lesart
6
Lachmann, Karl (Hg.): Wolfram von Eschenbach
1
Lachmann, Karl (Hg.): Zwanzig Lieder von den Nibelungen
2
Lachmann, Karl: Über die ursprüngliche Gestalt des Gedichts von der Nibelungen Not
1
La Croze, Maturin Veyssière: Thesaurus epistolarum
1
La Faille, Germain de: Annales de la ville de Toulouse
1
Lafontaine, August Heinrich Julius: Die List der Natur, oder List über List
1
La Garde, Auguste de: LʼEnthousiaste ou lʼavez vous vue?
2
La Harpe, Jean-François de: Philoctète
1
La Matrone d’Éphèse
1
Lambeck, Peter: Commentarii de Augustissima Bibliotheca Caesarea Vindobonensi
2
Lancelot
4
Landor, Walter Savage: Imaginary Conversations of Literary Men and Statesmen
1
Langbein, August Friedrich Ernst: Ganymeda
1
Lange, Joseph: Biographie des Joseph Lange, K. K. Hofschaupielers
1
Langer, Johann Peter von: Portraits
1
Langlès, Louis Mathieu: Monuments anciens et modernes de lʼIndoustan
3
Langlois, Alexandre: Harivansa ou Histoire de la famille de Hari
1
Langlois, Alexandre: Lettre adressée à M. le président du Conseil de la Société Asiatique
1
Langlois, Alexandre: Schlegel, August Wilhelm von (Hg.): Bhagavad-Gita (Rezension. In: Journal Asiatique, 1824–1825)
9
Lanzelot (Altfranzösisch, Prosa)
1
Lanzi, Luigi Antonio: Saggio di lingua etrusca
3
Laokoon-Gruppe
4
Lassen, Christian: Beiträge zur Kunde des indischen Altertums aus dem Mahâbhârata
1
Lassen, Christian: Bopp, Franz: Grammatica critica linguae sanscritae (Rezension)
1
Lassen, Christian: Commentatio geographica atque historica de pentapotamia indica
16
Lassen, Christian: Die Altpersischen Keil-Inschriften von Persepolis
1
Lassen, Christian: Excerpta ex historiis Arabum de expeditionibus Syriacis Nicephori Phocae et Joannis Tzimiscis
2
Lassen, Christian: Gymnosophista, sive Indicae philosophiae documenta
9
Lassen, Christian (Hg.): Gita Govinda
2
Lassen, Christian: Institutiones linguae Pracriticae
1
Lassen, Christian: Malatimadhavae fabulae Bhavabhutis actus primus
5
Lassen, Christian: Ueber Herrn Professor Bopps grammatisches System der Sanskrit-Sprache
3
Lassen, Christian: Vorlesungen
2
Lassen, Christian: Werke
1
Latham, John: Index ornithologicus, sive sytema ornithologiae, complectens avium divisionem in classes, ordines, genera, species, ipsarumque varietates
1
Latini, Brunetto: Il Tesoro
2
Laudatio Honori & Memoriae V. CL. Martini Opitii
1
Law, William: La voie de la science divine [Ü: Louis de La Forest Divonne]
1
Le Brun, Charles: (Die Taten Ludwigs XIV.)
1
Leibniz, Gottfried Wilhelm: De Origine Francorum Disquisitio
1
Leibniz, Gottfried Wilhelm: Opera Philosophica quae exstant latina, gallica, germanica [Ü: Johann Eduard Erdmann]
2
Le Livre de Perceforest
1
Lemaire, N. E.: Q. Curtius Rufus, ad codices parisinos recensitus [...]
1
Lemaire, N. E.: Werke
1
Lemercier, Népomucène-Louis: Cours analytique de littérature générale
1
Lemercier, Népomucène-Louis: La Panhypocrisiade, ou le spectacle infernal du XVIe siècle
2
Lemercier, Népomucène-Louis: Les Amours
1
Lennep, Joannes Daniel van: Etymologicum linguae graecae [...] editionem curavit, adque animadversiones, cum aliorum, tum suas adjecit Everhard Scheid [...]
1
Lennep, Johannes Daniel van: De analogia linguae Graecae
3
Le Noble, Eustache; Le Noble, Pierre; Le Roux, Philibert-Joseph: Jean danse mieux que Pierre, Pierre danse mieux que Jean, ils dansent bien tous deux
1
Lenz, Karl Gotthold: Die Ebene von Troja nach den Berichten von Choiseul-Gousfier und andern Reisenden
1
Lenz, Robert (Hg.): Urvasia
3
Leonardo, da Vinci: Bildnis von Ludovico Sforza (Ludovico, Milano, Duca)
1
Leonardo, da Vinci: Werke
1
León, Luis de: Los nombres de Cristo
1
Le Roman de Guiron le Courtois
1
Le Roman de Tristan [Ü: Luces de Gast]
1
Lessing, Gotthold Ephraim: Berengarius Turonensis
1
Lessing, Gotthold Ephraim: Briefe, die neueste Literatur betreffend
1
Lessing, Gotthold Ephraim: Eine Parabel
1
Lessing, Gotthold Ephraim: Nathan der Weise [Ü: Rudolf Erich Raspe]
1
Lessing, Gotthold Ephraim: Sämtliche Schriften
1
Lessing, Gotthold Ephraim: Trauerspiele
1
Lessing, Gotthold Ephraim: Vermischte Schriften
1
Letronne, Antoine Jean: Inscriptions Grecques et Latines du Colose de Memnon restituées et expliquées par M. Letronne [...]
1
Letronne, Antoine Jean: La Statue vocale de Memnon considerée dans ses rapports avec lʼÉgypte et la Grèce
1
Letronne, Antoine Jean: Lettres dʼun antiquaire à un artiste sur lʼemploi de la peinture historique murale [...] chez les Grecs et Romains
3
Letronne, Antoine Jean: Observations critiques et archéologiques sur lʼobject des représentations zodicales qui nous restent de lʼantiquité
1
Letronne, Antoine Jean: Sur lʼorigine Grecque des Zodiaques prétendues égyptiens
12
Lettres de Mirabeau à Chamfort
2
Levezow, Konrad: Jupiter Imperator in einer antiken Bronze des Koeniglichen Museums der Alterthuemer zu Berlin
1
Levoldus, de Northof: Chronik der Grafen von der Mark und der Erzbischöfe von Cöln
1
Lewis, Matthew G.: Der Mönch [Ü: Friedrich von Oertel]
1
Leyden, John: Werke
1
Lichtenberg, Georg Christoph: Vermischte Schriften
10
Lichtwer, Magnus Gottfried: Vier Bücher aesopischer Fabeln in gebundener Schreib-Art
1
Lines written on the death of Lieutenant Schlegel
1
Link, Heinrich Friedrich: Die Urwelt und das Alterthum, erläutert durch die Naturkunde
1
Lips, Johann Heinrich: Bildnis von Johann Wolfgang von Goethe
1
Livius, Titus: Histoire romaine [Ü: François Guérin]
2
Livius, Titus: Histoire romaine [Ü: Jean B. Dureau de La Malle]
1
Lloyd, William; Gerard, Alexander: Narrative of a Journey from Caunpoor to the Boorendo Pass in the Himalaya Mountains [...]
1
Lochner, Stephan: Altarbild für die Ratskapelle in Köln
1
Loeben, Otto Heinrich von: Arkadien
1
Loménie, Louis de: Galerie des contemporains illustres
4
Lowe, S. M. (Hg.): Bildnisse jetzt lebender Berliner Gelehrten mit ihren Selbstbiographien
2
Lucchesini, Cesare: Della illustrazione delle lingue antiche e moderne
1
Lucretius Carus, Titus: Von der Natur der Dinge [Ü: Karl Ludwig von Knebel]
7
Lucretius, Carus Titus: Werke [Ü: Johann Heinrich Friedrich Meinecke]
1
Luden, Heinrich: Grundzüge ästhetischer Vorlesungen zum akademischen Gebrauche
1
Lumsden, Matthew: A Grammar of the Persian Language
1
Luther, Martin: Der kleine Catechismus Lutheri oder die fünf Hauptstücke der Christlichen Lehre
1
GND
Luther, Martin: Schriften
3
Lütkemüller, Samuel Christian: Proben einer neuen Übersetzung des Orlando furioso in reimfreien jambischen Stanzen
1
Lyra, Julius Wilhelm: Des Manuischen von Brigus verkündeten Gesetzbuches, erste Lection, die Schöpfungsurkunde der Brâhmanen enthaltend
1
Lyttelton, George, Lord: To the Reverend Dr. Ayscough, at Oxford
1
Mabillon, Jean: Vetera Analecta
1
Machiavelli, Niccolò: Das Buch vom Fürsten [Ü: August Wilhelm Rehberg]
2
Machiavelli, Niccolò: Ritratti delle cose della Alamagna
1
Magelone. In: Buch der Liebe (1578 u. 1587)
1
Māgha: The Śiśupála badha, or Death of Śiśupála
1
Mai, Angelo (Hg.): Dionysii Halicarnassensis opera omnia
1
Mai, Angelo (Hg.): Eusebii Caesariensis et Samuelis Aniensis Chronica
2
Mai, Angelo (Hg.): Iliadis fragmenta et picturae. Item Didymi Alexandrini marmorum et lignorum mensurae
2
Mai, Angelo (Hg.): Itinerarium Alexandri Magni
1
Mai, Angelo (Hg.): Julii Valerii res gestae Alexandri Macedonis translatae ex Aesopo Graeco ed. A.M.
6
Mai, Angelo (Hg.): M. Cornelii Frontonis et M. Aurelii imperatoris Epistulae. L. Veri et Antonini Piiet Appiani Epistularum reliquiae. Fragmenta Frontonis et scripta grammatica
1
Mai, Angelo (Hg.): M. Tulli Ciceronis De Republica quae supersunt
1
Mai, Angelo (Hg.): Philonis Judaei de Cophini festo et de colendis parentibus cum brevi scripto de Jona
1
Mai, Angelo: Werke
1
Maimon, Salomon: Die Horen (Rezension)
1
Maimon, Salomon: Salomon Maimons Lebensgeschichte von ihm selbst geschrieben
1
Maimon, Salomon: Versuch über die Transzendentalphilosophie
1
Majer, Friedrich: Allgemeine Geschichte des Faustrechts in Deutschland
1
Malherbe, François de: A la Rheine, Mère du roi, pendant sa régence
1
Mallet, Paul Henri: Histoire des Suisses ou Helvétiens
1
Malte-Brun, Conrad: Précis de géographie universelle
1
Manso, Johann Caspar Friedrich; Schubert, Johann David: Die Kunst zu lieben
1
Manso, Johann Caspar Friedrich: Über die Verleumdung der Wissenschaften
1
Manuel, Louis: Le Poëte
2
Manzoni, Alessandro: Opere poetiche
1
Marcellinus, Ammianus: Res gestae
2
Marcus, Adalbert Friedrich: Lob der Cranioscopie
1
Marin, Joseph Charles: Portrait von Jacques Necker
1
Mariscotti, Agesilao: De personis, et larvis
1
Marsden, William: Numismata orientalia illustrata
1
Marshman, Joshua: Elements of Chinese Grammar with a preliminary dissertation on the Characters and the Colloquial Medium of the Chinese and an Appendix Containing the Ta-Hyoh of Confucius with a Translation
1
Martínez de la Rosa, Francisco: Ovras literarias
1
Martínez de Pasqually: Schriften
1
Martin (von Cochem): Auserlesenes History-Buch
5
Martius, Carl Friedrich Philipp von: Palmarum familia ejusque genera denuo illustrata
1
Massot, Firmin: Portraitzeichnung der Anne Louise Germaine de Staël-Holstein
11
Matthiae, August: Ausführliche griechische Grammatik
2
Matthisson, Friedrich von: Alins Abenteuer
1
Matthisson, Friedrich von: Der Genfersee
1
Matthisson, Friedrich von: Gedichte
4
Matthisson, Friedrich von (Hg.): Lyrische Anthologie
1
Matthisson, Friedrich von: Schriften
1
Maugin, Jean: Nouveau Tristan
1
Maurer, Georg Philipp: (Übersetzungen ins Englische)
1
Maurice, Thomas: Indian Antiquities
1
Maxima Bibliotheca Veterum Patrum
2
Mazzocchi, Domenico: Veji defensi
1
Mazzoni, Jacopo: Difesa della Commedia di Dante
1
Mazzoni, Jacopo: Discorso in Difesa di Dante
1
McKerrell, John: A grammar of the Carnataka language
5
Meinhard, Johann Nicolaus: Versuch über den Charakter und die Werke der besten Italienischen Dichter
1
Meinhold, Johannes Wilhelm: Werke
1
Meister, Christian Georg Ludwig: Nicht bloß für diese Unterwelt
1
Mellish, Joseph Charles: Übersetzungen
1
Melusine. In: Buch der Liebe (1578 u. 1587)
1
Mémoirs de l’Académie Royale des Sciences, Art et Belles Lettres
1
Ménage, Gilles: Dictionnaire étymologique
1
Mendelssohn, Henriette: Vertonung von August Wilhelm von Schlegel: Lob der Thränen („Laue Lüfte“)
3
Menn, Karl Franz Georg: Rhenani, Meletematum historicum praemiis regiis ornatorum duplex I
3
Menn, Karl Franz Georg: Rhenani, Meletematum historicum praemiis regiis ornatorum duplex II
3
Mercier, Louis-Sébastien: Der Essighändler
1
Mereau, Sophie: Briefe der Ninon de Lenclos
1
Mereau, Sophie: Das Blüthenalter der Empfindung
2
Mereau, Sophie: Gedichte
1
Mereau, Sophie: Kalathiskos
3
Merian, Andreas von: Synglosse oder Grundsätze der Sprachforschung
1
Merian, Johann Bernhard: Dante
1
Merkel, Garlieb Helwig: Briefe an ein Frauenzimmer über die neuesten Produkte der schönen Literatur in Deutschland II
1
Merkel, Garlieb Helwig: Briefe an ein Frauenzimmer über die neuesten Produkte der schönen Litteratur in Deutschland
4
Merkel, Garlieb Helwig: Schlegel, August Wilhelm von: Gedichte (Rezension)
1
Merkur-Kopf
1
Meyendorff, Georg von: Voyage dʼOrenbourg à Boukhara fait en 1820
1
Meyer, Frau: (Gemälde)
1
Meyer, Friedrich Johann Lorenz: Skizzen zu einem Gemählde von Hamburg
1
Meyer, Friedrich Ludwig Wilhelm: Die Boten
1
Meyer, Heinirch; Goethe, Johann Wolfgang von: Über den Hochschnitt
1
Meyer, Heinrich: Fiorillo, Johann Dominik: Geschichte der zeichnenden Künste von ihrer Wiederauflebung bis auf die neuesten Zeiten (Rezension)
2
Meyer, Heinrich: Oedipus, das Räthsel der Sphinx auflösend
1
Meyer, Heinrich: Raffaels Werke, besonders im Vatikan
1
Meyer, Heinrich: Über die Gegenstände der bildenden Kunst
1
Meyer, Heinrich: Über Majolica-Gefäße
1
Meyer, Heinrich (Weimarer Kunst Freunde): Strixner, Johann Nepomuk: Albrecht Dürers christlich mythologische Handzeichnungen (Rezension)
2
Meyer, Johann Friedrich von: Tobias
3
Michaud, Louis-Gabriel (Hg.): Biographie universelle, ancienne et moderne, ou Histoire, par ordre alphabétique, de la vie publique et privée de tous les hommes
3
Middleton, Conyers: The History of the Life of M. Tullius Cicero
1
Mihanović, Antun: Ueber die Verwandtschaft der slovenischen Sprache mit der Sanskrit
1
Millin, Aubin L.: Introduction à lʼétude de monumens antiques
1
Millin, Aubin L.: Introduction à lʼétude de pierres gravées
1
Millot, Claude François Xavier: Histoire littéraire des troubadours
2
Mīmāṃsā
1
Minutoli, Johann Heinrich Carl von (Hg.): Correspondance de Frédéric II avec le Comte Algarotti
3
Minutoli, Johann Heinrich Carl von: Notiz über einige Kunstprodukte aus dem hohen Alterthume, die man im Norden, theils in Grabhügeln, theils in loser Erde aufzufinden pflegt [...]
1
Mionnet, Théodore Edme: Description des médailles antiques, grecques et romaines
3
Mīr Ḫwānd: Historia Seldschukidarum
1
Mitford, William: History of Greece
9
Mnioch, Johann Jakob: Analekten
1
Mnioch, Johann Jakob: Die Vermählung
2
Mnioch, Johann Jakob: Hellenik und Romantik
6
Moelmann, Konstantin: Gedichte des blinden Constantin Möllmann [Konstantin Moelmann] in Dinslaken (bei Wesel)
1
Moerckens, Michael: Cartusiensis Conatus ad catalogum episcoporum, archiepiscoporum, archicancellariorum et electorum Coloniae Claudinae Augustae Agrippinensium
2
Mogge Muilman, Willem Ferdinand: Num separatio tori et mensae tollat communionem bonorum inter coniuges
1
Molière: Werke
2
Moltke, Adam Gottlob Detlef von: Gedichte
3
Moltke, Adam Gottlob Detlef von: (Sonette)
1
Mone, Franz Joseph: Reinardus vulpes
1
Montemayor, Jorge de: Segundo Cancionero spiritual
1
Montesquieu, Charles Louis de Secondat de: Considérations sur les causes de la grandeur des Romains et de leur décadence
1
GND
Monti, Vincenzo: Del cavallo alato dʼArsine
3
Monti, Vincenzo: Il bardo della selva nera
1
Monti, Vincenzo: Prolusioni agli studj dellʼuniversità di Pavia per lʼanno 1804
2
Moor, Edward: Hindu Infanticide
1
Moor, Edward: Oriental Fragments
1
Moor, Edward: The Hindu Pantheon
1
Mora, José Joaquín de: Gedichte
1
Morellet, André: Mémoires inédits sur le XVIIIe siècle et sur la révolution
1
Moreto, Agustín: Comedias
2
Moritz, Karl Philipp: Anthusa oder Roms Alterthümer
7
Moritz, Karl Philipp: Deutsche Sprachlehre
2
Moritz, Karl Philipp: Versuch einer deutschen Prosodie
2
Möser, Justus: Patriotische Phantasien
2
Mozart, Wolfgang Amadeus: Der Stein der Weisen oder Die Zauberinsel [L: Emanuel Schikaneder]
1
Müller, Adam Heinrich: Die Elemente der Staatskunst
3
Müller, Adam Heinrich: Dresdener Vorlesungen über dramatische Poesie
1
Müller, Adam Heinrich: Über das Verhältniß der Redekunst zur Poesie
1
Müller, Adam Heinrich: Ueber König Friedrich II und die Natur, Würde und Bestimmung der Preussischen Monarchie
1
Müller, Adam Heinrich: Vermischte Schriften über Staat, Philosophie und Kunst
1
Müller, Adam Heinrich: Vorlesungen über die deutsche Wissenschaft und Literatur
4
Müller, Adam Heinrich: Zwölf Vorlesungen über die Beredsamkeit und deren Verfall in Deutschland
2
Müller, Adam: Über den schriftstellerischen Charakter der Frau von Stael-Holstein
1
Müller, Christoph Heinrich: Samlung deutscher Gedichte aus dem XII., XIII. und XIV. Jahrhundert
16
Müller, Friedrich August: Alfonso
1
Müller, Friedrich August: Richard Löwenherz
1
Müller, Friedrich Max: Hitopadeśa
1
Müller, Friedrich: Schreiben von Friedrich Müller, Königlich Bayrischen Hofmahler, über eine Reise aus Liefland nach Neapel und Rom von August von Kotzebue
1
Müller, Friedrich: Werke
1
Müller, Johannes von: Anmerkungen zur Schweizer Geschichte
1
Müller, Johannes von: Attila, der Held des fünften Jahrhunderts
1
Müller, Johannes von: Betrachtungen über Herrn Necker
2
Müller, Johannes von: Darstellung des Fürstenbundes
1
Müller, Johannes von: De la gloire de Frédéric
1
Müller, Johannes von: Der Geschichten schweizerischer Eidgenossenschaft Vierter Theil
2
Müller, Johannes von: Die Geschichten der Schweizer
2
Müller, Johannes von: Die Geschichten schweizerischer Eidgenossenschaft
4
Müller, Johannes von: Friedrichs Ruhm [Ü: Johann Wolfgang von Goethe]
1
Müller, Johannes von: Histoire des Suisses
1
Müller, Johannes von: Müller, Christoph Heinrich: Samlung deutscher Gedichte aus dem XII., XIII. und XIV. Jahrhundert (Rezension)
1
Müller, Johannes von: Reisen der Päpste
1
Müller, Johannes von: Sämmtliche Werke
4
Müller, Johannes von: Schlegel, Friedrich von: Über die Sprache und Weisheit der Indier. 1808 (Rezension)
2
Müller, Johannes von: Über den Untergang der Freiheit alter Völker
1
Müller, Johannes von: Vier und zwanzig Bücher allgemeiner Geschichten
3
Müller, Johann Georg: Ankündigung der Herausgabe der sämmtlichen Werke Johannes von Müller (1809)
1
Müller, Karl Otfried: Die Etrusker
2
Müller, Nikolaus: Glauben, Wissen und Kunst der alten Hindus
1
Müllner, Amandus Gottfried Adolf: Die Schuld
1
Munday, Anthony; Drayton, Michael et al.: Sir John Oldcastle (zeitweilig William Shakespeare zugeschrieben)
3
GND
Münster, Ernst zu: Mémoire
1
Münster, Ernst zu: Observations sur le traité de Breslau
1
Muratori, Lodovico Antonio: Rerum Italicarum scriptores praecipui
1
Mustoxydēs, Andreas: Sui quattro cavalli
7
Naeke, August Ferdinand: Callimachi Hecale
1
Naeke, August Ferdinand: Choerili Samii quae supersunt collegit et illustravit, de Choerili Samii aetate, vita et poesi aliisque Choerilis
1
Naeke, August Ferdinand: (Fünfter September sey genannt...)
1
Naeke, August Ferdinand: Opuscula philologica
2
Naeke, August Ferdinand: Schedas criticas
1
Naeke, August Ferdinand: Vorlesungen
1
Nägeli, Hans Georg: Werke
1
Nahl, Johann August: Achill auf Scyros
2
Nalus
5
Nardini, Famiano: Roma antica
2
Necker, Albertine Adrienne: Notice sur le caractère et les écrits de Mme de Staël
19
Necker, Albertine Adrienne: Réflexions sur le divorce
2
Necker, Albertine Adrienne; Staël-Holstein, Auguste Louis de: Avertissement [Ü: Albertine Adrienne Necker]
2
Necker, Albertine Adrienne; Staël-Holstein, Auguste Louis de: Préface [Ü: Albertine Adrienne Necker]
2
Necker, Albertine Adrienne: Über den Charakter und die Schriften der Frau von Staël [Ü: August Wilhelm von Schlegel]
13
Necker, Albertine Adrienne: Werke
1
Necker, Jacques: Œuvres complètes, publiées par Auguste Louis de Staël-Holstein
15
Neckers Charakter und Privatleben nebst seinen nachgelassenen Handschriften [Ü: U. L. Gust. S. Kleffel]
1
Neer, Aert van der: (Mondscheinlandschaft)
1
Neubeck, Valerius: (Hymne auf die Nymfe des Selterbrunnens)
1
Neubeck, Valerius Wilhelm: Die Gesundbrunnen
20
Neubeck, Valerius Wilhelm: Werke
1
Nève, Félix: Études sur les hymnes du Rig-Veda, avec un choix d’hymnes traduits pour la première fois en français
1
Nibelungenlied. In: Hohenems-Münchener Handschrift A
4
Nichols, John (Hg.): Six Old Plays on which Shakespeare founded his King Lear [...]
2
Nicolai, Friedrich: Anhang zu Friedrich Schillers Musen-Almanach für das Jahr 1797
2
Nicolai, Friedrich: Leben und Meinungen Sempronius Gundibert’s, eines deutschen Philosophen
1
Nicolai, Friedrich: Ueber die Art wie vermittelst des transcendentalen Idealismus ein wirklich existirendes Wesen aus Prinzipien konstruirt werden kann
3
Nicolai, Friedrich: Vertraute Briefe von Adelheid B. an Ihre Freundin Julie S.
2
Nicolay, Ludwig Heinrich von: Morganens Grotte
1
Nicolay, Ludwig Heinrich von: Reinhold und Angelika, eine Rittergeschichte in zwölf Gesängen nach Bojardo
1
Niebuhr, Barthold Georg (Hg.): M. Cornelii Frontonis Reliquiae
1
Niebuhr, Barthold Georg: Histoire romaine [Ü: Marie Philippe Aimé de Golbery]
1
Niebuhr, Barthold Georg: Historische und philologische Vorträge an der Universität Bonn gehalten
1
Niebuhr, Barthold Georg: Römische Geschichte
26
Niebuhr, Georg Barthold: The Roman History
1
Niemeyer, August Hermann: Philotas
1
Niemeyer, Christian: Chrimhild und Siegfried
1
Niethammer, Friedrich Immanuel: Der Streit des Philanthropinismus und Humanismus in der Theorie des Erziehungs-Unterrichts unsrer Zeit
1
Nordische Heldenromane [Ü: Friedrich Heinrich von der Hagen]
2
Novalis: An Herrn Schlegel
2
Novalis: An Tieck
4
Novalis: (Auch ich bin in Arkadien gebohren)
2
Novalis: Bergmanns-Leben
7
Novalis: (Freudigstaunend ehrt der Priester)
2
Novalis: Klagen eines Jünglings
1
Novalis: Lob des Weins
7
Novalis: Logologische Fragmente
1
Novalis: (Oft schon hört ich, wenn im Dichterlande)
2
Novalis: Schriften
16
Novalis: Schriften. 1. Aufl.
1
Novalis: Schriften. 2. Aufl.
3
Novalis: Schriften. Zweiter Theil. 2. Aufl.
1
Novalis: Werke
1
Novalis: (Zarte Schwingungen umbeben leise)
2
Nyerup, Rasmus: Symbolae ad litteraturam Teutonicam antiquiorem
2
Oberlin, Jeremias Jacob (Hg.): Bonerii Gemma
1
Oberlin, Jeremias Jacob (hg.): Diatribe de Conrado Herbipolita, vulgo Meister Kuonze von Würzburg
1
Oberlin, Jeremias Jacob (Hg.): Diss. de poetis Alsaticis eroticis medii aevi
1
Octavian. In: Buch der Liebe (1578 u. 1587)
2
Oehlenschläger, Adam Gottlob: Aladdin oder die Wunderlampe
2
Oehlenschläger, Adam Gottlob: Axel og Valborg
2
Oehlenschläger, Adam Gottlob: Correggio
1
Oehlenschläger, Adam Gottlob: Palnatoke
3
Oehlenschläger, Adam Gottlob: Werke
2
Oelrichs, Johann Georg Arnold: Commentarii de scriptoribus ecclesiae Latinae priorum VI saeculorum
1
Oelrichs, Johann Georg Arnold: Commentatio de doctrina Platonis de Deo
1
Oemler, Christian Wilhelm: Schiller
1
Oken, Lorenz: Abriß des Systems der Biologie
1
Oken, Lorenz: Vorlesungen
1
Oña, Pedro de: El Arauco domado
1
Opitz, Martin: Gedichte
1
Opitz von Boberfeld, Martin: Gedichte
1
Orphica [Ü: Joseph Juste Scaliger]
1
Orsini, Herr: (De sapientia et regiminibus potestatis)
4
Ortografía de la lengua castellana, compuesta por la Real academia española
1
Ostfriedenlied (O milder Gott, in deinem Reich)
1
Otto, von Botenlauben: Minnelieder
2
Pagi, Antoine:Critica Historico-Chronologica In Universos Annales Ecclesiasticos
1
Paisiello, Giovanni: Die schöne Müllerin
1
Palmblad, Vilhelm Fredrik: Om Hinduernas Fornhäfder
2
Palmerín de Oliva
1
Pander, Christian Heinrich; Alton, Eduard dʼ: Die Skelete der Pachydermata
2
Pāṇini: Aphorismen
1
Pantaleon, Heinrich: Teutscher Nation Heldenbuch
1
Papon, Jean Pierre: Voyage de Provence, suivi de quelques lettres sur les troubadours
1
Parcival. In: Christoph Heinrich Müller: Samlung deutscher Gedichte aus dem XII., XIII. und XIV. Jahrhundert. Erster Band
1
Parny, Évariste: La Guerre des Dieux anciens et modernes
6
Passavant, Johann David: Skizzen
1
Passow, Franz: Handwörterbuch der griechischen Sprache
2
Paulus, Heinrich Eberhard Gottlob (Hg.): Lebens- und Todeskunden über Johann Heinrich Voß
1
Pauw, Johannes Cornelis de: Aeschyli Tragoediae
1
Percy, Thomas: The Reliques of Ancient English Poetry
4
Pérez de Hita, Ginés: Historia de las guerras civiles den Granada
1
Peringskiöld, Johan (Hg.): Niftunga Saga
4
Peringskiöld, Johan (Hg.): Wilkina Saga
11
Petrarca, Francesco: Ahndung von Laura’s Tode [Ü: August Wilhelm von Schlegel]
2
Petrarca, Francesco: (Die Nachtigall, die wohl so holde Klagen) [Ü: Johann Diederich Gries]
1
Petrarca, Francesco: Die selige Zeit [Ü: August Wilhelm von Schlegel]
2
Petrarca, Francesco: (Ihr, die ihr hört in manch zerstreuter Zeile) [Ü: August Wilhelm von Schlegel]
1
Petrarca, Francesco: (Je minder ich vom letzten Tag geschieden) [Ü: Caroline von Schelling]
1
Petrarca, Francesco: Quandʼio veggio dal ciel scender lʼAurora
1
Petrarca, Francesco: (Sonett)
2
Petrarca, Francesco: Sonette [Ü: August Wilhelm von Schlegel]
8
Petrarca, Francesco: Sonette [Ü: August Wilhelm von Schlegel]
5
Petrarca, Francesco: Sonette [Ü: Johann Diederich Gries]
1
Petrarca, Francesco: So war sie [Ü: August Wilhelm von Schlegel]
2
Petrarca, Francesco: (Wär ich aus jener Grotte nie entronnen) [Ü: Johann Diederich Gries]
2
Petrus, Alfonsi: Disciplina clericalis
1
Peyssonnel, Charles de: Observations historiques et géographiques
1
Pez, Hieronymus (Hg.): Scriptores rerum Austriacarum
1
Pferde von San Marco, Plastik
1
Philelphus, Johannes Marius: Amyris
1
Pichler, Caroline: Agathokles
2
Pichler, Caroline: Gedicht
1
Pico della Mirandola, Giovanni: Conclusiones Nongentae
1
Pigault-Lebrun: Der kleine Matrose
1
Pius VII., Papst: Quum Memoranda
2
Planck, Gottlieb Jakob: Geschichte der Bildung, der Schicksale, und der Befestigung der protestantischen Kirche vom Anfang der Reformation bis zu dem Religions-Frieden vom J. 1555
1
Platen, August von: Der romantische Ödipus
2
Platen, August von: Die verhängnisvolle Gabel
1
Plate, Wilhelm: Lorentino von Medici
1
Plato: Dialogi [Ü: Ludwig Friedrich Heindorf]
5
Plato: Phaidros [Ü: Friedrich Schleiermacher]
5
Plato: Platons Republik oder Republik vom Gerechten [Ü: Friedrich Karl Wolff]
3
Plato: Platons Republik [Ü: Gottfried Fähse]
2
Plato: Werke [Ü: Friedrich Schleiermacher]
19
Plato: Werke [Ü: Friedrich Schleiermacher] Ersten Theiles zweiter Band
1
Plato: Werke [Ü: Friedrich Schleiermacher] Zweiten Theiles erster Band
2
Plato: Werke [Ü: Friedrich Schleiermacher] Zweiten Theiles zweiter Band
1
Plautus, Titus Maccius: Comoediae cum selectis variorum notis et novis commentariis, curante J. Naudet
1
Pleimes, Anton Josef: (Preisschrift)
2
Plutarchus: Chaeronensis quae supersunt omnia
4
Poésies de Marguerite-Eleonore Clotilde de Vallon-Challys, depuis, Madame de Surville, poete françois de XVe siecle
1
Poley, Ludwig: Werke
1
Polo, Gaspar Gil: Diana enamorada
1
Pope, Alexander: Eloisa to Abelard
2
Porter, Robert Ker: Travels in Georgia, Persia, Armenia, ancient Babylonia, &c. &c. during the years 1817, 1818, 1819, and 1820
1
(Portraitzeichnung von August Wilhelm von Schlegel)
7
Potocki, Jan: Fragments historiques et géographiques sur la Scythie, la Sarmatie et les Slaves
2
Praxiteles: Satyre au repos
2
Pray, Georg: Annales veteres Hunnorum, Avarum et Hungarorum ab anno ante natum Christum CCX ad annum Christi CMXCVII
1
GND
Pray, Georg: Vita S. Elisabethae
1
Prichard, James Cowles: Analysis of Egyptian Mythology
9
Prichard, James Cowles: Darstellung der Aegyptischen Mythologie verbunden mit einer kritischen Untersuchung der Überbleibsel der ägyptischen Chronologie [Ü: L. Haymann]
11
Prichard, James Cowles: Researches into the physical history of Mankind
1
Primaleon. Libro segundo de Palmerin
3
Procopius, Caesariensis: Kriegsgeschichte
1
Prometheus [Ü: Heinrich Voß]
1
Propertius, Sextus: Elegien [Ü: Johann Kaspar Friedrich Manso]
1
Propertius, Sextus: Elegien [Ü: Karl Ludwig von Knebel]
6
Prospectus der großen kritischen Ausgabe des Ramayana
6
Pseudo-Callisthenes: Historia Alexandri Magni
2
Pückler-Muskau, Hermann von: The Travels of a German Prince in England [Ü: Sarah Austin]
1
Puškin, Aleksandr S.: Boris Godunow [Ü: Karl Gregor von Knorring]
1
Püterich von Reichertshausen, Jakob: Ehrenbrief
1
Pütter, Johann Stephan: An Historical Development of the Present Political Constitution of the Germanic Empire [Ü: Josiah Dornford]
1
Pütter, Johann Stephan: Historische Entwickelung der heutigen Staatsverfassung des Deutschen Reichs
1
Pütter, Johann Stephan: Versuch einer academischen Gelehrtengeschichte von der Georg-Augustus-Universität zu Göttingen
1
Quintilianus, Marcus Fabius: Institutionis oratoriae
1
Rabbe, Alphonse; Vieilh de Boisjolin, Claude-Augustin; Sainte-Preuve, François Georges de (Hg.): Biographie universelle et portative des contemporains, ou Dictionnaire historique des hommes vivants et des hommes morts, depuis 1788 jusqu'à nos jours
4
Racine, Jean: Bajazet [Ü: Friedrich von Schlegel] (Teilübersetzung)
1
Râdjataranginî [Ü: Anthony Troyer]
1
Raffaello, Sanzio: Die schöne Gärtnerin
1
Raffaello, Sanzio: Madonna della Seggiola
1
Raffles, Sophia: Memoire of the Life and Public Services of Sir Thomas Stamford Raffles, F.R.S. &c.
1
Raffles, Thomas Stamford: The History of Java
2
Rambach, Friedrich Eberhard: Die Kuhpocken
1
Rambach, Friedrich Eberhard: Shakespeare, William: Dramatische Werke. Erster Theil. Ü: August Wilhelm von Schlegel (1797) (Rezension)
1
Ramdohr, Friedrich Wilhelm Basilius von: Venus Urania
4
Ramler, Karl Wilhelm: Ino
1
Ramler, Karl Wilhelm: Lyrische Gedichte
1
Rask, Rasmus Kristian: (Friesische/Isländische? Sprachlehre)
1
Rask, Rasmus: Om Zendsprogets og Zendavestas Ælde og Ægthed
1
Rauch, Christian Daniel: Denkmal für General Gebhard Leberecht von Blücher
1
Rauch, Christian Daniel: Grabmal der Königin Luise von Preußen
1
Rauch, Christian Daniel: Werke
1
Raumer, Friedrich von: Über die Poetik des Aristoteles und sein Verhältniss zu den neuern Dramatikern
1
Raumer, Friedrich von: Vortrag zur Gedächtnisfeier König Friedrich Wilhelms III, gehalten am 3. August 1843 in der Universität zu Berlin
1
Raumer, Friedrich von: Werke
1
Raynouard, François-Just-Marie: Choix des poésies originales des Troubadours
13
Raynouard, François-Just-Marie: Ciampi, Sebastiano: De usu linguæ Italicæ saltem a sæculo quinto r. s. Acroasis (Rezension)
1
Raynouard, François-Just-Marie: Éléments de la Grammaire de la langue romane avant l’an 1000, précédés des recherches sur l’origine et la formation de cette langue
1
Raynouard, François-Just-Marie: Grammaire de la langue des Troubadours
2
Raynouard, François-Just-Marie: Werke
2
Rees, Abraham (Hg.): The Cyclopædia, or Universal Dictionary of Arts, Sciences, and Literature
1
Rehberg, August Wilhelm: Constitutionelle Phantasien eines alten Steuermannes im Sturme des Jahres 1832
1
Rehberg, August Wilhelm: Prüfung der Erziehungskunst
3
Rehberg, August Wilhelm: Über den Code Napoleon und dessen Einführung in Deutschland
1
Rehberg, August Wilhelm: Über die Staatsverwaltung deutscher Länder und die Dienerschaft des Regenten
2
Rehfues, Philipp Joseph von: Colombo
2
Rehfues, Philipp Joseph von: La Frontière du Rhin
4
Rehfues, Philipp Joseph von: LʼEspagne en mil huit cent huit [Ü: François Guizot]
1
Rehfues, Philipp Joseph von: (Mémoire)
2
Rehfues, Philipp Joseph von: Scipio Cicala
3
Rehfues, Philipp Joseph von: Spanien nach eigener Ansicht im Jahre 1808 und nach unbekannten Quellen bis auf die neueste Zeit
1
Rehfues, Philipp Joseph von: Über Vermögen und Sicherheit des Besitzes, Gespräche zwischen dem Beamten, dem Freiherrn und dem Kaufmann
1
Reichardt, Johann Friederich: Bürger, Gottfried August: Lenore (Vertonung)
1
Reichardt, Johann Friedrich: Bradamante (von Heinrich Joseph von Collin)
1
Reichardt, Johann Friedrich: Briefe eines aufmerksamen Reisenden die Musik betreffend
1
Reichardt, Johann Friedrich: Goethes Erwin und Elmire
6
Reichardt, Johann Friedrich: Vertonung eines Liedes aus: Shakespeare, William: Dramatische Werke. Erster Theil [Ü: August Wilhelm von Schlegel]
3
Reinbeck, Georg: Wallstein (Rezension)
2
Reinhard, Karl: An –
1
Reinhard, Karl: An Malwina, nach der Trennung
1
Reinhold, Karl Leonhard: Beyträge zur Berichtigung bisheriger Missverständnisse der Philosophen
1
Reinhold, Karl Leonhard: Der Geist des Zeitalters als Geist der Filosofie
1
Reinhold, Karl Leonhard: Schelling, Friedrich Wilhelm Joseph von: System des transcendentalen Idealismus (Rezension)
1
Reiske, Johann Jacob: Oratores graeci
1
Reiske, Johann Jacob: Plutarchus: Quae supersunt, omnia
1
Rémusat, Abel: Eléments de la grammaire chinoise ou principes généraux du Kou-Wen, ou style antique, et du Kouan-Hoa, c’est-à-dire de la langue commune généralement usitée dans l’empire chinois
8
Rémusat, Abel: Mélanges Asiatiques, ou Choix de morceaux de critique, et de mémoires relatifs aux religions, aux. sciences, à lʼhistoire, et à la géographie des nations orientales
3
Rémusat, Abel: Mémoires sur les relations politiques des princes chrétiens, et particulièrement des rois de France avec les empereurs mongols
1
Rémusat, Abel: Mémoire sur la vie et les opinions de Lao-Tseu
1
Rémusat, Abel: Mémoire sur les livres chinois de la bibliothèque du roi, et sur le plan du nouveau catalogue
1
Rémusat, Abel: Nouveaux mélanges asiatiques, ou Recueil de morceaux de critique et de mémoires relatifs aux religions, aux sciences, aux coutumes, à l'histoire et à la géographie des nations orientales
1
Rémusat, Abel: Recherches sur les langues tartares ou mémoires sur différents points de la grammaire et de la littérature des Mandchous, des Mongols, des Onigoours et des Tibétains
4
Rémusat, Abel: Sur un vocabulaire philosophique en cinq langues, imprimé à Peking
2
Rendorp, Joachim: Geheime Nachrichten zur Aufklärung der Vorfälle während des letzten Krieges zwischen England und Holland. Bd. 2.[Ü: August Wilhelm von Schlegel]
4
Rendorp, Joachim: Geheime Nachrichten zur Aufklärung der Vorfälle während des letzten Krieges zwischen England und Holland [Ü: August Wilhelm von Schlegel]
13
Rendorp, Joachim: Memoriën, dienende tot opheldering, van het gebeurde, geduurende den laatsten Engelschen Oorlogs
2
Rezension von: Schlegel, August Wilhelm von: Rom
1
Rhode, Johann Gottlieb: Über den Anfang unserer Geschichte und die letzte Revolution der Erde
3
Richardson, David Lester: Literary Leaves
1
Riemer, Friedrich Wilhelm: Griechisch-Deutsches Wörterbuch für Anfänger und Freunde der griechischen Sprache
1
Riepenhausen, Franz; Riepenhausen, Johannes: Geschichte der Malerei in Italien
9
Riepenhausen, Franz; Riepenhausen Johannes: Leben und Tod der heilgen Genoveva
1
Riepenhausen, Franz; Riepenhausen Johannes: Leben und Tod der heilgen Genoveva (Rezension)
1
Río, Antonio del: Beschreibung einer alten Stadt, die in Guatimala (Neuspanien), unfern Palenque entdeckt worden ist [Ü: Johann Heinrich Carl von Minutoli]
2
Río, Antonio del: Description of the ruins of an ancient city, discovered near Palenque, in the kingdom of Guatemala, in Spanish America
3
Rist, Johann Georg: Helios
1
Ritter, Carl: Die Vorhalle Europäischer Völkergeschichten vor Herodotus, um den Kaukasus und an den Gestaden des Pontus
7
Robert, Ludwig: Die Sylphen
1
Robertson, William: An historical disquisition concerning the knowledge which the ancients had of India
1
Robertson, William: Historische Untersuchung über die Kenntnisse der Alten von Indien, und die Fortschritte des Handels mit diesem Lande vor der Entdeckung des Weges dahin um das Vorgerbirge der guten Hoffnung [Ü: Georg Forster]
1
Rocca, Michel (John): Denkwürdigkeiten über den Feldzug der Franzosen in Spanien
1
Rocca, Michel (John): Mémoires sur la guerre des Français en Espagne
1
Rochette, Désiré Raoul: Notice sur quelques médailles Grecques appartenant à des rois inconnus de la Bactriane et de lʼInde
1
Rochlitz, Friedrich: Blicke in das Gebiet der Künste und der praktischen Philosophie
1
Rochlitz, Friedrich: Charaktere interessanter Menschen in moralischen Erzählungen dargestellt zur Unterhaltung in einsamen ruhigen Stunden
3
Rode, August: Marci Vitruvii Pollionis De architectura libri decem
1
Roederer, Pierre-Louis: Über Buonapartes Zug nach Rom und über die Gemälde und Statuen Italiens
1
Rohden, Johann Martin von: Landschaft
1
Rohr, Leopold von: Schlegel, August Wilhelm von; Tieck, Ludwig: Musen-Almanach für das Jahr 1802 (Rezension)
2
Rojas, Fernando de: La Celestina
1
Rollenhagen, Georg: Froschmeuseler
1
Roman d'Artus. Giron de Courtois et Meliadus
1
Roman de Josephe ou du Saint Graal
1
Roman de Merlin
1
Röschlaub, Andreas: (Cousine)
1
Röschlaub, Andreas: (Distichen auf Reinhold)
6
Röschlaub, Andreas: Lehrbuch der Nosologie
1
Röschlaub, Andreas: Magazin zur Vervollkommnung der theoretischen und praktischen Heilkunde
1
Rosen, Friedrich August: Corporis Radicum Sanscritarum prolusio
5
Rosenkranz, Karl: Das Heldenbuch und die Nibelungen
1
Rosenkranz, Karl: Handbuch einer allgemeinen Geschichte der Poesie
1
Rosini, Giovanni: Risposta ad una lettera del cavalier Vincenzo Monti sulla lingua italiana
1
Rossetti, Gabriele: Il tempo, ovvero dio e lʼuomo, salterio
1
Rossetti, Gabriele: Sullo spirito antipapale che produsse la riforma [...]
2
Rostitz, Gottlob Adolf Ernst von: Hebe! sieh in sanfter Feier
1
Rousseau, Jean-Baptiste: Ode à M. le Comte du Luc
1
Rubens, Peter Paul: (Skizzen)
1
Rückert, Friedrich: Ghatakarparam oder das zerbrochene Gefäss: Ein sanskritisches Gedicht (Kālidāsa), herausgegeben, übersetzt, nachgeahmt und erläutert von Georg Martin Dursch (Rezension)
1
Rückert, Friedrich: Oestliche Rosen
1
Ruckstuhl, Karl: Nachgrabungen bei Bonn
1
Rudolphi, Caroline Christiane Louise: Gedichte
1
Rudolphi, Karl Asmund: Gedichte
2
Ruedorffer, Anna von: Werke
1
Ruhnken, David: Historia critica oratorum graecorum
1
Rühs, Friedrich: Edda, nebst einer Einleitung über die nordische Poesie und Mythologie
1
Rühs, Friedrich: Geschichte Schwedens
1
Rumpf, Georg Eberhard: Herbarium Amboinense
2
Ryckius, Theodorus: Dissertatio de primis Italiae colonis et Aeneae adventu
1
Saavedra, Ángel de: Romances históricos
1
Sabran, Elzéar-Louis-Marie de: Werke
1
Sachs, Hans: Heinz Widerporst
1
Sachs, Hans: Werke
3
Sacy, Antoine Isaac Silvestre de: Calila et Dimna
1
Sacy, Antoine Isaac Silvestre de: Grammaire Arabe
2
Sacy, Antoine Isaac Silvestre de: Mémoire dʼHistoire et de Littérature Orientale
3
Sacy, Antoine Isaac Silvestre de: Mémoire sur lʼorigine du recueil de contes intitulé le Mille et Une Nuits
3
Sainte-Croix, Guillaume Emmanuel Joseph de: Examen critique des anciens historiens d'Alexandre le Grand
1
Sainte-Croix, Guillaume Emmanuel Joseph de: Recherches historiques et critiques sur les mystères du paganisme
1
Sainte-Palaye, Jean-Baptiste de LaCurne de: Mémoirs sur l’ancienne chevalerie
1
Saint-Martin, Louis Claude de: De lʻesprit de choses
1
Saint-Martin, Louis Claude de: Des erreurs et de la vérité
1
Saint-Martin, Louis Claude de: Le cimetière d’Amboise
1
Saint-Martin, Louis Claude de: LʼAurore naissante
1
Saint-Martin, Louis Claude de: Œuvres posthumes
9
Saint-Martin, Louis Claude de: Vom Geist und Wesen der Dinge, oder philosophische Blicke auf die Natur der Dinge und des Zwecks ihres Daseyns, wobey der Mensch überall als die Lösung des Räthsels betrachtet wird [Ü: Gotthilf Heinrich von Schubert]
1
Saint-Martin, Louis Claude de: Werke
11
Salieri, Antonio: Tarare
1
Salis-Seewis, Johann Gaudenz von: Frühlingslied
1
Sammlung Asiatischer Original-Schriften (1791)
1
Sammlung griechischer und lateinischer Klassiker (Tauchnitz)
1
Sammlung historisch-berühmter Autographen oder Facsimile's von Handschriften ausgezeichneter Personen alter und neuer Zeit. Stuttgart: Becher 1846
1
Sánchez, Tomás Antonio: Collecion de poesias castelanas anteriores al siglo XV
1
Sandoval, Prudencio de: Historia de la vida y hechos del emperador Carlos V
3
Saumaise, Claude: Plinianae exercitationes in Caii Julii Solini Polyhistora
1
Savary, Claude: Reise nach Griechenland und Bemerkungen über die Türken
1
Savigny, Friedrich Carl von: Geschichte des römischen Rechts im Mittelalter
1
Savigny, Friedrich Carl von: Werke
1
Saʿdī: Persianischer Rosenthal
4
Scaliger, Joseph Juste: Epistolae
1
Schad, Johann Baptist: Reinhold, Carl Leonhard: Beyträge zur Berichtigung bisheriger Missverständnisse der Philosophen (Rezension)
1
Schadow, Gottfried: Büsten
2
Schadow, Gottfried: Büste von Johanna Henriette Rosine Meyer
1
Schadow, Gottfried: Über einige in den Propyläen abgedruckte Sätze, die Ausübung der Kunst in Berlin betreffend
2
Schardius, Simon: Redivivus sive rerum germanicarum scriptores varii
1
Scheffauer, Philipp Jacob: Büste des Johannes Kepler
1
Schelling, Caroline von: (Bericht über die Aufführung des „Ion“ in Weimar)
4
Schelling, Caroline von: Die himmlische Mutter
1
Schelling, Caroline von: (Erzählung) (nicht überliefert)
1
Schelling, Caroline von; Schlegel, August Wilhelm von: Die Gemählde
19
Schelling, Friedrich Wilhelm Joseph von: Abhandlungen zur Erläuterung des Idealismus der Wissenschaftslehre
2
Schelling, Friedrich Wilhelm Joseph von: Allgemeine Deduction des dynamischen Prozesses oder der Categorieen der Physik
2
Schelling, Friedrich Wilhelm Joseph von: Allgemeine Übersicht der neuesten philosophischen Literatur
1
Schelling, Friedrich Wilhelm Joseph von: An das Publicum
1
Schelling, Friedrich Wilhelm Joseph von: An den Herrn Herausgeber, betreffend ein Schreiben über den Ion in N. 41
1
Schelling, Friedrich Wilhelm Joseph von: Briefe über Dogmatismus und Kritizismus
1
Schelling, Friedrich Wilhelm Joseph von: Bruno, oder über das göttliche und natürliche Prinzip der Dinge
15
GND
Schelling, Friedrich Wilhelm Joseph von: Darlegung des wahren Verhältnisses zur verbesserten Fichteʼschen Lehre
2
Schelling, Friedrich Wilhelm Joseph von: Darstellung meines Systems der Philosophie
3
Schelling, Friedrich Wilhelm Joseph von: Denkmal der Schrift von den göttlichen Dingen etc. des Herrn Friedrich Heinrich Jacobi und der ihm in derselben gemachten Beschuldigung [...]
4
Schelling, Friedrich Wilhelm Joseph von: Die letzten Worte des Pfarrers zu Drottning in Seeland
10
Schelling, Friedrich Wilhelm Joseph von: Die Weltalter
7
Schelling, Friedrich Wilhelm Joseph von: Einleitung zu dem Entwurf eines Systems der Naturphilosophie
3
Schelling, Friedrich Wilhelm Joseph von: Epigramme
1
Schelling, Friedrich Wilhelm Joseph von: Epikurisch Glaubensbekenntniß Heinz Widerporstens
2
Schelling, Friedrich Wilhelm Joseph von: Erster Entwurf eines Systems der Naturphilosophie
8
Schelling, Friedrich Wilhelm Joseph von: Fernere Darstellungen aus dem System der Philosophie
2
Schelling, Friedrich Wilhelm Joseph von: Fichte, Johann Gottlieb: Über das Wesen des Gelehrten und seine Erscheinungen im Gebiete der Freiheit (Rezension )
1
Schelling, Friedrich Wilhelm Joseph von: Lied
2
Schelling, Friedrich Wilhelm Joseph von: Loos der Erde
1
Schelling, Friedrich Wilhelm Joseph von: Miscellen
3
Schelling, Friedrich Wilhelm Joseph von: Philosophie und Religion
1
Schelling, Friedrich Wilhelm Joseph von: Philosophische Schriften
3
Schelling, Friedrich Wilhelm Joseph von: Philosophische Untersuchungen über das Wesen der menschlichen Freiheit und die damit zusammenhängenden Gegenstände
7
Schelling, Friedrich Wilhelm Joseph von: Schlegel, August Wilhelm von: Ehrenpforte und Triumphbogen für den Theater-Präsidenten von Kotzebue (Rezension)
2
Schelling, Friedrich Wilhelm Joseph von: System des transcendentalen Idealismus
7
Schelling, Friedrich Wilhelm Joseph von: Thier und Pflanze
1
Schelling, Friedrich Wilhelm Joseph von: Über das Verhältnis der bildenden Künste zur Natur
5
Schelling, Friedrich Wilhelm Joseph von: Über das Verhältnis des Realen und Idealen in der Natur
1
Schelling, Friedrich Wilhelm Joseph von: Über die Jenaische Allgemeine Literatur-Zeitung
6
Schelling, Friedrich Wilhelm Joseph von: Über die wissenschaftlichen Behandlungsarten des Naturrechts
1
Schelling, Friedrich Wilhelm Joseph von: Ueber Dante in philosophischer Beziehung
1
Schelling, Friedrich Wilhelm Joseph von: Ueber das absolute Identitäts-System und sein Verhältniß zu dem neuesten (Reinholdischen) Dualismus
1
Schelling, Friedrich Wilhelm Joseph von: Ueber das Wesen der philosophischen Kritik überhaupt und ihr Verhältniß zum gegenwärtigen Zustand der Philosophie insbesondere
1
Schelling, Friedrich Wilhelm Joseph von: Vorlesungen
2
Schelling, Friedrich Wilhelm Joseph von: Vorlesungen über Ästhetik
3
Schelling, Friedrich Wilhelm Joseph von: Vorlesungen über die Methode des academischen Studium
8
Schelling, Friedrich Wilhelm Joseph von: Werke
1
Scherz, Johann Georg: Glossarium
3
Schiassi, Filippo: De Pateris Antiquorum ex schedis Jacopi Tatii Biancani
1
Schick, Gottlieb: Apoll unter den Hirten
4
Schick, Gottlieb: Christus
1
Schick, Gottlieb: Das Opfer Noahs
3
Schick, Gottlieb: Portrait von Caroline von Humboldt
3
Schick, Gottlieb: Werke
1
Schiller, Friedrich: Allgemeine Sammlung historischer Memoires vom zwölften Jahrhundert bis auf die neuesten Zeiten
1
Schiller, Friedrich: An einen Weltverbesserer
1
Schiller, Friedrich: Beschluß der Abhandlung über naive und sentimentalische Dichter
1
Schiller, Friedrich: Das Höchste
1
Schiller, Friedrich: Der Abschied
1
Schiller, Friedrich: Der Genius
4
Schiller, Friedrich: Der Handschuh
2
Schiller, Friedrich: Der philosophische Egoist
1
Schiller, Friedrich: Deutsche Treue
1
Schiller, Friedrich: Die Antike an einen Wanderer aus Norden
1
Schiller, Friedrich: Die Horen
1
Schiller, Friedrich: Die Kraniche des Ibycus
3
Schiller, Friedrich: Die Ritter von Maltha
1
Schiller, Friedrich: Die sentimentalischen Dichter
5
Schiller, Friedrich: Die Zerstörung von Troja
1
Schiller, Friedrich: Fiesco, or the Genoese Conspiracy [Ü: Georg Heinrich Nöhden, John Stoddart]
1
Schiller, Friedrich: Gedichte
8
Schiller, Friedrich: Ilias
1
Schiller, Friedrich: Klage der Ceres
1
Schiller, Friedrich: Kleinere prosaische Schriften. Vierter Theil
1
Schiller, Friedrich: Lessing, Gotthold Ephraim: Nathan der Weise (Bearbeitung)
1
Schiller, Friedrich: Maria Stuart [Ü: Pierre Antoine Lebrun]
2
Schiller, Friedrich: Matthisson, Friedrich von: Gedichte (Rezension)
1
Schiller, Friedrich: Œuvres dramatiques [Ü: Amable-Guillaume-Prosper Brugière de Barante]
4
Schiller, Friedrich: Prolog zu „Wallenstein“
1
Schiller, Friedrich: Reiterlied
3
Schiller, Friedrich: Ritter Toggenburg
1
Schiller, Friedrich: Rosamund oder Die Braut der Hölle
2
Schiller, Friedrich: Sämmtliche Werke
1
Schiller, Friedrich: Stanzen an den Leser
1
Schiller, Friedrich: Theater von Schiller
1
Schiller, Friedrich: Thekla
1
Schiller, Friedrich: Über Bürgers Gedichte (Rezension)
12
Schiller, Friedrich: Über den Grund des Vergnügens an tragischen Gegenständen
3
Schiller, Friedrich: Über die tragische Kunst
1
Schiller, Friedrich: Unsterblichkeit
1
Schiller, Friedrich: Verteidigung des Rezensenten gegen obige Antikritik (von Gottfried August Bürger)
3
Schiller, Friedrich: Weisheit und Klugheit
1
Schiller, Friedrich: Werke
5
Schilling von Cannstatt, Paul Ludwig: Ta-Hio
1
Schilling von Cannstatt, Paul Ludwig: Tchong Yong
1
Schilter, Johann Georg: Thesaurus antiquitatum teutonicarum, ecclesiasticarum, civilium, litterariarum
7
Schinkel, Karl Friedrich: (Anatomie-Gebäude der Universität Bonn)
1
Schinkel, Karl Friedrich: Werke
1
Schlegel, August Wihelm von: Artistische und literarische Nachrichten aus Rom
1
Schlegel, August Wilhelm von: Abendlied an die Entfernte
4
Schlegel, August Wilhelm von: Abfertigung eines unwißenden Recensenten der schlegelschen Uebersetzung des Shakespeare
1
Schlegel, August Wilhelm von: (Abriß vom Studium der classischen Philologie)
3
Schlegel, August Wilhelm von: Abriß von den Europäischen Verhältnissen der Deutschen Litteratur
1
Schlegel, August Wilhelm von: Abschied von der ALZ
4
Schlegel, August Wilhelm von: A Course of Lectures on Dramatic Art and Literature (2. Aufl. 1840) [Ü: John Black]
5
Schlegel, August Wilhelm von: A Course of Lectures on Dramatic Art and Literature (3. Aufl., 1846) [Ü: John Black]
1
Schlegel, August Wilhelm von: A Course of Lectures on Dramatic Art and Literature [Ü: John Black]
20
Schlegel, August Wilhelm von: Adonis
1
Schlegel, August Wilhelm von: Aeschylus: Tragoediae. Ü: Christian Gottfried Schütz. (Rezension)
1
Schlegel, August Wilhelm von: Aeschylus: Vier Tragödien. Ü: Friedrich Leopold zu Stolberg-Stolberg (Rezension)
7
Schlegel, August Wilhelm von: Allgemeine Geschichte (Bonn WS 1819/1820)
1
Schlegel, August Wilhelm von: Allgemeines Los
1
Schlegel, August Wilhelm von: Allgemeine Theorie und Geschichte der bildenden Künste (Bonn SS 1822)
3
Schlegel, August Wilhelm von: Almanache von Voß und Reinhard (Rezension)
4
Schlegel, August Wilhelm von: Alte Weltgeschichte, 1. Hälfte (Bonn WS 1823/24)
2
Schlegel, August Wilhelm von: Alte Weltgeschichte, 2. Hälfte (Bonn SS 1824)
2
Schlegel, August Wilhelm von: Alte Weltgeschichte, bis auf die Zerstörung des abendländischen Römischen Reichs (Vorlesung, Bonn WS 1821/22)
5
Schlegel, August Wilhelm von: Alxinger, Johann Baptist von: Doolin von Maynz (Rezensionsplan)
4
Schlegel, August Wilhelm von: Amazonen
3
Schlegel, August Wilhelm von: Am Tage der Huldigung
7
Schlegel, August Wilhelm von: Analyse grammaticale des variants du manuscrits autographe de 1775, comparée avec les passage correspondants dans lʼédition des Oeuvres posthumes publiée à Berlin 1788
6
Schlegel, August Wilhelm von: An Bachidion
1
Schlegel, August Wilhelm von: An Bürger (1789)
3
Schlegel, August Wilhelm von: An Bürger (1790)
2
Schlegel, August Wilhelm von: An Bürgers Schatten
2
Schlegel, August Wilhelm von: An Buri (Friedrich Bury), über sein Bildniß der Gräfin Tolstoy, geb. Bariatinsky
8
Schlegel, August Wilhelm von: An Calderón
2
Schlegel, August Wilhelm von: An das Publikum
12
Schlegel, August Wilhelm von: An den Freiherrn de la Motte Fouqué
2
Schlegel, August Wilhelm von: An denselben (Novalis)
1
Schlegel, August Wilhelm von: An die Rhapsodinn
3
Schlegel, August Wilhelm von: An die südlichen Dichter, deren Lieder ich übersetzt hatte
1
Schlegel, August Wilhelm von: An einen Helden
1
Schlegel, August Wilhelm von: An einen Kunstrichter
5
Schlegel, August Wilhelm von: An einige junge Historiker
2
Schlegel, August Wilhelm von: Anfangsgründe des Sanscrit (Vorlesung, Bonn WS 1821/22)
3
Schlegel, August Wilhelm von: An Fräulein Albertine de Staël bey ihrer Vermählung
3
Schlegel, August Wilhelm von: An Frau von Flotow
1
Schlegel, August Wilhelm von: An Friederike Unzelmann
3
Schlegel, August Wilhelm von: An Friedrich Schlegel
8
Schlegel, August Wilhelm von: An Garlieb (Helwig) Merkel
2
Schlegel, August Wilhelm von: Anhänglichkeit
1
Schlegel, August Wilhelm von: An Herrn Professor Heeren in Göttingen
5
Schlegel, August Wilhelm von: An Ida Brun
4
Schlegel, August Wilhelm von: Anmerkung
1
Schlegel, August Wilhelm von: Anmerkungen zu Tiecks Anmerkungen
1
Schlegel, August Wilhelm von: An Novalis (Nr. VIII in „Todten-Opfer“)
4
Schlegel, August Wilhelm von: An Schelling
1
Schlegel, August Wilhelm von: An Sophia Müller
1
Schlegel, August Wilhelm von: An Sophia Müller, Schauspielerin des k. k. Hoftheaters in Wien
1
Schlegel, August Wilhelm von: Antwort des Herausgebers
1
Schlegel, August Wilhelm von: Antwort des Hrn. Prof. A. W. Schlegel
2
Schlegel, August Wilhelm von: Anzeige einer poetischen Epistel von Manso
1
Schlegel, August Wilhelm von: Aperçus Historiques, Paraboles, Doutes et Problèmes
1
Schlegel, August Wilhelm von: Architektur. In: Vorlesungen über schöne Literatur und Kunst (Berlin 1801–1804)
1
Schlegel, August Wilhelm von: Ariadne
4
Schlegel, August Wilhelm von: Arion
13
Schlegel, August Wilhelm von: Ariosto
2
Schlegel, August Wilhelm von: Ariosto, Ludovico: Rasender Roland. Ü: Johann Diederich Gries (Rezension)
15
Schlegel, August Wilhelm von: Athenaeums-Fragmente
8
Schlegel, August Wilhelm von: Athenaeums-Fragment Nr. 192
1
Schlegel, August Wilhelm von: Athenaeums-Fragment Nr. 241
1
Schlegel, August Wilhelm von: Athenaeums-Fragment Nr. 260
3
Schlegel, August Wilhelm von: Athenaeums-Fragment Nr. 269
2
Schlegel, August Wilhelm von: Athenaeums-Fragment Nr. 273
1
Schlegel, August Wilhelm von: Athenaeus-Fragment Nr. 193
1
Schlegel, August Wilhelm von: Auch an einen Politiker
1
Schlegel, August Wilhelm von: Auf Bonaparte
1
Schlegel, August Wilhelm von: Auf der Reise
3
Schlegel, August Wilhelm von: Auf der Reise (ursprünglich „Abschied aus Frankreich“)
8
Schlegel, August Wilhelm von: Auf der Richtstätte der Jungfrau von Orleans zu Rouen
7
Schlegel, August Wilhelm von: Auf die Arme der Geliebten
1
Schlegel, August Wilhelm von: Auf die Taufe eines Negers
1
Schlegel, August Wilhelm von: Auf die Vergänglichkeit alles Irdischen
1
Schlegel, August Wilhelm von: Auf einen Politiker
1
Schlegel, August Wilhelm von: Auf Veranlassung des Briefwechsels zwischen Göthe (Goethe) und Schiller
2
Schlegel, August Wilhelm von: Ausartung des deutschen Heldengesangs
1
Schlegel, August Wilhelm von: Aus dem Gefängniß
2
Schlegel, August Wilhelm von: (Aus dem Griechischen)
4
Schlegel, August Wilhelm von: Aus einem ungedruckten Roman
12
Schlegel, August Wilhelm von: Aus einer noch ungedruckten historischen Untersuchung über das Lied der Nibelungen
25
Schlegel, August Wilhelm von: Auserlesene Elegien des Propertius aus dem vierten Bande, in lateinischer Sprache (Bonn WS 1825/26)
4
Schlegel, August Wilhelm von: Auserlesene Elegien des Propertius, in lateinischer Sprache (Bonn SS 1826)
2
Schlegel, August Wilhelm von: Aus Shakespeares Julius Cäsar
1
Schlegel, August Wilhelm von: Ave Maria
2
Schlegel, August Wilhelm von: Ballade vom Raube der Sabinerinnen und von der neuentdeckten Stadt Quirium
2
Schlegel, August Wilhelm von: Begebenheiten, welche das Zeitalter hauptsächlich bestimmt haben. Reformation. Buchdruckerkunst. Geist der mordernen Kritik [...]. In: Vorlesungen über schöne Literatur und Kunst (Berlin 1801–1804)
1
Schlegel, August Wilhelm von: Bei der Gelegenheit von Goethes Tode
1
Schlegel, August Wilhelm von: Beiträge zur Kritik der neuesten Literatur
16
Schlegel, August Wilhelm von: Belletristische Zeitung
2
Schlegel, August Wilhelm von: Bereicherung der Völkerkunde
1
Schlegel, August Wilhelm von: Beresford, Benjamin: The German Erato; A Collection of German Ballads and Songs with their Original Music, done into English by the Translator of the German Erato (Rezension)
4
Schlegel, August Wilhelm von: Berliner Nationaltheater
1
Schlegel, August Wilhelm von: Bernhardi, August Ferdinand: Bambocciaden. Bd. 1 (Rezension)
1
Schlegel, August Wilhelm von: (Bertold von Zäringen, sey hoch gepriesen...)
1
Schlegel, August Wilhelm von: Beschreibung eines gesellschaftlichen Fragespiels
1
Schlegel, August Wilhelm von: Betrachtungen über die Politik der dänischen Regierung
15
Schlegel, August Wilhelm von: Betrachtungen über Metrik
5
Schlegel, August Wilhelm von: (Bewundert nur die feingeschnitzten Götzen)
1
Schlegel, August Wilhelm von: Blumensträusse italiänischer, spanischer und portugiesischer Poesie
35
Schlegel, August Wilhelm von: Boccaccio
2
Schlegel, August Wilhelm von: Bonstetten, Karl Viktor von: Voyage sur la scene des six derniers livres de lʼÉnéide (Rezension)
2
Schlegel, August Wilhelm von: Bopp, Franz (Hg.): Nalus, carmen sanscritum e Mahabharato (Rezension)
12
Schlegel, August Wilhelm von: Brief eines Reisenden aus Lyon
1
Schlegel, August Wilhelm von: Briefe über Poesie, Silbenmaaß und Sprache
33
Schlegel, August Wilhelm von: Buchhändler und Käufer
1
Schlegel, August Wilhelm von: Bürger
2
Schlegel, August Wilhelm von: Bürger, Gottfried August: Sämtliche Werke (Rezension)
1
Schlegel, August Wilhelm von: Buri, Christian Karl Ernst Wilhelm: Gedichte (Rezension)
1
Schlegel, August Wilhelm von: Büsching, Johann Gustav Gottlieb; Hagen, Friedrich Heinrich von der: Buch der Liebe (Rezension)
7
Schlegel, August Wilhelm von: Cervantes Saavedra, Miguel de: Don Quixote. Ü: Dietrich Wilhelm Soltau (Rezension)
10
Schlegel, August Wilhelm von: Cervantes Saavedra, Miguel de: Leben und Thaten des scharfsinnigen Edlen Don Quixote von La Mancha. Ü: Ludwig Tieck (Rezension)
8
Schlegel, August Wilhelm von: Charakteristik eines Geschichtsschreibers
1
Schlegel, August Wilhelm von: Chézy, Antoine Léonard de: Discours prononcé au Collège Royal (Anzeige)
1
Schlegel, August Wilhelm von: Chézy, Antoine Léonard de: Yadina datta-Badha; ders.: Discours prononcé au Collège Royal (Anzeige)
7
Schlegel, August Wilhelm von: Christi Geburt
2
Schlegel, August Wilhelm von: Cleopatra von Guido Reni
2
Schlegel, August Wilhelm von: Cleopatra (Werkplan)
1
Schlegel, August Wilhelm von: Comparaison de quelques passages du Hitopadesa dans la traduction de S. W. Jones et dans celle de M. Wilkins
1
Schlegel, August Wilhelm von: Considérations sur la civilisation en général et sur l’origine et la décadence des religions
4
Schlegel, August Wilhelm von: Considérations sur la politique du gouvernement danois
8
Schlegel, August Wilhelm von: Conspectum generalem litterarum et antiquitatum Indicarum (Bonn SS 1819)
4
Schlegel, August Wilhelm von: Constant, Benjamin: Wallstein (Anzeige)
2
Schlegel, August Wilhelm von: Copies of the original letters and dispatches of the generals, ministers, grand officers of state, etc., at Paris, to the emperor Napoleon, at Dresden, intercepted by the advanced troops of the allies in the North of Germany
2
Schlegel, August Wilhelm von: Corinna auf dem Vorgebirge Miseno, nach dem Roman der Frau von Staël
8
Schlegel, August Wilhelm von: Corso di letteratura drammatica [Ü: Giovanni Gherhardini]
9
Schlegel, August Wilhelm von: Cours de littérature dramatique [Ü: Albertine Adrienne Necker]
13
Schlegel, August Wilhelm von: Cours de littérature dramatique [Ü: Helmina von Chézy, Adelbert von Chamisso]
21
Schlegel, August Wilhelm von: Crisis antiquissimae Romanorum historiae (Bonn WS 1818/19)
3
Schlegel, August Wilhelm von: Dante
2
Schlegel, August Wilhelm von: Dante’s Hölle übersetzt
32
Schlegel, August Wilhelm von: Dantes Leben und Werke
15
Schlegel, August Wilhelm von: Dante. Über die göttliche Komödie
14
Schlegel, August Wilhelm von: Das Feenkind
8
Schlegel, August Wilhelm von: Das Grab der Medicis
2
Schlegel, August Wilhelm von: Das Lieblichste
1
Schlegel, August Wilhelm von: Das Schwanenlied
1
Schlegel, August Wilhelm von: Das Sonett
1
Schlegel, August Wilhelm von: Das Trauerspiel Numancia
2
Schlegel, August Wilhelm von: Das Zeitalter
1
Schlegel, August Wilhelm von: De geographia Homerica commentatio
9
Schlegel, August Wilhelm von: De la Mythologie grecque
1
Schlegel, August Wilhelm von: De l’origine des Hindous
6
Schlegel, August Wilhelm von: De lʼorigine des romans de chevalerie
8
Schlegel, August Wilhelm von: (Denkschrift für das Journal Asiatique)
1
Schlegel, August Wilhelm von: Depêches et lettres interceptées par des partis détachés de lʼArmée combinée du nord de lʼAllemagne
12
Schlegel, August Wilhelm von: Der Abschied
1
Schlegel, August Wilhelm von: Der Apostel
2
Schlegel, August Wilhelm von: Der Ball
1
Schlegel, August Wilhelm von: Der berittene Dichter
1
Schlegel, August Wilhelm von: Der Bund der Kirche mit den Künsten
3
Schlegel, August Wilhelm von: Der Dom zu Mailand
5
Schlegel, August Wilhelm von: Der englische Gruß
1
Schlegel, August Wilhelm von: Der Entfernten
1
Schlegel, August Wilhelm von: Der erste Besuch am Grabe
1
Schlegel, August Wilhelm von: Der gespaltene Berg
2
Schlegel, August Wilhelm von: Der Gesundbrunnen
1
Schlegel, August Wilhelm von: Der heilige Lucas
2
Schlegel, August Wilhelm von: Der heilige Sebastian
1
Schlegel, August Wilhelm von: Der lahme Pamphletist
2
Schlegel, August Wilhelm von: Der letzte Wunsch
4
Schlegel, August Wilhelm von: Der neue Pygmalion
4
Schlegel, August Wilhelm von: Der vorwaltende Gedanke
2
Schlegel, August Wilhelm von: (Des Rheines Ufer zu verlassen)
1
Schlegel, August Wilhelm von: De studiis academicis recte instituendis (Bonn WS 1819/1820)
1
Schlegel, August Wilhelm von: De studio etymologico
6
Schlegel, August Wilhelm von: De usu linguae Brachmanum sacrae in causis linguae graecae et latinae indagandis
8
Schlegel, August Wilhelm von: Deutung
1
Schlegel, August Wilhelm von: De Zodiaci antiquitate et origine
7
Schlegel, August Wilhelm von: Dichter-Garten. Erster Gang (Rezension)
12
Schlegel, August Wilhelm von: Dichtersinn
2
Schlegel, August Wilhelm von: Die Bestattung der Braminen
2
Schlegel, August Wilhelm von: Die Brüder
1
Schlegel, August Wilhelm von: Die Brüder des Terentius ein Schauspiel in Masken (Rezension)
1
Schlegel, August Wilhelm von: Die deutsche Grammatik (Bonn WS 1826/27)
3
Schlegel, August Wilhelm von: Die deutschen Mundarten
4
Schlegel, August Wilhelm von: Die einzige Sicherheit
1
Schlegel, August Wilhelm von: Die entführten Götter
11
Schlegel, August Wilhelm von: Die Erhörung
3
Schlegel, August Wilhelm von: Die gefangenen Sänger
1
Schlegel, August Wilhelm von: Die größere Gefahr
3
Schlegel, August Wilhelm von: Die Harfenspielerin
5
Schlegel, August Wilhelm von: Die heilige Familie
2
Schlegel, August Wilhelm von: Die heiligen drey Könige
2
Schlegel, August Wilhelm von: Die Herabkunft der Göttin Ganga (Teilübersetzung aus: Ramayana)
4
Schlegel, August Wilhelm von: Die Himmelfahrt der Jungfrau
2
Schlegel, August Wilhelm von: Die Horen (Rezension)
14
Schlegel, August Wilhelm von: Die Huldigung des Rheins
20
Schlegel, August Wilhelm von: Die italiänischen Dichter
2
Schlegel, August Wilhelm von: Die Kunst der Griechen
21
Schlegel, August Wilhelm von: Die Kunst der Griechen [Ü: Johann Dominicus Fuss]
2
Schlegel, August Wilhelm von: Die lange Schriftsteller-Laufbahn
1
Schlegel, August Wilhelm von: Die Leiden des Persiles und der Sigismunda
2
Schlegel, August Wilhelm von: Die miteinander streitenden Ausgaben
1
Schlegel, August Wilhelm von: Die Mutter Gottes in der Herrlichkeit
2
Schlegel, August Wilhelm von: Die Nebenbuhlerinnen
1
Schlegel, August Wilhelm von: Die neue Sehnsucht
1
Schlegel, August Wilhelm von: Die Priesterin der Trümmer
3
Schlegel, August Wilhelm von: Die Reise auf den Parnass
1
Schlegel, August Wilhelm von: Die Silbenmaße
1
Schlegel, August Wilhelm von: Die Spindel
1
Schlegel, August Wilhelm von: Die Sprachen
24
Schlegel, August Wilhelm von: Die Stunde vor dem Abschiede
1
Schlegel, August Wilhelm von: Die Sylbenmaaße
2
Schlegel, August Wilhelm von: Die Toilette des politischen Schriftstellers
2
Schlegel, August Wilhelm von: Die Tragiker
2
Schlegel, August Wilhelm von: Die veränderten Zeiten
2
Schlegel, August Wilhelm von: Die verfehlte Stunde
1
Schlegel, August Wilhelm von: Die verlorne Unschuld
2
Schlegel, August Wilhelm von: Die vor Liebe sterbende Maria
1
Schlegel, August Wilhelm von: Die Warnung
16
Schlegel, August Wilhelm von: Docen, Bernhard Joseph: Erstes Sendschreiben über den Titurel (Rezension)
18
Schlegel, August Wilhelm von: Don Quixote de la Mancha
2
Schlegel, August Wilhelm von: Du système continental
2
Schlegel, August Wilhelm von: Ehrenpforte und Triumphbogen für den Theater-Präsidenten von Kotzebue, bey seiner gehofften Rückkehr ins Vaterland
62
Schlegel, August Wilhelm von: Einige homerische Fragen, in lateinischer Sprache (Bonn WS 1835/6)
4
Schlegel, August Wilhelm von: Einleitung in die alte Weltgeschichte (Bonn SS 1821)
4
Schlegel, August Wilhelm von: Ein schön kurzweilig Fastnachtspiel vom alten und neuen Jahrhundert
7
Schlegel, August Wilhelm von: Entsagung und Treue
4
Schlegel, August Wilhelm von: (Epigramme)
3
Schlegel, August Wilhelm von: (Epigramme auf den Schillerischen Briefwechsel)
1
Schlegel, August Wilhelm von: Epistel an einen Freund
2
Schlegel, August Wilhelm von: Epistola critica an Jacob Grimm
2
Schlegel, August Wilhelm von: Erklärung der Kupferstiche für den Berliner Kalender auf das Gemein Jahr 1829
1
Schlegel, August Wilhelm von: Erklärung (gegen Friedrich Ludwig Lindners Anekdoten in Jacques-Charles Bailleul: Examen critique de lʼouvrage postume de Mme de Staël)
7
Schlegel, August Wilhelm von: (Erklärung über die Autorschaft der „Ehrenpforte“)
5
Schlegel, August Wilhelm von: Errors and Blunders of the commentators of Shakespeare
1
Schlegel, August Wilhelm von: Erster Entwurf des Werkes
1
Schlegel, August Wilhelm von: Erzürnte Liebe
2
Schlegel, August Wilhelm von: Essais littéraires et historiques
29
Schlegel, August Wilhelm von: Etwas über William Shakespeare bey Gelegenheit Wilhelm Meisters
18
Schlegel, August Wilhelm von: Etymologicum novum sive Synopsis linguarum
12
Schlegel, August Wilhelm von: Ewige Jugend
1
Schlegel, August Wilhelm von: Falk, Johann Daniel: Taschenbuch für Freunde des Scherzes und der Satire (Rezension)
6
Schlegel, August Wilhelm von: Fausta navigatio regis Friderici Guilelmi III [...]
21
Schlegel, August Wilhelm von: Fischer, Johann Carl Christian: Graf Pietro dʼAlbi und Gianetta (Rezension)
1
Schlegel, August Wilhelm von: Fortunat
16
Schlegel, August Wilhelm von: Fragment aus Danteʼs göttlicher Komödie. Das Himmelreich (1., 2., 21., 33. Gesang)
4
Schlegel, August Wilhelm von: Fragment aus Danteʼs göttlicher Komödie. Die Büßungswelt (1., 6., 9., 27., 30. Gesang)
5
Schlegel, August Wilhelm von: Fragment dʼune lettre originale de M. W. Schlegel sur Le Triomphe de la sensibilité
3
Schlegel, August Wilhelm von: Fragments dʼune nouvelle tragédie
2
Schlegel, August Wilhelm von: (Französische Depesche?)
1
Schlegel, August Wilhelm von: Frühlingslied eines kranken und schwermüthigen Mädchens
1
Schlegel, August Wilhelm von: Galatea
1
Schlegel, August Wilhelm von: Gebet
3
Schlegel, August Wilhelm von: Gedichte
131
Schlegel, August Wilhelm von: Gedichte auf Rudolf von Habsburg von Zeitgenossen
7
Schlegel, August Wilhelm von: Gedichte (Rezension)
3
Schlegel, August Wilhelm von: Geliebte Spuren
1
Schlegel, August Wilhelm von; Genelli, Hans Christian: Die griechischen Tragiker
1
Schlegel, August Wilhelm von: Geographie
1
Schlegel, August Wilhelm von: Gesang und Kuß
11
Schlegel, August Wilhelm von: Geschichte der deutschen Dichtkunst (Jena, WS 1798/99, verschollen)
1
Schlegel, August Wilhelm von: Geschichte der deutschen Sprache und Poesie (Bonn WS 1818/19)
4
Schlegel, August Wilhelm von: Geschichte der deutschen Sprache und Poesie (Bonn WS 1826/27)
2
Schlegel, August Wilhelm von: Geschichte der deutschen Sprache und Poesie (Vorlesung, Bonn WS 1821/22)
3
Schlegel, August Wilhelm von: Geschichte der Griechen und Römer (Bonn WS 1822/23)
3
Schlegel, August Wilhelm von: Geschichte der schönen Litteratur in Italien, Spanien Frankreich und England, vom Mittelalter bis auf die heutige Zeit (Bonn SS 1819)
5
Schlegel, August Wilhelm von: Geschichte der schönen Litteratur in Italien, Spanien Frankreich und England, vom Mittelalter bis auf die heutige Zeit (Bonn WS 1818/19)
2
Schlegel, August Wilhelm von: Geschichte des abendländischen römischen Kaisertums (SS 1830)
1
Schlegel, August Wilhelm von: Geschichte des abendländischen römischen Reiches (Bonn 1829/30)
1
Schlegel, August Wilhelm von: Geschiedenis der Tooneelkunst en Tooneelpoëzij. Eerste Deel [Ü: Nicolaas Godfried van Kampen]
1
Schlegel, August Wilhelm von: Gespräch
2
Schlegel, August Wilhelm von: Glaube
7
Schlegel, August Wilhelm von: (Glossen auf Ludwig Tiecks „Liebe denkt in süßen Tönen“)
2
Schlegel, August Wilhelm von: Glückwunsch eines jungen Mädchens am Hochzeitstage ihrer Tante
1
Schlegel, August Wilhelm von: Goethe, Johann Wolfgang von: Hermann und Dorothea (Rezension)
18
Schlegel, August Wilhelm von: Goethe, Johann Wolfgang von: Römische Elegien (Rezension, in: Charakteristiken und Kritiken)
1
Schlegel, August Wilhelm von: Graberg af Hemsŏ, Jacob: Su la falsità dell’origine scandinava data ai popoli detti barbari che distrussero l’Impero di Roma (Rezensionsplan)
6
Schlegel, August Wilhelm von: Grammatica sanscrita
15
Schlegel, August Wilhelm von: Grimm, Jacob: Altdeutsche Wälder (Rezension)
10
Schlegel, August Wilhelm von: Grohmann, Johann Christian August: Ästhetische Beurtheilung des Klopstockischen Messias; Benkowitz, Karl Friedrich: Der Messias von Klopstock, ästhetisch beurtheilt und verglichen mit [...] (Rezension)
6
Schlegel, August Wilhelm von: Grohmann, Johann Gottfried: Versuch zur Bildung des Geschmacks in Werken der bildenden Künste (Rezension)
1
Schlegel, August Wilhelm von: Guarini
2
Schlegel, August Wilhelm von: Herder, Johann Gottfried von: Terpsichore (Rezension)
11
Schlegel, August Wilhelm von (Hg.): Bhagavad-Gita
133
Schlegel, August Wilhelm von (Hg.): Indische Bibliothek
2
Schlegel, August Wilhelm von (Hg.): Verzeichniss einer von Eduard d’Alton [...] hinterlassenen Gemälde-Sammlung
5
Schlegel, August Wilhelm von: Historische, literarische und unterhaltende Schriften von Horatio Walpole
3
Schlegel, August Wilhelm von: Homerus: Werke. Ü: Johann Heinrich Voß (Rezension)
18
Schlegel, August Wilhelm von: Humboldt, Alexander von: Vues des Cordillères et monumens des peuples indigènes de l’Amérique (unveröffentlichte Rezension)
4
Schlegel, August Wilhelm von: Hymnen nach dem Lateinischen
4
Schlegel, August Wilhelm von: Ich achte sehr die Curien
4
Schlegel, August Wilhelm von: Idées sur l’Avenir de la France
1
Schlegel, August Wilhelm von: Idylle
1
Schlegel, August Wilhelm von: Iffland, August Wilhelm: Neue Sammlung deutscher Schauspiele. Bd. 9: Dienstpflicht, Bd. ?: Das Vermächtnis, Bd. 12: Die Advokaten (Rezension)
1
Schlegel, August Wilhelm von: Impromptü bei einem gesellschaftlichen Fragespiel
1
Schlegel, August Wilhelm von: In das Stammbuch der Fräulein von W....l (Winkel)
2
Schlegel, August Wilhelm von: (In das Stammbuch des Erbgroßherzogs von M. St.)
1
Schlegel, August Wilhelm von: In der Fremde
9
Schlegel, August Wilhelm von: Indien in seinen Hauptbeziehungen
12
Schlegel, August Wilhelm von: (Indische Sittensprüche)
1
Schlegel, August Wilhelm von: Indisches Theater
5
Schlegel, August Wilhelm von: (Ins Lateinische übersetzte Elegien)
1
Schlegel, August Wilhelm von: Introduction zu: Friedrich II., Preußen, König: Œuvres
21
Schlegel, August Wilhelm von: In unbewahrter Jugend frischer Blüthe
2
Schlegel, August Wilhelm von: Ion, ein neues Original-Schauspiel
1
Schlegel, August Wilhelm von: Java und Bali. In: Indische Bibliothek
1
Schlegel, August Wilhelm von: Johannes in der Wüste
3
Schlegel, August Wilhelm von: Johann von Fiesole
5
Schlegel, August Wilhelm von: Jo von Correggio
1
Schlegel, August Wilhelm von: Kampaspe
6
Schlegel, August Wilhelm von: Kleine Gedichte aus dem Griechischen
1
Schlegel, August Wilhelm von: Kleomenes an Chariton
2
Schlegel, August Wilhelm von: Königlich Rheinisches Museum vaterländischer Alterthümer
2
Schlegel, August Wilhelm von: Kotzebueʼs Reisebeschreibung
1
Schlegel, August Wilhelm von: Kritische Ausgabe des Nibelungenliedes
49
Schlegel, August Wilhelm von: Kritische Schriften
28
Schlegel, August Wilhelm von: Kritische Schriften. Bd. 1
9
Schlegel, August Wilhelm von: Kritische Schriften. Bd. 2
8
Schlegel, August Wilhelm von: Kritische Schriften. Bd. 3 (Werkplan)
1
Schlegel, August Wilhelm von: La Proclamation aux Habitants de Holstein
1
Schlegel, August Wilhelm von; Lassen, Christian: Hitopadesas id est Institutio salutaris
78
Schlegel, August Wilhelm von: (Lateinische Abhandlung als Programm für des Königs Geburtstag)
2
Schlegel, August Wilhelm von: (Lateinische Schrift)
1
Schlegel, August Wilhelm von: Le Dante, Pétrarque et Boccae, justifiés de lʼimputation dʼhérésie et dʼune conspiration tendant au renversement du Saint Siège
2
Schlegel, August Wilhelm von: Leda von Michel Angelo
1
Schlegel, August Wilhelm von: Leonardo da Vinci
3
Schlegel, August Wilhelm von: Les mille et une nuits
10
Schlegel, August Wilhelm von: Lettera ai signori compilatori della Biblioteca italiana sui cavalli di bronzo in Venezia
9
Schlegel, August Wilhelm von: Lettre de M. A. W. Schlegel sur l’ouvrage de M. Rossetti
2
Schlegel, August Wilhelm von: Lettre sur les chevaux de bronce de la basilique de St. Marc à Venise
3
Schlegel, August Wilhelm von: Lettre to the Honorable Court of Directors of the Honorable East-India Company
1
Schlegel, August Wilhelm von: Licht und Liebe
2
Schlegel, August Wilhelm von: Lied der Nibelungen (Bonn SS 1820)
2
Schlegel, August Wilhelm von: Lied der Nibelungen (Bonn SS 1823)
2
Schlegel, August Wilhelm von: Literarischer Reichsanzeiger
8
Schlegel, August Wilhelm von: Lob der Thränen
6
Schlegel, August Wilhelm von: (Lobrede auf August Ferdinand Naeke)
1
Schlegel, August Wilhelm von: (Lʼamour et lʼart des vers sont faits pour la jeunesse) [Ü: Theodor Thomas]
1
Schlegel, August Wilhelm von: Macbeth für das weimarische Hoftheater eingerichtet von Schiller
1
Schlegel, August Wilhelm von: (Man begehrt von meinen Locken...)
1
Schlegel, August Wilhelm von: Manso, Johann Caspar Friedrich: Über die Verleumdung der Wissenschaften (Rezension)
1
Schlegel, August Wilhelm von: Mater dolorosa
2
Schlegel, August Wilhelm von: Matthissons Basrelief am Sarkofage des Jahrhunderts
3
Schlegel, August Wilhelm von: Mémoire sur lʼétat actuel de lʼAllemagne et sur le moyen dʼy former une insurrection nationale
4
Schlegel, August Wilhelm von: Montbard
2
Schlegel, August Wilhelm von: Monti, Vincenzo: Del cavallo alato dʼArsine (1804); Prolusioni agli studj dellʼuniversità di Pavia per lʼanno 1804 (1804) (Rezension)
2
Schlegel, August Wilhelm von: Morayzela
4
Schlegel, August Wilhelm von: Mustoxydēs, Andreas: Sui quattro cavalli (Rezension)
5
Schlegel, August Wilhelm von: Nach Lesung der ersten Ausgabe
1
Schlegel, August Wilhelm von: Nachrichten
1
Schlegel, August Wilhelm von: Nachschrift des Übersetzers an Ludwig Tieck [Ü: August Wilhelm von Schlegel]
5
Schlegel, August Wilhelm von: Narcissus
1
Schlegel, August Wilhelm von: Neoptolemus an Diokles
3
Schlegel, August Wilhelm von: Neubeck, Valerius Wilhelm: Die Gesundbrunnen (Rezension)
10
Schlegel, August Wilhelm von: Neue Fratzen, statt der alten
1
Schlegel, August Wilhelm von: Neueste Mittheilungen der Asiatischen Gesellschaft zu Calcutta
1
Schlegel, August Wilhelm von: Niebuhr, Barthold Georg: Römische Geschichte (Rezension)
23
Schlegel, August Wilhelm von: Nikon und Heliodora
1
Schlegel, August Wilhelm von: Niobé et ses enfants
8
Schlegel, August Wilhelm von: Noch ein Wort über die Originalität von Bürgers Leonore
2
Schlegel, August Wilhelm von: Notizen (Basrelief am Sarkofage des Jahrhunderts; Alius Abenteuer [...])
5
Schlegel, August Wilhelm von: Observations sur la critique du Bhagavad-Gîtâ, insérée dans le Journal Asiatique, par Alexandre Langlois
12
Schlegel, August Wilhelm von: Observations sur la langue et la littérature provençales
27
Schlegel, August Wilhelm von: Observations sur quelques médailles bactriennes et indoscythiques nouvellement découvertes
5
Schlegel, August Wilhelm von: Oft, ach mit wie bangem Zagen!
1
Schlegel, August Wilhelm von: Oratio cum magistratum academicum die XVIII. octobris anni MDCCCXXV deponeret habita
3
Schlegel, August Wilhelm von: Oratio natalibus Friderici Guilelmi III
12
Schlegel, August Wilhelm von: Ottnit und Siegfried
1
Schlegel, August Wilhelm von: Parabel vom Eulenspiegel und den Schneidern
2
Schlegel, August Wilhelm von: Parny, La guerre des dieux
11
Schlegel, August Wilhelm von: Pensées détachées, doutes et problèmes
1
Schlegel, August Wilhelm von: Pensées détachées. Première centurie
1
Schlegel, August Wilhelm von: Petrarca
2
Schlegel, August Wilhelm von: Philosophische Lektion
5
Schlegel, August Wilhelm von: Philoxenos
2
Schlegel, August Wilhelm von: Poesie. In: Vorlesungen über schöne Literatur und Kunst (Berlin 1801–1804)
1
Schlegel, August Wilhelm von: Poetische Werke (2 Bde., 1811)
77
Schlegel, August Wilhelm von: Précis de l’état actuel des différends entre le roi de Prusse, protecteur des protestans, et le Pape, protecteur des Jésuites et de L’Inquisition
1
Schlegel, August Wilhelm von: (Préface?)
3
Schlegel, August Wilhelm von: Probe einer neuen Übersetzung von Shakespeares Werken
3
Schlegel, August Wilhelm von: Proclamationen Sr. Königlichen Hoheit des Kronprinzen von Schweden [...]
1
Schlegel, August Wilhelm von: Prometheus
20
Schlegel, August Wilhelm von: Prometheus (Rezension)
2
Schlegel, August Wilhelm von: Propertius, Sextus: Elegien. Ü: Karl Ludwig von Knebel (Rezension)
5
Schlegel, August Wilhelm von: Properz
9
Schlegel, August Wilhelm von: Pygmalion
10
Schlegel, August Wilhelm von: Ramayana (Ankündigung)
15
Schlegel, August Wilhelm von: Ramayana id est carmen epicum de Ramae rebus gestis poetae antiquissimi Valmicis opus
210
Schlegel, August Wilhelm von: Réflexions sur lʼétude des langues asiatiques
57
Schlegel, August Wilhelm von: Remarques sur deux poèmes satiriques, intitulés Le Palladion et la Guerre des Confédérés
1
Schlegel, August Wilhelm von: Remarques sur un article de la gazette de Leipzick du 5 Octobre 1813 relatif au Prince de Suède
10
Schlegel, August Wilhelm von: Resultate tiefer Geschichtsforschung
1
Schlegel, August Wilhelm von: Revision des Oeuvres de Frédéric II Roi de Prusse
7
Schlegel, August Wilhelm von: Rezensionen
14
Schlegel, August Wilhelm von: Rezensionen (in: Charakteristiken und Kritiken)
2
Schlegel, August Wilhelm von: Rezept
1
Schlegel, August Wilhelm von: Ritterthum und Minne
1
Schlegel, August Wilhelm von: Rom
52
Schlegel, August Wilhelm von: Roma [Ü: Johann Dominicus Fuss]
2
Schlegel, August Wilhelm von: Römische Geschichte (Bonn SS 1819)
3
Schlegel, August Wilhelm von: Römische Geschichte (Bonn SS 1831)
4
Schlegel, August Wilhelm von: Römische Geschichte (Bonn WS 1828/29)
2
Schlegel, August Wilhelm von: Römische Litteratur (Bonn SS 1829)
1
Schlegel, August Wilhelm von: Rudolphi, Caroline Christiane Louise: Gedichte (Rezension)
1
Schlegel, August Wilhelm von: Sankt Lukas sah ein Traumgesicht
2
Schlegel, August Wilhelm von: (Sanskritverse)
3
Schlegel, August Wilhelm von: Scenen aus Romeo und Julie von Shakespeare
10
Schlegel, August Wilhelm von: Scherzhafte Gedichte
2
Schlegel, August Wilhelm von: Schiller, Friedrich: Die Künstler (Rezension)
3
Schlegel, August Wilhelm von; Schlegel, Friedrich von: Athenaeums-Fragmente
25
Schlegel, August Wilhelm von; Schlegel, Friedrich von: Charakteristiken und Kritiken
30
Schlegel, August Wilhelm von; Schlegel, Friedrich von: Elegien aus dem Griechischen
12
Schlegel, August Wilhelm von; Schlegel, Friedrich von: Idyllen aus dem Griechischen
4
Schlegel, August Wilhelm von; Schlegel, Friedrich von: Notizen
10
Schlegel, August Wilhelm von; Schlegel, Friedrich von; Schleiermacher, Friedrich; Bernhardi, August Ferdinand; Bernhardi, Sophie: Notizen
8
Schlegel, August Wilhelm von; Schlegel, Friedrich von; Schleiermacher, Friedrich: Entwurf zu einem kritischen Institute
1
Schlegel, August Wilhelm von; Schlegel, Friedrich von: Sonette
3
Schlegel, August Wilhelm von; Schlegel, Friedrich von: Trutzlieder
2
Schlegel, August Wilhelm von: Schreiben an den Buchhändler Reimer in Berlin und Anmerkungen zu Tiecks Anmerkungen zum deutschen Shakespeare und zu einigen Stellen des englischen Textes
3
Schlegel, August Wilhelm von: Schreiben an den Herausgeber
2
Schlegel, August Wilhelm von: Schreiben an Goethe über einige Arbeiten in Rom lebender Künstler
17
Schlegel, August Wilhelm von: Sein Leben
2
Schlegel, August Wilhelm von: Sibylle
1
Schlegel, August Wilhelm von: Sinnbilder
1
Schlegel, August Wilhelm von: Sinnesänderung
3
Schlegel, August Wilhelm von: Skolion
2
Schlegel, August Wilhelm von: Sonette
10
Schlegel, August Wilhelm von: Specimen novum typographiae indicae
42
Schlegel, August Wilhelm von: Staël-Holstein, Anne Louise Germaine de: Corinne ou lʼItalie (Rezension im Morgenblatt für gebildete Stände)
2
Schlegel, August Wilhelm von: Staël-Holstein, Anne Louise Germaine de: Corinne ou lʼItalie (Rezension in der Allgemeinen Literatur-Zeitung (Jena))
2
Schlegel, August Wilhelm von: Staël-Holstein, Anne Louise Germaine de: Manuscrits de Mr. Necker, publiés par sa fille (Rezension)
2
Schlegel, August Wilhelm von: Steckbrief
1
Schlegel, August Wilhelm von: Strixner, Johann Nepomuk: Albrecht Dürers christlich-mythologische Handzeichnungen (Rezension)
1
Schlegel, August Wilhelm von: Studium des Alterthums
3
Schlegel, August Wilhelm von: Sur le style français de Frédéric le Grand
3
Schlegel, August Wilhelm von: Sur le système continental et sur ses rapports avec la Suède
24
Schlegel, August Wilhelm von: Sur l’étude des antiquités étrusques
5
Schlegel, August Wilhelm von: Szenen aus Shakespeare
7
Schlegel, August Wilhelm von: Tableau de l’état politique et moral de l’Empire français en 1813
2
Schlegel, August Wilhelm von: Tagelied
1
Schlegel, August Wilhelm von: Tells Kapelle bei Küßnacht
4
Schlegel, August Wilhelm von: Terzinen zu Ehren Berns
1
Schlegel, August Wilhelm von: Teutonicus rusticus
2
Schlegel, August Wilhelm von: Theorie der bildenden Künste (Bonn WS 1819/20)
1
Schlegel, August Wilhelm von: Theorie und allgemeine Geschichte der bildenden Künste (Bonn SS 1819)
5
Schlegel, August Wilhelm von: Theorie und allgemeine Geschichte der bildenden Künste (Bonn SS 1840)
2
Schlegel, August Wilhelm von; Tieck, Christian Friedrich: Kunstnachrichten aus Rom
3
Schlegel, August Wilhelm von: Tieck, Ludwig: Der gestiefelte Kater (Anzeige)
4
Schlegel, August Wilhelm von: Tieck, Ludwig: Der Sturm. Ein Schauspiel von Shakspear (Shakespeare, William), für das Theater bearbeitet; Über Shakespeares Behandlung des Wunderbaren (Rezension)
2
Schlegel, August Wilhelm von: Tieck, Ludwig: Ritter Blaubart (Anzeige)
3
Schlegel, August Wilhelm von: Tieck, Ludwig: Romantische Dichtungen (Rezensionsplan)
1
Schlegel, August Wilhelm von; Tieck, Ludwig: Sonett
2
Schlegel, August Wilhelm von; Tieck, Ludwig: Sonetto à la burchiellesca
1
Schlegel, August Wilhelm von: Tieck, Ludwig: Volksmährchen von Peter Leberecht (Rezension)
2
Schlegel, August Wilhelm von: Tiedge, Christoph August: Episteln (Rezension)
1
Schlegel, August Wilhelm von: Todten-Opfer
11
Schlegel, August Wilhelm von: Torquato Tasso
2
Schlegel, August Wilhelm von: Travaux préparations pour la nouvelle édition des Oeuvres de Frédéric II Roi de Prusse
3
Schlegel, August Wilhelm von: Triolet
3
Schlegel, August Wilhelm von: Tristan
55
Schlegel, August Wilhelm von: Triumphus lutulentus
1
Schlegel, August Wilhelm von: Über Bürgers Werke
16
Schlegel, August Wilhelm von: Über das Continentalsystem und den Einfluß desselben auf die Schweden
2
Schlegel, August Wilhelm von: Über das Continentalsystem und den Einfluß desselben auf die Schweden [Ü: Friedrich Rühs]
1
Schlegel, August Wilhelm von: Über das Mittelalter. In: Vorlesungen über schöne Literatur und Kunst (Berlin 1801–1804)
3
Schlegel, August Wilhelm von: Über das spanische Theater
2
Schlegel, August Wilhelm von: Über das Verhältnis der schönen Kunst zur Natur
5
Schlegel, August Wilhelm von: Über den Adel des Atheismus
2
Schlegel, August Wilhelm von: Über den gegenwärtigen Zustand der Indischen Philologie
12
Schlegel, August Wilhelm von: Über den gegenwärtigen Zustand der Indischen Philologie [Ü: Horace H. Wilson]
1
Schlegel, August Wilhelm von: Über den gegenwärtigen Zustand der Indischen Philologie [Ü: N.N.]
1
Schlegel, August Wilhelm von: (Über die alte Weltgeschichte) (Bonner Vorlesungen)
1
Schlegel, August Wilhelm von: (Über die Deutsche Sprache) (Bonn WS 1830/31)
1
Schlegel, August Wilhelm von: Über die Sternbilder des Tierkreises im Alten Indien
11
Schlegel, August Wilhelm von: Über die Vermählungsfeier Sr. K. K. Majestät Franz I. mit I. Königl. Hoheit Maria Ludovica Beatrix von Österreich
6
Schlegel, August Wilhelm von: Über die Zunahme und den gegenwärtigen Stand unserer Kenntnisse von Indien
1
Schlegel, August Wilhelm von: Über dramatische Kunst und Literatur. Vorlesungen. 3. durchgesehene und vermehrte Ausgabe (1840ff.)
36
Schlegel, August Wilhelm von: Über dramatische Kunst und Litteratur. Vorlesungen (1809–1811)
120
GND
Schlegel, August Wilhelm von: Über dramatische Kunst und Litteratur. Vorlesungen. Bd. 1
53
Schlegel, August Wilhelm von: Über dramatische Kunst und Litteratur. Vorlesungen. Bd. 2
49
Schlegel, August Wilhelm von: Über dramatische Kunst und Litteratur. Vorlesungen. Bd. 3
41
Schlegel, August Wilhelm von: Über einige tragische Rollen, von Frau v. Staël dargestellt
9
Schlegel, August Wilhelm von (Übersetzer): Jacob Necker. Ersten Bandes Dritte Abtheilung
1
Schlegel, August Wilhelm von: Über Zeichnungen zu Gedichten und John Flaxmanʼs Umrisse
8
Schlegel, August Wilhelm von: Ueber Bürgers hohes Lied (Rezension)
1
Schlegel, August Wilhelm von: Ueber das akademische Studium (Vorlesung, Bonn WS 1821/22)
3
Schlegel, August Wilhelm von: Ueber das Mittelalter. Eine Vorlesung, gehalten 1803" (in: Deutsches Museum, 1812)
1
Schlegel, August Wilhelm von: Ueber die Etruscischen Alterthümer (Bonn SS 1822)
4
Schlegel, August Wilhelm von: Ueber die Etruscischen Alterthümer (Bonn WS 1822/23)
3
Schlegel, August Wilhelm von: Ueber die Nibelungen (Bonn SS 1832)
2
Schlegel, August Wilhelm von: Ueber die Nibelungen (Bonn WS 1831/32)
3
Schlegel, August Wilhelm von: Ueber die scenische Anordnung der griechischen Tragödien (unveröffentlichtes Fragment als Anhang zu den Vorlesungen „Ueber dramatische Kunst und Litteratur“)
11
Schlegel, August Wilhelm von: Ueber dramatische Kunst und Literatur. Vorlesungen (1817)
49
Schlegel, August Wilhelm von: Ueber dramatische Kunst und Litteratur (Vorlesungen Wien 1808)
146
Schlegel, August Wilhelm von: Ueber Litteratur, Kunst und Geist des Zeitalters
13
Schlegel, August Wilhelm von: Ueber Shakespeareʼs Romeo und Julia
13
Schlegel, August Wilhelm von: Ugolino
2
Schlegel, August Wilhelm von: Ugolino. Aus Dantes Hölle
4
Schlegel, August Wilhelm von: Ugolino und Ruggieri
10
Schlegel, August Wilhelm von: Umrisse, auf Reisen entworfen
17
Schlegel, August Wilhelm von: Umrisse, entworfen auf einer Reise durch die Schweiz
10
Schlegel, August Wilhelm von: Untergang der Ideen, Wissenschaftlicher Zustand: Geschichte, Philologie, physikalische Wissenschaften [...]. In: Vorlesungen über schöne Literatur und Kunst (Berlin 1801–1804)
1
Schlegel, August Wilhelm von: Urkunde
1
Schlegel, August Wilhelm von: Variationen auf den Refrain des Hexensgesanges im Macbeth
1
Schlegel, August Wilhelm von: Vergleichung der Phädra des Racine mit der des Euripides [Ü: Heinrich Joseph von Collin]
5
Schlegel, August Wilhelm von: (Vers français)
1
Schlegel, August Wilhelm von: Verzeichniß von Kotzebueʼs Schauspielen
1
Schlegel, August Wilhelm von: Viro clarissimo Ioanni Friederico Blumenbach
6
Schlegel, August Wilhelm von: Vorläufiger Entwurf einer neuen Ausgabe der Werke Friedrichs des Großen
1
Schlegel, August Wilhelm von: Vorlesungen über das akademische Studium (Bonn WS 1819/20)
2
Schlegel, August Wilhelm von: Vorlesungen über die neuere Geschichte der deutschen Litteratur (WS 1840/41)
2
Schlegel, August Wilhelm von: Vorlesungen über die romantische Poesie. In: Vorlesungen über schöne Literatur und Kunst (Berlin 1801–1804)
1
Schlegel, August Wilhelm von: Vorlesungen über Encyclopädie der Wissenschaften (Jena 1803)
3
Schlegel, August Wilhelm von: Vorlesungen über philosophische Kunstlehre (Jena SS 1799)
2
Schlegel, August Wilhelm von: Vorlesungen über philosophische Kunstlehre (Jena WS 1798/99)
7
Schlegel, August Wilhelm von: Vorlesungen über schöne Literatur und Kunst (Berlin 1801–1804) (Ankündigung)
1
Schlegel, August Wilhelm von: Vorlesungen über Theorie und Geschichte der bildenden Künste (Berlin 1827)
24
Schlegel, August Wilhelm von: (Vorrede?)
1
Schlegel, August Wilhelm von: Vorrede des Herausgebers. In: Fichte, Johann Gottlieb: Friedrich Nicolaiʼs Leben und sonderbare Meinungen. Hg. v. August Wilhelm von Schlegel
1
Schlegel, August Wilhelm von: Vorrede zu: A. W. v. S.: Ramayana id est carmen epicum de Ramae rebus gestis poetae antiquissimi Valmicis opus
12
Schlegel, August Wilhelm von: Vorrede zu: Bohte, Johann Heinrich: Handbibliothek der deutschen Literatur
14
Schlegel, August Wilhelm von: Vorrede zu: Essais littéraires et historiques
3
Schlegel, August Wilhelm von: Vorrede zu „Flore und Blanscheflur“ von Sophie Bernhardi
9
Schlegel, August Wilhelm von: Vorrede zum zweiten Theil einer Römischen Geschichte
1
Schlegel, August Wilhelm von: Vorrede zu: Prichard, James Cowles: Darstellung der Aegyptischen Mythologie verbunden mit einer kritischen Untersuchung der Überbleibsel der ägyptischen Chronologie. Ü: L. Haymann
12
Schlegel, August Wilhelm von: Vorrede zu: Schlegel, August Wilhelm von, Lassen, Christian: Hitopadesas id est Institutio salutaris
10
Schlegel, August Wilhelm von: Voß, Johann Heinrich: Musenalmanach für das Jahr 1796 und 1797 (Rezension)
1
Schlegel, August Wilhelm von: Voyage sur la scene des six derniers livres de lʼÉinéide (Rezension)
1
Schlegel, August Wilhelm von: Walpole, Horace: Historische, litterarische und unterhaltenden Schriften. Ü: August Wilhelm von Schlegel (Ankündigung)
2
Schlegel, August Wilhelm von: Wettgesang dreier Poeten
9
Schlegel, August Wilhelm von: Wilsons Wörterbuch
2
Schlegel, August Wilhelm von: Winckelmann, Johann Joachim: Werke (Rezension)
20
Schlegel, August Wilhelm von: Zueignung des Trauerspiels Romeo und Julia
13
Schlegel, August Wilhelm von: Zu Goethe’s Geburtsfeier am 28sten August 1829
1
Schlegel, August Wilhelm von: Zur Geschichte des Elephanten
5
Schlegel, August Wilhelm von: Zustand der Litteratur bei den übrigen gebildete Nationen. Zustand der schönen Künste. Uebergang zur Charaktersitik des Zeitalters überhaupt [...]. In: Vorlesungen über schöne Literatur und Kunst (Berlin 1801–1804)
1
Schlegel, August Wilhelm von: Zuversicht
1
Schlegel, Christian: Kurze Lebensbeschreibungen der Superintendenten in Dresden
1
Schlegel, Dorothea von: Florentin. Bd. 2 (nicht erschienen)
2
Schlegel, Dorothea von: Geschichte des Zauberers Merlin
8
Schlegel, Dorothea von: Lothaire et Maller [Ü: Matthias Albrecht de Staël-Holstein]
2
Schlegel, Dorothea von: Lother und Maller eine Rittergeschichte
10
Schlegel, Dorothea von: Ramdohr, Friedrich Wilhelm Basilius von: Moralische Erzählungen (Rezension)
2
Schlegel, Dorothea von; Schlegel, Friedrich von: Primaleone
7
Schlegel, Friedrich von: 119. Lyceums-Fragment
1
Schlegel, Friedrich von: Abendröte
11
Schlegel, Friedrich von: Altdeutsch
1
Schlegel, Friedrich von: Alte Gedichte aus dem Spanischen
6
Schlegel, Friedrich von: Am Rheine
2
Schlegel, Friedrich von: An A. W. Schlegel
3
Schlegel, Friedrich von: An Camoëns
1
Schlegel, Friedrich von: An den Herausgeber Deutschlands, Schillers Musenalmanach betreffend
3
Schlegel, Friedrich von: An denselben (L. F. Huber)
3
Schlegel, Friedrich von: An Heliodora
1
Schlegel, Friedrich von: An Ludwig Tieck
3
Schlegel, Friedrich von: Anmerkung zu einer Rezension der Jacobischen Schriften im XIV. Bande des Hermes
1
Schlegel, Friedrich von: An Ritter
1
Schlegel, Friedrich von: An seinen Freund
1
Schlegel, Friedrich von: Athenaeums-Fragment Nr. 125
1
Schlegel, Friedrich von: Athenaeums-Fragment Nr. 220
1
Schlegel, Friedrich von: Athenaeums-Fragment Nr. 238
1
Schlegel, Friedrich von: Athenaeums-Fragment Nr. 281
1
Schlegel, Friedrich von: Athenaeums-Fragment Nr. 304
1
Schlegel, Friedrich von: Athenaeums-Fragment Nr. 383
5
Schlegel, Friedrich von: Athenaeums-Fragment Nr. 418
1
Schlegel, Friedrich von: Athenaeums-Fragment Nr. 421
2
Schlegel, Friedrich von: Athenaeums-Fragment Nr. 65
1
Schlegel, Friedrich von: Auszug aus dem Roman Ogier der Däne, Herzog von Dänemark
1
Schlegel, Friedrich von: Beiträge zur Geschichte der modernen Poesie und Nachricht von provenzalischen Manuscripten
2
Schlegel, Friedrich von: Beschreibung von Kölln
1
Schlegel, Friedrich von: Bitte
3
Schlegel, Friedrich von: Briefe auf einer Reise durch die Niederlande, Rheingegenden, die Schweiz, und einen Theil von Frankreich
4
Schlegel, Friedrich von: Briefe über die Kunst
3
Schlegel, Friedrich von: Calderone
1
Schlegel, Friedrich von: Cäsar und Alexander
6
Schlegel, Friedrich von: Condorcet, Jean Antoine Nicolas de Caritat de: Esquisse dʼun tableau historique des progrès de lʼesprit humain (Rezension)
1
Schlegel, Friedrich von: Coxe, William: History of the House of Austria (Rezension)
1
Schlegel, Friedrich von: Das Athenaeum
1
Schlegel, Friedrich von: Das Ideal
5
Schlegel, Friedrich von: Das klare Geheimnis
1
Schlegel, Friedrich von: Das Rätsel der Liebe
1
Schlegel, Friedrich von: Das tragische Schicksal
1
Schlegel, Friedrich von: De Platone
2
Schlegel, Friedrich von: Der Consul
1
Schlegel, Friedrich von: Der Epitaphios des Lysias
8
Schlegel, Friedrich von: Der Wanderer
1
Schlegel, Friedrich von: Der welke Kranz
4
Schlegel, Friedrich von: Des Vaters Abschied
2
Schlegel, Friedrich von: (Deutsche Geschichte)
3
Schlegel, Friedrich von: Die drei Weltalter
4
Schlegel, Friedrich von: Die Griechen und Römer
35
Schlegel, Friedrich von: Die Werke des Dichters
1
Schlegel, Friedrich von: Die Zwerge
1
Schlegel, Friedrich von: Dritter Nachtrag alter Gemälde
1
Schlegel, Friedrich von: (Eine philosophische Privatvorlesung für Frau von Staël)
1
Schlegel, Friedrich von: (Einführung in die idealistische Metaphysik)
1
Schlegel, Friedrich von: Ein Lied des Heinrich von Veldeck
1
Schlegel, Friedrich von: Eisenfeile
1
Schlegel, Friedrich von: Essai sur la langue et la philosophie des Indiens [Ü: P. Adolphe Mazure]
4
Schlegel, Friedrich von: Eulenspiegels guter Rat
1
Schlegel, Friedrich von: Fantasie
2
Schlegel, Friedrich von: Fichte, Johann Gottlieb: Über das Wesen des Gelehrten; Die Grundzüge des gegenwärtigen Zeitalters; Die Anweisung zum seligen Leben (Rezension)
2
Schlegel, Friedrich von: Forster, Georg: Schriften (Rezension)
2
Schlegel, Friedrich von: Fragmente zur Literatur und Poesie
1
Schlegel, Friedrich von: Für Fichte
6
Schlegel, Friedrich von: Gedichte
41
Schlegel, Friedrich von: Gedichte (1809)
5
Schlegel, Friedrich von: Gelübde
3
Schlegel, Friedrich von: Georg Forster
1
Schlegel, Friedrich von: Gern flieht der Geist
2
Schlegel, Friedrich von: Gesang der Erinnerung
2
Schlegel, Friedrich von: Geschichte der alten und neueren Literatur (Wiener Vorlesungen 1812)
17
Schlegel, Friedrich von: Geschichte der Litteratur (Kölner Vorlesungen 28. Juni bis 18. September 1804)
1
Schlegel, Friedrich von: Geschichte der Litteratur (Pariser Vorlesungen 25. November 1803 bis 11. April 1804)
1
Schlegel, Friedrich von: (Geschichte der Philosophie)
1
Schlegel, Friedrich von: Geschichte von Österreich
5
Schlegel, Friedrich von: Goethes Werke. Erster bis Vierter Band (Rezension)
2
Schlegel, Friedrich von: Göthe (Goethe, Johann Wolfgang von)
2
Schlegel, Friedrich von: Griechisch
1
Schlegel, Friedrich von: Grundzüge der gotischen Baukunst
3
Schlegel, Friedrich von: Grundzüge der gotischen Baukunst (Rezension)
1
Schlegel, Friedrich von: Gute Zeichen
2
Schlegel, Friedrich von: Herkules Musagetes
11
Schlegel, Friedrich von (Hg.): Vermischte Gedichte
1
Schlegel, Friedrich von: Historische Ansichten der Philosophie
13
Schlegel, Friedrich von: Homo
1
Schlegel, Friedrich von: Hormayrs Taschenbuch für die vaterländische Geschichte (Rezension)
2
Schlegel, Friedrich von: Huldigung
7
Schlegel, Friedrich von: Hymnen
9
Schlegel, Friedrich von: Im Frühlinge
2
Schlegel, Friedrich von: Jacobi, Friedrich Heinrich: Jacobis Woldemar (Rezension)
8
Schlegel, Friedrich von: Jacobi, Friedrich Heinrich: Von den göttlichen Dingen und ihrer Offenbarung (Rezension)
2
Schlegel, Friedrich von: Karl V.
38
Schlegel, Friedrich von: Klage
1
Schlegel, Friedrich von: Klagen der Maria
1
Schlegel, Friedrich von: Kritische Fragmente
2
Schlegel, Friedrich von: Kunst-Orakel
2
Schlegel, Friedrich von: Kunsturteil des Dionysios über den Isokrates
1
Schlegel, Friedrich von: Laß edlen Mut
2
Schlegel, Friedrich von: Lessings Gedanken und Meinungen
9
Schlegel, Friedrich von: Lessings Gedanken und Meinungen aus dessen Schriften zusammengestellt u. erläutert. Bd. 3
1
Schlegel, Friedrich von: Lied
1
Schlegel, Friedrich von: Lied (Teil von: Schlegel, Friedrich von: Alte Gedichte aus dem Spanischen)
1
Schlegel, Friedrich von: Literarische Anfrage
1
Schlegel, Friedrich von: Lob der Frauen
1
Schlegel, Friedrich von: Mahomets Flucht
2
Schlegel, Friedrich von: Nachricht von den poetischen Werken des Johannes Boccaccio
11
Schlegel, Friedrich von: Nachtrag italiänischer Gemälde
1
Schlegel, Friedrich von: Notizhefte
3
Schlegel, Friedrich von: Persische Grammatik
1
Schlegel, Friedrich von: Philosophie der Geschichte (Wiener Vorlesungen 1828)
1
Schlegel, Friedrich von: Philosophische Lehrjahre
2
Schlegel, Friedrich von: Philosophisches Journal (Rezension)
3
Schlegel, Friedrich von: Philosophische Vorlesungen insbesondere über Philosophie der Sprache und des Wortes (Dresden 1828/1829)
5
Schlegel, Friedrich von: Philosophische Vorlesungen (Köln 1804‒1806)
9
Schlegel, Friedrich von: Proben der neuesten Poesie
1
Schlegel, Friedrich von: Provenzalische Gedichte
1
Schlegel, Friedrich von: P. Terentii Afri commoediae. Novae editionis specimen proposuit Carl Aug. Böttiger (Rezension)
1
Schlegel, Friedrich von: Reise nach Frankreich
1
Schlegel, Friedrich von: Rezensionen
6
Schlegel, Friedrich von: Rhode, Johann Gottlieb: Über den Anfang unserer Geschichte und die letzte Revolution der Erde (Rezension)
4
Schlegel, Friedrich von: Roland. Ein Heldengedicht in Romanzen nach Turpins Chronik
9
Schlegel, Friedrich von: Romanze vom Licht
7
Schlegel, Friedrich von: Rückkehr des Gefangenen
6
Schlegel, Friedrich von: Sämmtliche Werke
7
Schlegel, Friedrich von: Sämmtliche Werke. 1. Bd.: Gedichte
1
Schlegel, Friedrich von: Sämmtliche Werke (Plan von Dorothea von Schlegel)
6
Schlegel, Friedrich von: Schiller, Friedrich; Goethe, Johann Wolfgang von: Musen-Almanach auf das Jahr 1797 (Xenien-Almanach) (Rezension)
1
Schlegel, Friedrich von: Schillers Horen. 1796, 7. Stück (Rezension)
5
Schlegel, Friedrich von: Schillers Musenalmanach für 1796 (Rezension)
5
Schlegel, Friedrich von: Schleiermachers Reden über die Religion
2
Schlegel, Friedrich von: Sinnbild
2
Schlegel, Friedrich von: Sophokles
4
Schlegel, Friedrich von: Spanisch
1
Schlegel, Friedrich von: Sprüche aus dem Indischen
1
Schlegel, Friedrich von: Stimmen der Liebe
1
Schlegel, Friedrich von: Stolberg-Stolberg, Friedrich Leopold zu: Geschichte der Religion Jesu Christi (Rezension)
5
Schlegel, Friedrich von: Trutznachtigall
4
Schlegel, Friedrich von: Über antiken und modernen Republikanismus
2
Schlegel, Friedrich von: (Über das Gute und das Böse)
2
Schlegel, Friedrich von: Über das Studium der Geschichte
2
Schlegel, Friedrich von: Über das Verhältnis der modernen zur antiken Bildung
3
Schlegel, Friedrich von: Über die deutsche Kunstausstellung zu Rom
1
Schlegel, Friedrich von: Über die Diotima
11
Schlegel, Friedrich von: Über die Diotima (Vorarbeit)
4
Schlegel, Friedrich von: Über die Grenzen des Schönen
6
Schlegel, Friedrich von: Über die griechische Tragödie
5
Schlegel, Friedrich von: Über die Homerische Poesie
3
Schlegel, Friedrich von: Über die neuere Geschichte (Wiener Vorlesungen 1810)
40
Schlegel, Friedrich von: Über die Pariser Kunstausstellung vom Jahre XI
1
Schlegel, Friedrich von: Über die Prinzipien der Schriftstellerei
1
Schlegel, Friedrich von: Über die Unverständlichkeit
8
Schlegel, Friedrich von: Über die weiblichen Charaktere in den griechischen Dichtern
3
Schlegel, Friedrich von: Über Goethes Meister
29
Schlegel, Friedrich von: Über Hormayrs österreichischen Plutarch (Rezension)
1
Schlegel, Friedrich von: Über Lessing
24
Schlegel, Friedrich von: Über nordische Dichtkunst
1
Schlegel, Friedrich von: Über Opitz
3
Schlegel, Friedrich von: Über Shakspeare
3
Schlegel, Friedrich von: Über Winckelmann
2
Schlegel, Friedrich von: Ueber die Philosophie
8
Schlegel, Friedrich von: Universalgeschichte. Vorlesungen
1
Schlegel, Friedrich von: Unsere Zeit
1
Schlegel, Friedrich von: Versuch über den Begriff des Republikanismus
5
Schlegel, Friedrich von: Vom Leiden Christi
1
Schlegel, Friedrich von: Vom Raffael
1
Schlegel, Friedrich von: Vom Verhältnis der Philosophie zur Physik
1
Schlegel, Friedrich von: Vom Wert des Studiums der Griechen und Römer
6
Schlegel, Friedrich von: Von den Verhältnissen der griechischen Poesie
1
Schlegel, Friedrich von: Von den Zeitaltern, Schulen und Stilen der Griechischen Poesie
3
Schlegel, Friedrich von: Von der Schönheit in der Dichtkunst (Notizen)
1
Schlegel, Friedrich von: Vorlesungen
1
Schlegel, Friedrich von: Vorlesungen über die deutsche Wissenschaft und Literatur von Adam H. Müller (Rezension)
2
Schlegel, Friedrich von: Vorlesungen über Transzendentalphilosophie (Jena, 1800)
10
Schlegel, Friedrich von: (Vorlesungen zur Logik, 1805/06)
5
Schlegel, Friedrich von: (Vorlesungen zur Philosophie, 1805/06)
6
Schlegel, Friedrich von: Werke
18
Schlegel, Friedrich von: Zerbino
1
Schlegel, Friedrich von: Zur Philologie
1
Schlegel, Friedrich von: Zur Physik
1
Schlegel, Friedrich von: Zur Theologie und Philosophie
1
Schlegel, Friedrich von: Zweiter Nachtrag alter Gemälde
1
Schlegel, Johan F. W.: (Dissertation)
1
Schlegel, Johann Carl Fürchtegott: (Aufsatz gegen Schillers Rezension „Ueber Bürgers Gedichte“)
3
Schlegel, Johann Carl Fürchtegott: Churhannöversches Kirchenrecht
3
Schlegel, Johann Carl Fürchtegott: Kirchen- und Reformationsgeschichte von Norddeutschland und den Hannöverischen Staaten
5
Schlegel, Johann Carl Fürchtegott: Ueber Ehescheidung, besonders die Ehescheidung durch landesherrliche Dispensation
3
Schlegel, Johann Elias: Werke
2
Schlegel, Karl August Moritz: August Wilhelm und Friedrich Schlegel
1
Schlegel, Karl August Moritz: Biblische Predigten über Gegenstände des Privat- und Familienlebens
1
(Schlegel, Karl August Moritz et al:) Johann Adolf Schlegel
5
Schlegel, Karl August Moritz: Populäre Betrachtungen über Religion, natürliche Gotteserkenntniss, Offenbarung und Christenthum
5
Schlegel, Karl August Moritz: Reformations-Jubelpredigten
1
Schlegel, Karl August: Versuch einer militärischen Geographie des Carnatiks
2
Schleiermacher, Friedrich: Anthropologie von Immanuel Kant
5
Schleiermacher, Friedrich: Athenaeums-Fragmente
1
Schleiermacher, Friedrich: Athenaeums-Fragment Nr. 364
1
Schleiermacher, Friedrich: Athenaeums-Fragment Nr. 371
1
Schleiermacher, Friedrich: Die Weihnachtsfeyer
2
Schleiermacher, Friedrich: Engels Philosoph für die Welt
12
Schleiermacher, Friedrich: Fichte, Johann Gottlieb: Die Bestimmung des Menschen (Rezension)
16
Schleiermacher, Friedrich: Garve’s letzte noch von ihm selbst herausgegebene Schriften
11
Schleiermacher, Friedrich: Gelegentliche Gedanken über Universitäten in Deutschem Sinn
2
Schleiermacher, Friedrich: Herakleitos (Heraclitus (Ephesius)) von Ephesos
3
Schleiermacher, Friedrich: Lichtenberg, Georg Christoph: Vermischte Schriften (Rezension)
2
Schleiermacher, Friedrich: Predigten
1
Schleiermacher, Friedrich: Predigten. Zweite Sammlung
1
Schleiermacher, Friedrich: Schelling, Friedrich Wilhelm Joseph von: Vorlesungen über die Methode des academischen Studium (Rezension)
1
Schleiermacher, Friedrich: Über das Anständige
1
Schleiermacher, Friedrich: Vertraute Briefe über Friedrich Schlegels Lucinde
5
Schlosser, Friedrich Christoph: Weltgeschichte in zusammenhängender Erzählung
1
Schlosser, Johann Georg: Zweites Schreiben an einen jungen Mann, der die kritische Philosophie studieren wollte
2
Schlözer, August Ludwig von: Allgemeine nordische Geschichte
1
Schlözer, August Ludwig von: Michaelis und Reiske
2
Schmeller, Johann Andreas (Hg.): Heliand oder die altsächsische Evangelien-Harmonie
1
Schmid, Nicolaus Ehrenreich Anton: Von den Weltkörpern
1
Schmidt, Johann Adam: Lehrbuch von der Methode, Arzneyformeln zu verfassen
1
Schmidt, Klamer Eberhard Karl: Gute Nacht!
1
Schmidt, Michael Ignaz: Geschichte der Deutschen
1
Schmiedt, Siegfried: Vertonung von August Wilhelm von Schlegels Gedicht „Die verfehlte Stunde“
1
Schmittmann, Johannes Hermann Joseph: Dramen
1
Schmölders, Franz August: Documenta philosophiae arabum, ex codd. mss. primus edidit latine vertit, commentario illustravit Augustus Schmoelders
1
Schmölders, Franz August: Essai sur les écoles philosophiques chez les Arabes et notamment sur la doctrine d’Algazzali
4
Schneider, Gottlieb Carl Wilhelm: Das Attisches Theaterwesen
1
Schneider, Johann Gottlob: Kritisches griechisch-deutsches Handwörterbuch
1
Schneider, Louis: Eine Sängerin unter Friedrich dem Großen
1
Schnezler, August: Gedichte
1
Schnorr von Carolsfeld, Julius: Zeichnung von Caroline Amalie von Schleswig-Holstein-Sonderburg-Augustenburg
1
Schoell, Friedrich: Répertoire de la littérature ancienne
1
Schönlein, Johann Lukas: Vorlesungen
1
Schopen, Ludwig: Werke
2
Schreiber, Alois Wilhelm: An A.W. Schlegel
1
Schreiber, Alois Wilhelm: Comoedia divina mit drey Vorreden von Peter Hammer, Jean Paul und dem Herausgeber
1
Schröder, Friedrich Ludwig: Der erste Eindruck
1
Schröder, Friedrich Ludwig: Der Schneider und sein Sohn oder Mittel gegen Herzweh
1
Schröder, Friedrich Ludwig: Der Vetter in Lissabon
1
Schröder, Friedrich Ludwig: Hamburgisches Theater IV
1
Schubart, Christian Friedrich Daniel: Der ewige Jude
1
Schubert, Gotthilf Heinrich von: Ahndungen einer allgemeinen Geschichte des Lebens
1
Schubert, Gotthilf Heinrich von: Ansichten von der Nachtseite der Naturwissenschaft
3
Schubert, Gotthilf Heinrich von: Bibliotheca castellana portuguos y proenzal
1
Schubert, Gotthilf Heinrich von: El poema del Cid
1
Schubert, Gotthilf Heinrich von: Schriften
1
Schulting, Anton: Jurisprudentia Vetus Ante-Justinianea
1
Schulze, Friedrich August: Der Mann auf Freiers Füßen
1
Schulze, Friedrich August: Der Streit für das Heilige
2
Schulze, Friedrich August: (Sonnette)
1
Schulz, Friedrich Eduard: Aperçu d’un Mémoire sur la traduction persanne de Mahabharata
1
Schulz, Friedrich: Leopoldine
1
Schulz, Friedrich: Moriz
1
Schütz, Christian Gotfried: Fortgesetzte Vertheidigung gegen Hn. Prof. Schelling’s sehr unlautere Erläuterungen über die A.L.Z.
1
Schütz, Christian Gottfried: Aeschylus: Tragoediae
1
Schütz, Christian Gottfried, (August Wilhelm von Schlegel): Shakespeare, William: Dramatische Werke. Erster Theil (1797). Ü: August Wilhelm von Schlegel (Rezension)
1
Schütz, Christian Gottfried: Garve, Christian: Versuche über verschiedene Gegenstände aus der Moral, der Litteratur und dem gesellschaftlichen Leben (Rezension)
1
Schütz, Christian Gottfried: Species facti nebst Actenstücken zum Beweise, daß Herr Rath A. W. Schlegel [...] mit seiner Rüge, worinnen er der A. L. Z. eine begangne Ehrenschändung fälschlich aufbürdet, niemanden als sich selbst beschimpft habe
6
Schütz, Christian Gottfried: Vertheidigung gegen Hn. Prof. Schellings sehr unlautere Erläuterungen über die A. L. Z.
5
Schütz, Karl: Fünf Gesänge des Bhatti-Kâvya
1
Schütz, Karl: Kritische und erklärende Anmerkungen zu der von Herrn Professor von Bohlen besorgten Ausgabe des Chaurapañcāśikā und Bhartṛharis
2
Schütz, Karl: The Mahábhárata: an epic poem, written by the celebrated Veda Vyása Rishi (1834–39); Milman, Henry Hart: Nala and Damayanti and other poems translated from the Sanscrit into English verse [...] (Rezension) (ALZ, 1838)
1
Schütz, Wilhelm von: Der Graf und die Gräfin von Gleichen
5
Schütz, Wilhelm von: Der Kamaldulenser
4
Schütz, Wilhelm von: Der Raub der Proserpina
1
Schütz, Wilhelm von: Die Tänzer
4
Schütz, Wilhelm von: Gedichte
1
Schütz, Wilhelm von: Lacrimas
14
Schütz, Wilhelm von: Niobe
9
Schütz, Wilhelm von: Romantische Wälder
1
Schütz, Wilhelm von: Romanze
1
Schütz, Wilhelm von: Werke
1
Schütz, Wilhelm von: Wonne der Nacht
2
Schütz, Wilhelm von: Zauberey der Nacht
2
Schwabe, Johann Gottlob Samuel: Phaedri Augusti Liberti Fabularum Aesopiarum
1
Schwab, Johann Christoph: Dissertation sur les causes de l'universalité de la langue françoise et la durée vraisemblable de son empire
1
Schwarz, Herr (Maler): Kopie des Bildnisses von Auguste Böhmer
1
Schwenck, Johann Konrad: Das zehnte Buch der Odysee metrisch übersetzt
1
Schwenck, Johann Konrad: Etymologisch-mythologische Andeutungen
2
Scott, Jonathan: The Arabian Nights Entertainements
1
Scott, Walter: Der Abt. Eine Fortsetzung des Klosters [Ü: Hieronymus Müller]
1
Scriptores rerum Hungaricarum veteres ac genuini
1
Seeger, Ludwig: Aristophanes
1
Segers, Josef Christian: Anleitung zum Hiebfechten mit Korb-Rappier, Säbel und Pallasch
1
Senebier, Jean: Catalogue raisonné des manuscrits [...] de Genève
2
Seneca, Lucius Annaeus: Tragoediae
1
Sepúlveda, Juan Ginés de: Historiae Caroli V. imperatoris libri XXX
3
Seyffarth, Gustav: Rudimenta Hieroglyphices
1
Shakespeare, William: Alt-Englisches Theater [Ü: Ludwig Tieck]
7
Shakespeare, William: Comedies, Histories and Tragedies
3
Shakespeare, William: Coriolan [Ü: Heinrich Voß]
1
Shakespeare, William: Cymbeline [Ü: Abraham Voß]
2
Shakespeare, William: Cymbeline [Ü: Georg Wilhelm Kessler]
6
Shakespeare, William: Cymbeline [Ü: Johann Joachim Eschenburg]
2
Shakespeare, William: Der Kaufmann von Venedig [Ü: August Wilhelm von Schlegel]
9
Shakespeare, William: Der Sturm [Ü: August Wilhelm von Schlegel]
11
Shakespeare, William: Der Sturm [Ü: Johann Joachim Eschenburg]
2
Shakespeare, William: Die beiden Veroneser [Ü: Abraham Voß]
1
Shakespeare, William: Die Komödie der Irrungen [Ü: Ein Sohn Georg Andreas Reimers]
1
Shakespeare, William: Die lustigen Weiber von Windsor [Ü: Hans Carl Dippoldt]
1
Shakespeare, William: Die lustigen Weiber zu Windsor [Ü: Johann Joachim Eschenburg]
2
Shakespeare, William: Dramatische Werke. Achter Theil [Ü: August Wilhelm von Schlegel]
25
Shakespeare, William: Dramatische Werke. Fünfter Theil [Ü: August Wilhelm von Schlegel]
16
Shakespeare, William: Dramatische Werke. Neunter Theil [Ü: August Wilhelm von Schlegel]
57
Shakespeare, William: Dramatische Werke. Sechster Theil [Ü: August Wilhelm von Schlegel]
22
Shakespeare, William: Dramatische Werke. Siebter Theil [Ü: August Wilhelm von Schlegel]
21
Shakespeare, William: Dramatische Werke [Ü: August Wilhelm von Schlegel]
266
Shakespeare, William: Dramatische Werke [Ü: August Wilhelm von Schlegel, ergänzt und erläutert von Ludwig Tieck]
39
Shakespeare, William: Dramatische Werke [Ü: August Wilhelm von Schlegel, ergänzt und erläutert von Ludwig Tieck] Bd. 1
1
Shakespeare, William: Dramatische Werke [Ü: August Wilhelm von Schlegel, Ludwig Tieck]
2
Shakespeare, William: Dramatische Werke [Ü: August Wilhelm von Schlegel, Ludwig Tieck] Bd. 4
1
Shakespeare, William: Dramatische Werke [Ü: August Wilhelm von Schlegel, Ludwig Tieck] (Dritte Auflage 1839ff.)
18
Shakespeare, William: Dramatische Werke [Ü: Johann Wilhelm Otto Benda]
4
Shakespeare, William: Dramatische Werke [Ü: Philipp Kaufmann]
1
Shakespeare, William: Dramatische Werke. Vierter Theil [Ü: August Wilhelm von Schlegel]
23
Shakespeare, William: Dramen
5
Shakespeare, William: Ein Sommernachtstraum [Ü: August Wilhelm von Schlegel]
19
Shakespeare, William: Ein St. Johannis Nachts-Traum [Ü: Christoph Martin Wieland]
1
Shakespeare, William: Ein Wintermährchen [Ü: L. Krause]
3
Shakespeare, William: Ende gut, alles gut [Ü: Georg Wilhelm Kessler]
6
Shakespeare, William: Hamlet für das deutsche Theater bearbeitet [Ü: Friedrich Karl Julius Schütz]
7
Shakespeare, William: Hamlet, Prinz von Dänemark [Ü: August Wilhelm von Schlegel]
33
Shakespeare, William: Heinrich VIII. [Ü: August Wilhelm von Schlegel] (Bruchstück)
19
Shakespeare, William: Heinrich VIII. [Ü: August Wilhelm von Schlegel, Ludwig Tieck]
2
Shakespeare, William: Heinrich VIII. [Ü: Wolf Heinrich von Baudissin]
3
Shakespeare, William: Historiendramen
5
Shakespeare, William: Julius Cäsar [Ü: August Wilhelm von Schlegel]
24
Shakespeare, William: König Heinrich der Fünfte [Ü: August Wilhelm von Schlegel]
7
Shakespeare, William: König Heinrich der Sechste [Ü: August Wilhelm von Schlegel]
10
Shakespeare, William: König Heinrich der Vierte [Ü: August Wilhelm von Schlegel]
17
Shakespeare, William: König Johann [Ü: August Wilhelm von Schlegel]
18
Shakespeare, William: König Johann von Engelland [Ü: Ludwig Tieck]
6
Shakespeare, William: König Lear [Ü: Heinrich Voß]
10
Shakespeare, William: König Lear [Ü: Johann Joachim Eschenburg]
1
Shakespeare, William: König Richard der dritte [Ü: August Wilhelm von Schlegel]
33
Shakespeare, William: König Richard der zweyte [Ü: August Wilhelm von Schlegel]
14
Shakespeare, William: König Richard III. [Ü: Georg Wilhelm Kessler]
1
Shakespeare, William: Liebes Leid und Lust [Ü: Wolf Heinrich von Baudissin, August Wilhelm von Schlegel und Ludwig Tieck (?)]
8
Shakespeare, William: Macbeth [...] eingerichtet von Friedrich Schiller
8
Shakespeare, William: Macbeth [Ü: Dorothea Tieck]
4
Shakespeare, William: Macbeth [Ü: Gottfried August Bürger]
4
Shakespeare, William: Macbeth [Ü: Heinrich Leopold Wagner]
1
Shakespeare, William: Macbeth [Ü: Heinrich Voß]
4
Shakespeare, William: Macbeth [Ü: Johann Joachim Eschenburg]
2
Shakespeare, William: Macbeth [Ü: Philipp Kaufmann]
1
Shakespeare, William: Macbeth [Ü: W. Möller]
2
Shakespeare, William: Oeuvres complètes. Précédée dʼune notice biographie et littéraire sur Shakespeare [Ü: François Guizot]
2
Shakespeare, William: Othello [Ü: Heinrich Voß]
13
Shakespeare, William: Richard III. [Ü: August Wilhelm von Schlegel]
2
Shakespeare, William: Richard II. [Ü: Ludwig Tieck]
3
Shakespeare, William: Romeo und Julia [Ü: August Wilhelm von Schlegel]
30
Shakespeare, William: Sämmtliche dramatische Werke und Gedichte
2
Shakespeare, William: Sämtliche Schauspiele
2
Shakespeare, William: Schauspiele. Bd. II [Ü: Abraham Voß, Heinrich Voß]
1
Shakespeare, William: Schauspiele. Bd. I [Ü: Abraham Voß, Heinrich Voß]
3
Shakespeare, William: Schauspiele. Bd. IX 1 [Ü: Johann Heinrich Voß, Abraham Voß, Heinrich Voß]
1
Shakespeare, William: Schauspiele in 8 Bänden [Ü: Adelbert Keller, Moritz Rapp]
2
Shakespeare, William: Schauspiele [Ü: Abraham Voß, Heinrich Voß]
5
Shakespeare, William: Schauspiele [Ü: Abraham Voß, Heinrich Voß, Johann Heinrich Voß]
7
Shakespeare, William: Schauspiele [Ü: Johann Joachim Eschenburg]
10
Shakespeare, William: Schauspiele [Ü: Johann Joachim Eschenburg]
11
Shakespeare, William: (Spurious Plays)
2
Shakespeare, William: Theatralische Werke [Ü: Christoph Martin Wieland]
3
Shakespeare, William: The Dramatic Works (Hg.: Karl Franz Christian Wagner)
3
Shakespeare, William: The Dramatic Works of Shakespeare
1
Shakespeare, William: The Plays
4
Shakespeare, William: The Plays. From the Text of Samuel Johnson
1
Shakespeare, William: The Works of Shakespeare with the Corrections and Illustrations of Various Commentators
3
Shakespeare, William: Titus Andronikus [Ü: Johann Joachim Eschenburg]
1
Shakespeare, William: Twenty of the Plays of Shakespeare
3
Shakespeare, William: Viel Lärmens um Nichts [Ü: Georg Wilhelm Kessler]
3
Shakespeare, William: Vier Schauspiele [Ü: Ludwig Tieck]
3
Shakespeare, William: Von Schlegel noch unübersetzte dramatische Werke. 3. Bd. 1. Hälfte [Ü: Hans Carl Dippoldt]
1
Shakespeare, William: Von Schlegel noch unübersetzte dramatische Werke. Bd. 1 [Ü: Georg Wilhelm Kessler, L. Krause]
1
Shakespeare, William: Von Schlegel noch unübersetzte dramatische Werke. Bd. 2 [Ü: Georg Wilhelm Kessler, L. Krause]
3
Shakespeare, William: Von Schlegel noch unübersetzte dramatische Werke [Ü: Georg Wilhelm Kessler, L. Krause]
6
Shakespeare, William: Von Schlegel noch unübersetzte dramatische Werke [Ü: Georg Wilhelm Kessler, L. Krause] (Rezension)
1
Shakespeare, William: Was ihr wollt [Ü: August Wilhelm von Schlegel]
15
Shakespeare, William: Wie es euch gefällt [Ü: August Wilhelm von Schlegel, Caroline von Schelling]
8
Shakespeare, William: Zwei Veroneser [Ü: Johann Joachim Eschenburg]
2
Sheridan, Richard Brinsley: Pizarro a Tragedy taken from the German Drama of Kotzebue [...]
1
Sheridan, Richard Brinsley: The School for Scandal
1
S. Hieronymi epistola
1
Šilling, Pavel L.: Werke
1
Silverstolpe, Gustaf Abraham: Werke
1
Sinclair, Isaak von: Das Ende des Cevennenkrieges
1
Sinhasana Dvatrinsati
1
Širwānī, Aḥmad Ibn-Muḥammad aš-: The Arabian Nights Entertainments in the Original Arabic (Calcutta 1814, 1818)
1
Sismondi, Jean-Charles-Léonard Simonde de: De la littérature du midi de l’Europe
4
Sismondi, Jean-Charles-Léonard Simonde de: De la richesse commerciale, ou principes dʼéconomie politique, appliqués à la législation du commerce
3
Sismondi, Jean-Charles-Léonard Simonde de: Geschichte der italienischen Freistaaten im Mittelalter
1
Sismondi, Jean-Charles-Léonard Simonde de: Histoire des républiques italiennes du moyen âge
4
Sismondi, Jean-Charles-Léonard Simonde de: Tableau de l’agriculture toscane
2
Smith, Adam: Essai sur la formation des langues
1
Smith, Adam: Essai sur la première formation des langues, suivi du premier livre des Recherches sur la langue et la philosophie des Indiens [Ü: Jacques-Louis Manget]
5
Soden, Julius von: Psyche, über Dasein, Unsterblichkeit und Wiedersehen
1
Sophocles: Dramata quae supersunt rec. Friedrich Heinrich Bothe
1
Sophocles: Tragoediae emend
1
Sophocles: Tragoediae septem ad optimorum exemplarium fidem emendatae cum versione et notis ex editione Richard Franz Philipp Brunck
5
Sophocles: Trauerspiele [Ü: Friedrich Ast]
2
Spalla, Giacomo: Büste der Auguste de Beauharnais von Leuchtenberg
1
Spalla, Giacomo: Büste des Eugène de Beauharnais von Leuchtenberg
1
Spalla, Giacomo: Büste des Maximilian Joseph
1
Spalla, Giacomo: Büste des Napoleon
1
Spangenberg, Ernst Peter Johann: Repetitorium der jetzt gültigen krafthabenden französischen Gesetze
1
Spazier, Johanne Karoline Wilhelmine: Urania auf 1812
1
Spee, Friedrich von: Auserlesene Gedichte
1
Spee, Friedrich von: Klag und Travvergesang der Mutter JESU
1
Spee, Friedrich von: Trutznachtigall
4
Spee, Friedrich von: Trutznachtigall (Poetisch Gedicht von dem hl. Franzisko Xavier der Gesellschaft Jesu)
1
Spinoza, Benedictus de: Opera posthuma, quorum series post Praefationem exhibitur
1
Spinoza, Benedictus: Ethica
1
Spittler, Ludwig Timotheus von: Geschichte Württembergs unter der Regierung der Grafen und Herzoge
1
Spohn, Friedrich August Wilhelm: De lingua et literis veterum Aegyptiorum [...]
2
Sprengel, Matthias Christian: Geschichte der wichtigsten geographischen Entdeckungen
1
Śrīdharasvāmin: Kommentar zur Bhagavadgitā
1
Staegemann, Friedrich August von: Erinnerungen an Elisabeth
1
Staegemann, Friedrich August von: Historische Erinnerungen in lyrischen Gedichten
1
Staël-Holstein, Anne Louise Germaine de: Agar dans le désert
3
Staël-Holstein, Anne Louise Germaine de: Aspasie
1
Staël-Holstein, Anne Louise Germaine de: Bemerkungen auf einer Reise durch Deutschland [Ü: Friedrich von Schlegel]
1
Staël-Holstein, Anne Louise Germaine de: Betrachtungen über den Selbstmord [Ü: Friedrich Gleich]
2
Staël-Holstein, Anne Louise Germaine de: Betrachtungen über die vornehmsten Begebenheiten der Französichen Revolution [Ü: Ludwig Finckh, Johann Jakob Stolz]
23
Staël-Holstein, Anne Louise Germaine de: Considérations sur les principaux événements de la Révolution française, depuis son origine jusques et compris le 8 juillet 1815
37
GND
Staël-Holstein, Anne Louise Germaine de: Corinna oder Italien [Ü: Friedrich von Schlegel, (Dorothea von Schlegel)]
24
Staël-Holstein, Anne Louise Germaine de: De la littérature considérée dans ses rapports avec les institutions sociales
1
GND
Staël-Holstein, Anne Louise Germaine de: De lʼinfluence des passions sur le bonheur des individus et des nations
5
Staël-Holstein, Anne Louise Germaine de: Deutschland [Ü: Friedrich Buchholz, Samuel Heinrich Catel und Julius Eduard Hitzig]
5
Staël-Holstein, Anne Louise Germaine de: La Sunamite
1
Staël-Holstein, Anne Louise Germaine de: Lettera di madama la baronessa di Stael Holstein ai Compilatori della Biblioteca Italiana
1
Staël-Holstein, Anne Louise Germaine de: Lettres sur les ouvrages et le caractère de J. J. Rousseau
1
Staël-Holstein, Anne Louise Germaine de: Manuscrits de Mr. Necker, publiés par sa fille
9
Staël-Holstein, Anne Louise Germaine de: Notice sur le Camoëns
3
Staël-Holstein, Anne Louise Germaine de: Notice sur M. Schlegel
1
Staël-Holstein, Anne Louise Germaine de: Œuvres complètes, précédees dʼune notice sur le caractère et les écrits de Mme de Staël (Hg.: Auguste de Staël-Holstein)
14
Staël-Holstein, Anne Louise Germaine de: Réflexions sur la paix adressées à M. Pitt et aux Français
1
Staël-Holstein, Anne Louise Germaine de: Réflexions sur la paix intérieure
1
Staël-Holstein, Anne Louise Germaine de: Réflexions sur le suicide
7
Staël-Holstein, Anne Louise Germaine de: Richard Löwenherz
1
Staël-Holstein, Anne Louise Germaine de: Sulla maniera e la utilità delle Traduzioni
1
Staël-Holstein, Anne Louise Germaine de: Werke
13
Staël-Holstein, Auguste Louis de: De la Responsabilité des ministres
1
Staël-Holstein, Auguste Louis de: Du nombre et de lʼâge des députés
1
Staël-Holstein, Auguste Louis de: Du Renouvellement intégral de la chambre et des députés
2
Staël-Holstein, Auguste Louis de: Oeuvres diverses de M. le baron Auguste de Staël, précédées d'une notice sur sa vie, et suivies de quelques lettres inédites sur l'Angleterre
3
Staël-Holstein, Auguste Louis de: (Rapport sur les sociétés bibliques de France)
1
Staël-Holstein, Auguste Louis de: (Zeitung/Zeitschrift, Werkplan)
2
Stalder, Franz Joseph: Versuch eines schweizerischen Idiotikon, mit etymologischen Bemerkungen untermischt
2
Stanley, Thomas (Hg.): Aischylu Tragodiai hepta
1
Steffens, Henrik: Beiträge zur inneren Naturgeschichte der Erde
3
Steffens, Henrik: Friedrich Wilhelm Joseph Schelling: System des transcendentalen Idealismus (Rezension)
2
Steffens, Henrik: Geognostisch-geologische Aufsätze als Vorbereitung zu einer innern Naturgeschichte der Erde
1
Steffens, Henrik: Grundzüge der philosophischen Naturwissenschaft
2
Steffens, Henrik: Indledning til filosofiske forelæsninger
1
Steffens, Henrik: Über die neuesten Schellingschen naturphilosophischen Schriften
2
Steffens, Henrik: Über die Vegetation
1
Steffens, Henrik: Werke
1
Stegmann, Josua: Wie schön leuchtʼt uns der Morgenstern!
1
Stettler, Michael: Annales oder gründliche Beschreibung der fürnembsten Geschichten und Thaten [...]
2
Stewart, Charles; An Introduction to the Anvari Soohyly of Hussein Vāiz Kāshify
2
Stewart, Dugald: On the Sublime
1
Stewart, John: The Moral State of Nations, or Travels over the Most Interesting Parts of the Globe, to Discover the Source of Moral Motion
1
Stolberg-Stolberg, Christian zu: Werke
1
Stolberg-Stolberg, Friedrich Leopold zu: Die Gedichte von Ossian
1
Stolberg-Stolberg, Friedrich Leopold zu: Reise in Deutschland, der Schweiz, Italien und Sicilien in den Jahren 1791 und 1792
1
Strange, Thomas Andrew Lumisden: Hindu Law
1
Stricker, Der: Rhythmus antiquus germanicus de Caroli Magni Expeditione Hispanicâ
1
Strixner, Johann Nepomuk: Albrecht Dürers christlich-mythologische Handzeichnungen
6
Strombeck, Friedrich Karl von: Ovids Heilmittel der Liebe in der Versart des Originals mit erläuternden Anmerkungen und einer Skize von dem Leben des Dichters
1
Strombeck, Friedrich Karl von: Tibullʼs Elegien, lateinisch und deutsch
1
Stuart, Maria: (Gedichte)
1
Stuhr, Peter Feddersen: Allgemeine Geschichte der Religionsformen der heidnischen Völker
1
Stuhr, Peter Feddersen: Die chinesische Reichsreligion und die Systeme der indischen Philosophie in ihrem Verhältniss zu Offenbarungslehren
2
Stuhr, Peter Feddersen: Untersuchungen über die Ursprünglichkeit und Altertümlichkeit der Sternkunde unter den Chinesen und Indiern und über den Einfluß der Griechen auf den Gang ihrer Ausbildung
1
Sturdza, Aleksandr S.: Coup dʻoeil sur les universites de lʻAllemagne
1
Sturdza, Aleksandr S.: Mémoire sur lʼétat actuel de lʼAllemagne
2
Suchenwirt, Peter: Peter Suchenwirtʼs Werke aus dem XIV. Jahrhunderte
1
Süvern, Johann Wilhelm: Über Schillers Wallenstein in Hinsicht auf griechische Tragödie
1
Süvern, Johann Wilhelm: Wiedergeburt; im Herbste 1800
1
Swinden, Jan Hendrik van: Lijkrede op Pieter Nieuwland
1
Tacitus, Cornelius: Germania [Ü: Karl Ludwig von Woltmann]
1
Talvj: Die Unächtheit der Lieder Ossian’s und des Macpherson’schen Ossian’s insbesondere
1
Tasso, Torquato: Befreytes Jerusalem [Ü: Johann Diederich Gries]
16
Tasso, Torquato: La Jérusalem délivrée [Ü: Pierre-Marie-François-Louis Baour-Lormian]
1
Taylor, John: Prabôdha Chandrôdaya or Rise of the Moon of Intellect. A Spiritual Drama and, Âtma Bodha or The Knowledge of Self
1
Terentius Afer, Publius: Die Brüder [Ü: Friedrich Hildebrand von Einsiedel]
3
Terentius Afer, Publius: Die Brüder [Ü: Karl Ludwig von Knebel]
1
Terentius Afer, Publius: Eunuchus
1
Ternite, Wilhelm: Le Couronnement de la Saint Vierge, et les miracles de Saint Dominique
4
Ternite, Wilhelm: Mariä Krönung und die Wunder des heiligen Dominicus, nach Johann von Fiesole, in 15 Blättern
6
The Gita-Govinda or, Songs of Jayadeva [Ü: William Jones]
1
The History of King Leir and his three daughters. In: John Nichols (Hg.): Six Old Plays on which Shakespeare founded his King Lear [...]. Bd. 2
1
The Mahábhárata. An Epic Poem, written by the celebrated Veda Vyása Rishi (4 Bde., 1834–1839)
8
Theocritus: Bion und Moschos [Ü: Johann Heinrich Voß]
1
Théremin, Charles-Guillaume: Des intérets des puissances continentales relativement a l’Angleterre
1
The Troublesome Reign of King John. In: John Nichols (Hg.): Six Old Plays on which Shakespeare founded his King Lear [...]. Bd. 2
1
Thiersch, Friedrich Wilhelm: Über gelehrte Schulen mit besonderer Rücksicht auf Bayern
1
Tholuck, August: Rabbinische Sprache und Literatur
1
Thorild, Thomas: Maximum sive Archimetria
4
Thorkelin, Grímur Jónsson: De Danorum rebus gestis secul. III & IV. Poëma Danicum dialecto Anglosaxonica
1
Thorvaldsen, Bertel: Auguste Böhmer, ihrer Mutter Caroline ein Trinkgefäß reichend
8
Thorvaldsen, Bertel: Basreliefs
2
Thorvaldsen, Berthel: Briseis und Achilles
1
Thorvaldsen, Berthel: Büste der Auguste Böhmer
4
Thucydides: Acht Bücher der Geschichte [Ü: Johann David Heilmann]
1
Thucydides: Thukydides’s Geschichte des Peloponnesischen Krieges [Ü: Hieronymus Müller]
1
Thümmel, Moritz August von: Reisen in die mittäglichen Provinzen von Frankreich im Jahre 1785–1786
1
GND
Tibullus, Albius: Sehnsucht nach Frieden [Ü: Karl Franz Christian Wagner]
1
Tieck, Christian Friedrich: Achills Kampf mit den Flüssen
1
Tieck, Christian Friedrich: (Altarblatt für Karl Gottlob Albrecht von Hardenberg)
2
Tieck, Christian Friedrich: Basrelief für Jacques Neckers Grabmal
51
Tieck, Christian Friedrich: (Basrelief mit Admetos und Alkestis)
2
Tieck, Christian Friedrich: Basreliefs an der Haupttreppe des Weimarer Schlosses
9
Tieck, Christian Friedrich: Bildnis des Nicolaus von der Flühe
1
Tieck, Christian Friedrich: Bildnis von Albertine Ida Gustavine de Broglie
11
Tieck, Christian Friedrich: Bildnis von Maria Rosina Haller (geb. Müslin)
7
Tieck, Christian Friedrich: Bildsäule von Friedrich Wilhelm II.
1
Tieck, Christian Friedrich: Bronzeplakette von August Wilhelm von Schlegel
1
Tieck, Christian Friedrich: Büste des August Wilhelm von Schlegel
1
Tieck, Christian Friedrich: Büste des Grafen Reuß
1
Tieck, Christian Friedrich: Büste des Herrn Smith
2
Tieck, Christian Friedrich: Büste des Johann Heinrich Voß
2
Tieck, Christian Friedrich: Büste von Albertine Ida Gustavine de Broglie
11
Tieck, Christian Friedrich: Büste von Albrecht, Friedland, Herzog
4
Tieck, Christian Friedrich: Büste von Alexander von Humboldt
5
Tieck, Christian Friedrich: Büste von Anne Louise Germaine de Staël-Holstein
7
Tieck, Christian Friedrich: Büste von Auguste Böhmer
22
Tieck, Christian Friedrich: Büste von August Hermann Niemeyer
1
Tieck, Christian Friedrich: Büste von August Wilhelm von Schlegel
7
Tieck, Christian Friedrich: Büste von August Wilhelm von Schlegel
29
Tieck, Christian Friedrich: Büste von Bernhard, Sachsen-Weimar, Herzog (Bernhard)
3
Tieck, Christian Friedrich: Büste von Caroline Friederike von Berg
3
Tieck, Christian Friedrich: Büste von Catharina von Kalkreuth
2
Tieck, Christian Friedrich: Büste von Elisabeth, Preußen, Königin
1
Tieck, Christian Friedrich: Büste von Friederike Unzelmann (Bethmann)
1
Tieck, Christian Friedrich: Büste von Friederike von Reden
1
Tieck, Christian Friedrich: Büste von Friedrich August Wolf
2
Tieck, Christian Friedrich: Büste von Friedrich Heinrich Jacobi
3
Tieck, Christian Friedrich: Büste von Friedrich Schiller
1
Tieck, Christian Friedrich: Büste von Friedrich Wilhelm Joseph von Schelling
10
Tieck, Christian Friedrich: Büste von Giulio Maria Della Somaglia
7
Tieck, Christian Friedrich: Büste von Gotthold Ephraim Lessing
3
Tieck, Christian Friedrich: Büste von Johann Gottfried von Herder
5
Tieck, Christian Friedrich: Büste von Johann Gottlieb Fichte
2
Tieck, Christian Friedrich: Büste von Johann Wolfgang von Goethe
21
Tieck, Christian Friedrich: Büste von John Rocca
12
Tieck, Christian Friedrich: Büste von Karl Friedrich
2
Tieck, Christian Friedrich: Büste von Karoline Jagemann
1
Tieck, Christian Friedrich: Büste von Ludwig (I., Bayern, König)
2
Tieck, Christian Friedrich: Büste von Ludwig Tieck
3
Tieck, Christian Friedrich: Büste von Luise von Voß
3
Tieck, Christian Friedrich: Büste von Maria Anna (Erzherzogin, Österreich)
3
Tieck, Christian Friedrich: Büste von Maria Pawlowna (Sachsen-Weimar-Eisenach, Großherzogin)
3
Tieck, Christian Friedrich: Büste von Nikolaus, von Flüe, Heiliger (Niklaus von Flüe)
2
Tieck, Christian Friedrich: Castor und Pollux
1
Tieck, Christian Friedrich: Danaë
1
Tieck, Christian Friedrich: Der Raub des Hylas
5
Tieck, Christian Friedrich: (Frontons am Konzerthaus Berlin)
2
Tieck, Christian Friedrich: Grabdenkmal für Auguste Böhmer
28
Tieck, Christian Friedrich; Haas, Meno: Medusa
1
Tieck, Christian Friedrich: Hermaphrodit und Salmacys
1
Tieck, Christian Friedrich: Köpfe aus Raffaels Transfiguration
1
Tieck, Christian Friedrich: Kreidezeichnung von Albertine Ida Gustavine de Broglie
8
Tieck, Christian Friedrich: Marmorstatue von Jacques Necker
12
Tieck, Christian Friedrich: Mater Dolorosa (verschollen)
1
Tieck, Christian Friedrich: Miniaturbild von August Wilhelm von Schlegel
1
Tieck, Christian Friedrich: Neoptolemus, der den Priamus umbringt
1
Tieck, Christian Friedrich: Pastellbildnis von Friedrich Wilhelm Joseph von Schelling
2
Tieck, Christian Friedrich: Porträt von Anne Louise Germaine de Staël-Holstein
6
Tieck, Christian Friedrich: Porträt von August Wilhelm von Schlegel
1
Tieck, Christian Friedrich: Porträt von David Müslin
1
Tieck, Christian Friedrich: Porträt von Frau Hermann (Bern)
3
Tieck, Christian Friedrich: Porträt von Ludwig Tieck
3
Tieck, Christian Friedrich: Porträt von Luise (Preußen, Königin)
1
Tieck, Christian Friedrich: Porträt von Pfarrer M. aus Bern
2
Tieck, Christian Friedrich: Porträt von Sophie Bernhardi geb. Tieck
1
Tieck, Christian Friedrich: Porträtzeichnung von Friedrich Wilhelm Joseph von Schelling
3
Tieck, Christian Friedrich: Relief einer Caritas in Gips
1
Tieck, Christian Friedrich: Schlegel, August Wilhelm von: Ion (Kostümentwürfe)
5
Tieck, Christian Friedrich: Selbstbildnis für einen Freund
2
Tieck, Christian Friedrich: (Skulptur-Arbeiten in Gips für August Wilhelm Schlegel)
1
Tieck, Christian Friedrich: Statue von August Wilhelm Iffland
1
Tieck, Christian Friedrich: Verzeichnis der antiken Bildhauerwerke des Königlichen Museums zu Berlin
1
Tieck, Christian Friedrich: Vignetten zu August Wilhelm von Schlegels Elegie „Rom“
11
Tieck, Christian Friedrich: Vignette zu August Wilhelm von Schlegels Drama „Ion“
2
Tieck, Christian Friedrich: Werke
23
Tieck, Christian Friedrich: (Zeichnung der Sigune)
2
Tieck, Christian Friedrich: Zeichnungen
2
Tieck, Christian Friedrich: Zeichnung von Albertine Ida Gustavine de Broglie
1
Tieck, Christian Friedrich: Zeichnung zu Ludwig Tiecks "Kaiser Octavianus"
2
Tieck, Ludwig: Abendgespräche
1
Tieck, Ludwig: An A. W. Schlegel
1
Tieck, Ludwig: An Novalis
4
Tieck, Ludwig: Anti-Faust oder Geschichte eines dummen Teufels
6
Tieck, Ludwig: Auf der Reise
3
Tieck, Ludwig: Bacchus läßt die Rebe sprießen
1
Tieck, Ludwig: Bemerkungen über Parteilichkeit, Dummheit und Bosheit bei Gelegenheit der Herren Falk, Merkel und des Lustspiels Chamäleon
5
Tieck, Ludwig: Briefe über Shakespeare
10
Tieck, Ludwig: Das Leben des Novalis
1
Tieck, Ludwig: Das Zauberschloß
1
Tieck, Ludwig: Der Besuch
1
Tieck, Ludwig: Der getreue Eckart und der Tannhäuser
5
Tieck, Ludwig: Der neue Frühling
1
Tieck, Ludwig: Der neue Hercules am Scheidewege
1
Tieck, Ludwig: Der Pokal
1
Tieck, Ludwig: Der Schutzgeist
1
Tieck, Ludwig: Der Sturm
3
Tieck, Ludwig: Der Zornige
2
Tieck, Ludwig: Dichterleben
1
Tieck, Ludwig: Die Gesellschaft auf dem Lande
3
Tieck, Ludwig: Die Glocke von Arragon
1
Tieck, Ludwig: Die Kupferstiche nach der Shakspeare (Shakespeare)-Galerie in London
1
Tieck, Ludwig: Die vier Heymonskinder
1
Tieck, Ludwig: Die Vogelscheuche
1
Tieck, Ludwig: Die wilde Engländerin
1
Tieck, Ludwig: Die Zeichen im Walde
11
Tieck, Ludwig: Dramatische Werke
1
Tieck, Ludwig: Durch die Himmel zieht der Vögel Zug
1
Tieck, Ludwig: Ein Prolog
1
Tieck, Ludwig: Einsamkeit
3
Tieck, Ludwig: Elfen
1
Tieck, Ludwig: Epicoene oder das stumme Mädchen, ein Lustspiel von Ben Jonson
1
Tieck, Ludwig: Erinnerung und Ermunterung
1
Tieck, Ludwig: Erklärung die Allgemeine Litteratur-Zeitung betreffend
1
Tieck, Ludwig: Fortunat
4
Tieck, Ludwig: Gedichte
2
Tieck, Ludwig: Gedichte über die Musik
4
Tieck, Ludwig: Gedichte über Musiker
2
Tieck, Ludwig: Gesammelte Novellen
1
Tieck, Ludwig: Heldenbuch
1
Tieck, Ludwig: Herbstlied
3
Tieck, Ludwig (Hg.): Frauendienst
2
Tieck, Ludwig: Historien-Zyklus über den Dreißigjährigen Krieg
2
Tieck, Ludwig: Karl von Berneck
2
Tieck, Ludwig: König Rother
1
Tieck, Ludwig: Kunst und Liebe
3
Tieck, Ludwig: Lebens-Elemente
2
Tieck, Ludwig: Liebeszauber
2
Tieck, Ludwig: Moses
1
Tieck, Ludwig: Neuer Frühling
2
Tieck, Ludwig: (Nibelungen-Bearbeitungen)
6
Tieck, Ludwig: Novellen
6
Tieck, Ludwig: Phantasus
13
Tieck, Ludwig: Ritter Blaubart
6
Tieck, Ludwig: Romantische Dichtungen
11
Tieck, Ludwig: Rudolf von Felseck
1
Tieck, Ludwig: Sämtliche Werke
1
Tieck, Ludwig: Sanftmuth
3
Tieck, Ludwig: Schlegel, August Wilhelm von: Shakespeare, William: Dramatische Werke [Ü: August Wilhelm von Schlegel] (Rezension) (erschienen?)
9
Tieck, Ludwig: Schriften
3
Tieck, Ludwig: Sehr wunderbare Historie von der Melusina
2
Tieck, Ludwig: Siegfried der Drachentöter
2
Tieck, Ludwig: Siegfrieds Jugend
2
Tieck, Ludwig: Skakespeareʼs Behandlung des Wunderbaren
1
Tieck, Ludwig: (Sonette)
2
Tieck, Ludwig: Sonette
3
Tieck, Ludwig: The life of poets
1
Tieck, Ludwig: Tragödie vom Leben und Tod des kleinen Rothkäppchens
2
Tieck, Ludwig: Über Shakespeare
3
Tieck, Ludwig: Volksmährchen von Peter Leberecht
18
Tieck, Ludwig; Wackenroder, Wilhelm Heinrich: Herzensergießungen eines kunstliebenden Klosterbruders
10
GND
Tieck, Ludwig: Wenn ich durch die Gassen schwärme
1
Tieck, Ludwig: Wer hat den lieben Frühling aufgeschlagen
1
Tieck, Ludwig: Wundersame Liebesgeschichte der schönen Magelone und des Grafen Peter von Provence
4
GND
Tiedge, Christoph August: Episteln
1
Timanthes: Iphigenie
1
Tischbein, Johann Friedrich August: Porträt von Auguste Böhmer
5
Tischbein, Johann Friedrich August: Porträt von August Wilhelm von Schlegel
8
Tischbein, Johann Friedrich August: Porträt von Carl August Böttiger
1
Tischbein, Johann Friedrich August: Porträt von Caroline von Schelling
1
Tischbein, Johann Friedrich August: Porträt von Christoph Martin Wieland
1
Tischbein, Johann Friedrich August: Porträt von Johann Gottfried von Herder
1
Tischbein, Johann Friedrich August: (Szene aus dem Agathon)
2
Tischbein, Johann Heinrich Wilhelm: Bilder zu Anacreon
1
Tischbein, Johann Heinrich Wilhelm: Porträt von Gustav von Seckendorf als Christus
1
Tod, James: An Account of Greek, Parthian, and Hindu Medals, found in India
1
Tod, James: Annals and Antiquities of Rajast'han or the Central and Western Rajpoot States of India
1
Tomkins, Thomas: Lingua
1
Torfason, Þormóður: Series dynastarum et regum Daniae
1
Törring, Josef August von: Kaspar der Thorringer
1
Tressan, Louis Élisabeth de La Vergne de: Corps d’extraits des romans de chevalerie
2
Tressan, Louis Élisabeth de La Vergne de: Tristan de Leonois
2
Tristran. In: Christoph Heinrich Müller: Samlung deutscher Gedichte aus dem XII., XIII. und XIV. Jahrhundert. Zweyter Band
1
Tristrant. In: Buch der Liebe
3
Trithemius, Johannes: De origine gentis Francorum compendium
2
Troxler, Ignaz Paul Vital: Über das Leben und sein Problem
1
Turnier Buch Herzogs Wilhelm des Vierten von Bayern von 1510 bis 1545
1
Ulfilas: Ulphilae partium ab Angelo Majo [...]
2
Unger, Friederike Helene: Albert und Albertine
3
Unger, Friederike Helene: Der junge Franzose und das deutsche Mädchen
3
Unger, Friederike Helene: Die Franzosen in Berlin oder Serene an Clementinen in den Jahren 1806, 1807 und 1808
6
Unger, Friederike Helene: Gräfin Pauline
4
Unger, Friederike Helene: Melanie oder das Findelkind
4
Unger, Friederike Helene: Werke
3
Ure, Andrew: Werke
1
Urlichs, Ludwig von: Die Ursprünge Roms
4
Urlichs, Ludwig von: Ercole ed Acheloo
2
Urlichs, Ludwig von: Sopra una statua di bronzo delle Vittoria senza ale
2
Urlichs, Ludwig von: Vorlesungen
3
Uvarov, Sergej S.: Projet dʼune académie asiatique
1
Uvarov, Sergej S.: (Stiftungsrede)
1
Vagamundo, Don Federico: Fremde Blumen
1
Valckenaer, Lodewijk Caspar: Callimachi Elegiarum fragmenta cum elegia Catulli Callimachea
1
Vancouver, George: A Voyage of Discovery to the North Pacific Ocean
1
Varnhagen von Ense, Karl August: Biographische Denkmale
3
Varnhagen von Ense, Karl August (Hg.): Gedichte während des Feldzugs 1813
1
Varnhagen von Ense, Karl August (Hg.): Testimonia Auctorum de Merkelio, das ist: Paradiesgärtlein für Garlieb (Helwig) Merkel
1
Vasari, Giorgio: Le vite deʼ più eccelenti pittori, scultori ed architettori
5
Vasconcelos, Jorge Ferreira de: Eufrosina
1
Vega Carpio, Lope Félix de: Arauco domada
1
Vega Carpio, Lope Félix de: Carlos el perseguido
1
Vega Carpio, Lope Félix de: Castelvines y Monteses
2
Vega Carpio, Lope Félix de: Dorotea
1
Vega Carpio, Lope Félix de: Doze Comedias
2
Vega Carpio, Lope Félix de: Doze comedias (Bd. 20)
2
Vega Carpio, Lope Félix de: Doze Comedias (Bd. 9)
1
Vega Carpio, Lope Félix de: EI testimonio vengado
1
Vega Carpio, Lope Félix de: El casamiento en la muerte y hechos de Bernardo del Carpio
1
Vega Carpio, Lope Félix de: El cerco de Santa Fe
1
Vega Carpio, Lope Félix de: El hijo de Reduan
1
Vega Carpio, Lope Félix de: La amistad pagada
1
Vega Carpio, Lope Félix de: La comedia del molino
1
Vega Carpio, Lope Félix de: La discreta venganza
2
Vega Carpio, Lope Félix de: La Escolastica zelosa
1
Vega Carpio, Lope Félix de: La prueba de los ingenios
1
Vega Carpio, Lope Félix de: Las comedias
1
Vega Carpio, Lope Félix de: La traición bien acertada
1
Vega Carpio, Lope Félix de: Lo cierto por lo dudoso
1
Vega Carpio, Lope Félix de: Los donaires de Matico
1
Vega Carpio, Lope Félix de: Nacimiento de Urson y Valentin
1
Vega Carpio, Lope Félix de: Obras
1
Vega Carpio, Lope Félix de: Pobreza no es vileza
1
Vega Carpio, Lope Félix de: Vida y muerte de Bamba
1
Vega, Garcilaso de la: Obras, illustradas con notas
1
Veit, Philipp: Bildnis der Gräfin Julie Zichy
1
Veit, Philipp: Bildnis der Prinzessin Wilhelm (Marianne von Preußen)
1
Veit, Philipp: Das Empyreum und Gestalten aus den acht Himmeln des Paradieses (Freskenzyklus im Casino Massimo)
1
Veit, Philipp: Der Triumph der Religion
1
Veit, Philipp: Ölbildnis von Anna (Nina) Schiffenhuber-Hartl, nach. Overbeck
3
Veit, Philipp: Selbstportrait
2
Veneroni, Giovanni: Grammaire italienne
3
Venturini, Carl: Geist der kritischen Philosophie, in Beziehung auf Moral und Religion dargestellt [...]
1
Vergilius Maro, Publius: Aeneis [Ü: Johann Heinrich Voß]
1
Vergilius Maro, Publius: Georgica [Ü: Francesco Soave]
1
Vergilius Maro, Publius: Georgica [Ü: Jacques Delille]
1
Vergilius Maro, Publius: Georgica [Ü: Johann Heinrich Voß]
1
Vergilius Maro, Publius: Georgica [Ü: Juan de Guzmán]
1
Vermehren, Johann Bernhard: Briefe über Friedrich Schlegels Lucinde
1
Vetterlein, Christian Friedrich Rudolf: Chrestomathie deutscher Gedichte
1
Vic, Claude de; Vaissète, Joseph: Histoire générale de Languedoc
1
Vieyra, Antonio: A Dictionary of the Portuguese and English Languages
1
Vigée-Lebrun, Louise-Elisabeth: Portrait von Anne Louise Germaine de Staël-Holstein
1
Villefore, Joseph-François Bourgoing de: La Vie de sainte Thérèse
1
Villegas, Esteban Manuel de: Poesías Eróticas ó Amatorias
2
Villenave, Matthieu de: Pedro Calderón de la barca Henao y Riaño
2
Visconti, Ennio Quirino: A Letter From The Chevalier Antonio Canova: And Two Memoirs Read To The Royal Institute Of France On The Sculptures In The Collection Of The Earl Of Elgin
2
Viśvā-mitra
1
Vitoria, Francisco de: Werke
1
Vitruvius: De architectura
1
Vitzthum von Eckstädt, Ernst: Sosandra
1
Volkmuth, Peter: Der dreieinige Pantheismus von Thales bis Hegel
1
Volney, Constantin-François: Alphabet européen appliqué aux langues asiatiques
1
Voltaire: (Kleine philosophische Schriften)
1
Voltaire: Tragödien
1
Von der Hagen, Friedrich Heinrich; Docen, Bernhard Joseph; Büsching, Johann Gustav; Hundeshagen, Bernhard (Hg.): Museum für altdeutsche Literatur und Kunst
1
Voß, Abraham: Fideleʼs Todtenfeyer
1
Voß, Heinrich: Shakespeare, William: Dramatische Werke. Neunter Theil. Ü: August Wilhelm von Schlegel (1810) (Rezension)
3
Vossius, Gerardus Joannes: De historicis latinis
1
Voß, Johann Heinrich: Aus den Eumeniden des Aeschylus
2
Voß, Johann Heinrich: Bußlied eines Romantikers
1
Voß, Johann Heinrich: Die Weihe [Ü: Johann Heinrich Voß]
1
Voß, Johann Heinrich: G. A. Bürgers Sonette in den letzten Ausgaben der Bürgerschen Gedichte (Rezension)
1
Voß, Johann Heinrich: Gedichte
3
Voß, Johann Heinrich: Idyllen
1
Voß, Johann Heinrich: Lyrische Gedichte
1
Voß, Johann Heinrich: Mythologische Briefe
4
Voß, Johann Heinrich: Sämtliche Gedichte
2
Voß, Johann Heinrich: Verwandlungen nach P. Ovidius Naso
1
Voß, Johann Heinrich: Virgils (Vergilius) vierte Ekloge übersetzt und erklärt, angehängt ein Abschied an Herrn Heyne
1
Voß, Johann Heinrich: Zeitmessung der deutschen Sprache
17
Voss, Luise von: Gedichte
1
Vrihatkathá
2
Vullers, Johann August (Hg.): Fragmente über die Religion des Zoroaster
1
Vulpius, Christian August: Theatralische Abenteuer
1
Vulpius, Christian August: Wenn ich ein schönes Mädchen seh
1
Wagner, Adolf: Zwei Epochen der modernen Poesie in Dante, Petrarca, Boccaccio, Goethe, Schiller und Wieland
1
Wagner, Sigismund von (Hg.): Acht Schweizer-kühreihen
1
Walpole, Horace: A Catalogue of the Royal and Noble Authors of England, Scotland, and Ireland; with Lists of their Works
2
Walpole, Horace: Die Burg von Otranto [Ü: Friedrich Ludwig Wilhelm Meyer]
4
Walpole, Horace: Fugitive Pieces
1
Walpole, Horace: Historische, litterarische und unterhaltenden Schriften [Ü: August Wilhelm von Schlegel]
9
Walpole, Horace: On Modern Gardening
1
Walpole, Horace: Some Anecdotes of Painting in England
3
Walpole, Horace: The Mysterious Mother
2
Walpole, Horace: The Works
7
Weber, Wilhelm Ernst: Vorlesungen zur Aesthetik, vornehmlich in Bezug auf Goethe und Schiller
1
Weckherlin, Georg Rodolf: (Lebensbeschreibung)
1
Weißenborn, Georg Friedrich Christian: Werke
1
Welcker, Friedrich Gottlieb: (Aufsatz)
2
Welcker, Friedrich Gottlieb: Das akademische Kunstmuseum zu Bonn
1
Welcker, Friedrich Gottlieb: Der epische Zyklus oder die Homerischen Dichter
3
Welcker, Friedrich Gottlieb: Riepenhausen, Franz; Riepenhausen, Johannes: Geschichte der Malerei in Italien (Rezension)
3
Welcker, Friedrich Gottlieb: (Vorlesungen)
4
Welcker, Friedrich Gottlieb: Werke
2
Werner, Friedrich Ludwig Zacharias: Cunegunde die Heilige, Römisch-Deutsche Kaiserin
1
Werner, Friedrich Ludwig Zacharias: Der Stephansthurm
1
Werner, Friedrich Ludwig Zacharias: Der vierundzwanzigste Februar
4
Werner, Friedrich Ludwig Zacharias: Eintritt in Italien
2
Werner, Friedrich Ludwig Zacharias: Gedichte
1
Werner, Friedrich Ludwig Zacharias: Rafaello (Sanzios) Stanzen
1
Werner, Friedrich Ludwig Zacharias: Rafaello (Sanzio) von Urbino
1
Werner, Friedrich Ludwig Zacharias: Sonettenzyklus über Italien
1
Werner, Friedrich Ludwig Zacharias: Über die Tendenz der Wernerschen Schriften
1
Werner, Friedrich Ludwig Zacharias: Volk und Pöbel
1
Werner, Friedrich Ludwig Zacharias: Werke
1
Westergaard, Niels Ludvig: Radices linguae Sanscritae ad decreta grammaticorum definivit atque copia exemplorum exquisitiorum illustravit
1
Wezel, Johann Carl: Hermann und Ulrike
1
Wieland, Christian Martin: Lysias und Eubulus
1
Wieland, Christoph Martin: Briefe über die Vossische Übersetzung des Homer
1
Wieland, Christoph Martin: Die Musenalmanache für das Jahr 1797
3
Wieland, Christoph Martin: Ein Wort über Herders Metakritik zur Kritik der reinen Vernunft
1
Wieland, Christoph Martin: Geron der Adliche
1
Wieland, Christoph Martin: Neue Göttergespräche
1
Wildungen, Ludwig Karl Eberhard Heinrich Friedrich von: Neujahrswunsch an Hrn. G. J. Rath Erxleben
1
Wilford, Francis: On the ancient Geography of India
1
Wilken, Caroline: Zeichnung von Auguste Böhmer
2
Wilken, Friedrich: Geschichte der Kreuzzüge nach morgenländischen und abendländischen Berichten
1
GND
Wilken, Friedrich: Handbuch der deutschen Historie. Erste Abteilung
2
Wilken, Friedrich (Hg.): Mohammedi filii Chondschahi, vulgo Mirchondi, Historia Gasnevidarum persice
1
Wilken, Friedrich: Schlegel, Friedrich von: Über die Sprache und Weisheit der Indier (Rezension)
2
Wilkins, Charles: Bhagavat-geeta, or Dialogues of Kreeshna and Arjoon
12
Wilkins, Charles: The Heetopades of Veeshnoo-Sarma, in a Series of Connected Fables, Interspersed with Moral, Prudential and Political Maxims
19
Willeramus (Eberspergensis): Hoheliedparaphrase
1
Wilson, Horace H.: A Dictionary in Sanscrit and English. 2. ed. Translated, Amended, and Enlarged from an Original Compilation
2
Wilson, Horace H.: Analytical Account of the Pancha Tantra illustrated with occasional Translations
5
Wilson, Horace H. (Hg.): Malatimadhava
2
Wilson, Horace H.: Select Specimens of the Theatre of the Hindus
10
Wilson, Horace H.: Theater der Hinduʼs [Ü: Oskar Ludwig Bernhard Wolff]
1
Wilson, Horace H.: Vikramas und Urwasi
1
Wilson, Horace H.: Vorlesungen
1
Wilson, Horace H.: Werke
2
Winckelmann, Johann Joachim: Sendschreiben von den Herculanischen Entdeckungen
1
Winckelmann, Johann Joachim: Werke
15
Windischmann, Karl Josef Hieronymus (Hg.): Schlegel, Friedrich von: Philosophische Vorlesungen aus den Jahren 1804 bis 1806
2
Windischmann, Karl Josef Hieronymus: Ideen zur Physik
1
Wolff, Pius Alexander: Preciosa
1
Wolf, Friedrich August: Briefe an Herrn Hofrath Heyne
1
Wolf, Friedrich August: Proœmium XL
1
Wolfram, von Eschenbach: Lohengrin
1
Wollheim, Anton Edmund: De Nonnullis Padma-Purani Capitibus
1
Woltmann, Karl Ludwig von: Beitrag zu einer Geschichte des französischen Nationalcharakters
1
Woltmann, Karl Ludwig von: Geist der neuen Preussischen Staatsorganisation
1
Woltmann, Karl Ludwig von: Geschichte der englischen Revolution
1
Woltmann, Karl Ludwig von: Geschichte der europäischen Staaten
4
Woltmann, Karl Ludwig von: Geschichte der europäischen Staaten. Bd. 1: Geschichte Frankreichs. 1797
2
Woltmann, Karl Ludwig von: Geschichte der europäischen Staaten. Bd. 2.1: Geschichte Großbritanniens. 1799
2
Woltmann, Karl Ludwig von: Johann von Müller
2
Woltmann, Karl Ludwig von: Theoderich, König der Ostgothen
1
Wulfilabibel
2
Wyttenbach, Daniel Albert: Plutarchi Chaeronensis Moralia [...]
3
Yajñadattavadhaḥ
1
Yates, William: A Grammar of the Sunscrit language, on a new plan
8
Yates, William: A Sunscrit Vocabulary, containing the nouns, adjectives, verbs and indeclinable particles, most frequently occurring in the Sunscrit language, arranged in a grammatical order, with an explanation in Bengalee and English
1
Zanchi, Carlo: Il Vejo illustrato
1
Zanten, Laurens van: Ruuwe proef over het werktuiglijke der dichtkunde
1
Zelter, Carl Friedrich: Goethe, Johann Wolfgang von: An dem reinsten Frühlingsmorgen (Vertonung)
1
Zelter, Carl Friedrich: Goethe, Johann Wolfgang von: Der Gott und die Bajadere (Vertonung)
1
Zelter, Carl Friedrich: Goethe, Johann Wolfgang von: Der Zauberlehrling (Vertonung)
3
Zelter, Carl Friedrich: Schlegel, August Wilhelm: Kampaspe (Vertonung)
1
Zelter, Carl Friedrich: Schlegel, August Wilhelm von: Lebensmelodien
3
Zeune, August: Das Nibelungenlied
3
Zeune, August: Das Nibelungenlied ins Neudeutsche übertragen
2
Ziegenbalg, Bartholomäus: Tranquebar-Bibel
1
Zincgref, Julius Wilhelm: Teutsche Apophtegmata
1
Zoega, Georg: Anfang einer römischen Topographie
2
Zoega, Georg: De origine et usu obeliscorum
3
Zôhrapean, Yovhannês; Mai, Angelo: Chronique arménienne dʼEusèbe
1
Žukovskij, Vasilij A.: Die drei Gürtel [Ü: Karl Gregor von Knorring]
1
A Catalogue of Books
1
Acta societatis regiae scientiarum Upsaliensis
1
Akademie der schönen Redekünste
14
Allgemeine preußische Staats-Zeitung
6
Allgemeine Zeitschrift von Deutschen für Deutsche
5
Allgemeine Zeitung (Cotta)
15
Almanach für Theater und Theaterfreunde (hg. v. August Wilhelm Iffland)
1
Almanach romantisch-ländlicher Gemälde
1
Alpenrosen
2
Altdeutsche Wälder
3
Annalen der neuen Nationalschaubühne zu Berlin
1
Annalen der neuesten Theologischen Litteratur und Kirchengeschichte
1
Annalen der Philosophie und des philosophischen Geistes
5
Annali dellʼInstituto di Corrispondenza Archeologica / Annales de lʼInstitut de Correspondance Archéologique
2
Annals of Oriental Literature
5
Anzeiger für Litteratur, Kunst und Theater (Beilage zum Prometheus)
2
Apollon
2
Archiv der reinen und angewandten Mathematik
1
Archives littéraires de lʼEurope
1
Archiv für moralische und religiöse Bildung des weiblichen Geschlechts
1
Asiatic Researches
32
Attisches Museum
9
Augsburger allgemeine Zeitung
4
Barmer Zeitung
1
Belletristische Zeitung
6
Berliner Conversations-Blatt
6
Berliner Kalender auf das Gemein Jahr 1829
13
Berliner Kalender auf das Gemein Jahr 1831
6
Berliner Kunstblatt
2
Berlinische Monatsschrift
16
Berlinischer Damen-Kalender
14
Beyträge zur leichtern Uebersicht des Zustandes der Philosophie beym Anfange des 19. Jahrhunderts
1
Bibliothek der schönen Wissenschaften und Künste
5
Blätter für literarische Unterhaltung
4
Bonner Wochenblatt
3
Braga und Hermode oder Neues Magazin für die vaterländischen Alterthümer der Sprache, Kunst und Sitten
3
Bragur. Ein Literarisches Magazin der Deutschen und Nordischen Vorzeit
6
Bremer Zeitung für Staats-, Gelehrten und Handelssachen
2
Brennus. Eine Zeitschrift für das nördliche Deutschland
1
Calcutta journal of natural history, and miscellany of the arts and sciences in India
1
Civilistisches Magazin
1
Cölnische Zeitung
1
Concordia
4
Corpus Byzantinae historiae
1
Corpus Inscriptionum graecarum
1
Corpus Scriptorum Historiae Byzantinae
1
Cupido, ein poetisches Taschenbuch auf 1804
2
Das Mittelalter (Zeitschriftenplan von August Wilhelm und Friedrich Schlegel)
14
Das Sonntagsblatt
3
Der Bazar. Tagsblatt aus Stuttgart
3
Der Freymüthige
9
Der Kosmopolit
2
Der Telegraph. Berlin (Tageszeitung 1806–1808).
1
Der Teutsche Merkur
2
Deutscher Musenalmanach (hg. v. Adelbert von Chamisso und Gustav Schwab, 1833–1839)
6
Deutsches Museum
37
Deutsche Viertel-Jahrsschrift
1
Deutschland
16
Dichtergarten. Erster Gang
31
Die Horen
98
Die Jahreszeiten. Eine Vierteljahrsschrift für romantische Dichtungen (hg. v. Friedrich de la Motte-Fouqué)
1
Die Wage. Eine Zeitschrift für Bürgerleben, Wissenschaft und Kunst
1
Erholungen
11
Erlanger Litteratur-Zeitung
20
Eunomia
4
Europa. Eine Zeitschrift
52
Flora. Teutschlands Töchtern geweiht von Freundinnen und Freunden des schönen Geschlechts
1
Fränkischer Kurier
1
Frankreich im Jahre ... Aus den Briefen Deutscher Männer in Paris
1
Frauentaschenbuch
1
Fundgruben des Orients, bearbeitet durch eine Gesellschaft von Liebhabern
4
Gartenkalender
1
Gelehrte Anzeigen. Königlich Bayerische Akademie der Wissenschaften zu München. Hg. v. Mitgliedern der Königlich Bayerischen Akademie der Wissenschaften zu München
1
Geschichte und Politik
1
Gothaische gelehrte Zeitungen auf das neunzehnte Jahrhundert
1
Göttinger Musen-Almanach
15
Göttingischer Taschenkalender
2
Göttingisches Philosophisches Museum
1
Hamburgische Addreß-Comptoir-Nachrichten
1
Hannoversche Zeitung (1832–1857)
1
Heidelbergische Jahrbücher der Literatur. 1. Abtheilung: Theologie, Philosophie und Pädagogik / Heidelbergische Jahbücher der Literatur für Theologie, Philosophie und Pädagogik (1808–1810)
4
Hermann. Ein Centralorgan für Rheinland und Westphalen
1
Hermes oder kritisches Jahrbuch der Literatur
1
Histoire de l'Académie Royale des Inscriptions et Belles-Lettres
1
Historischer Calender für Damen (1790–1794)
3
Idunna und Hermode. Eine Alterthums-Zeitung
1
Indische Bibliothek. Eine Zeitschrift von August Wilhelm von Schlegel
184
Jahrbuch der Preußischen Rhein-Universität
8
Jahrbücher der Kunst und Wissenschaft (Zeitschriftenplan von Johann Gottlieb Fichte und Karl Ludwig von Woltmann)
14
Jahrbücher der Medizin und Wissenschaft
6
Jahrbücher der preußischen Monarchie unter der Regierung Friedrich Wilhelms III.
7
Jahrbücher der Wissenschaft und Kunst für Deutschland (Zeitschriftenplan von August Wilhelm und Friedrich von Schlegel und Friedrich Schleiermacher)
34
Jahrbücher des Vereins von Alterthumsfreunden im Rheinlande
1
Jahrbücher für wissenschaftliche Kritik
16
Journal Asiatique
46
Journal de lʼEmpire
6
Journal de Paris
1
Journal des Luxus und der Moden
4
Journal des savants
6
Journal du commerce, de politique et de littérature
2
Journal för Litteratur och Theater
1
Journal général de France
2
Journal of the Asiatic Society of Bengal
2
Journal zur Kunstgeschichte und zur allgemeinen Literatur
1
Kalender auf das Jahr 1801
1
Kinderfreund
1
Kölnische Zeitung
7
Königlich Preußische Kalender-Deputation (1825–1849)
1
Königlich privilegirte Berlinische Zeitung von Staats- und gelehrten Sachen
2
Kritisches Journal der Philosophie
20
Kronos. Ein Archiv der Zeit
3
Kunst-Blatt (genannt: „Schornʼs Kunstblatt“; Beilage zum „Morgenblatt für gebildete Stände“)
9
Kynosarges
6
La Gazette de Leyde
1
La Minerve Française
1
La Quotidienne
1
Le Censeur Européen
3
Le Conservateur. Journal de littérature, de sciences et de beaux-arts
1
Le Courrier français
2
Leipziger Jahrbuch der neuesten Litteratur vom Jahre 1800
1
Leipziger Monatsschrift für Damen
7
Le Publiciste
6
Le Quotidien
2
Literarischer Zodiacus. Journal für Zeit und Leben, Wissenschaft und Kunst
1
Lyceum der schönen Künste
15
LʼAmbigu, ou Variétés littéraires et politiques
5
LʼÉcho de Vaucluse
1
LʼEsprit des journaux françois et étrangers par une société de Gens-de-Lettres
1
LʼEurope Litteraire, Journal De la Littérature Nationale et Etrangère.
1
Magazin für Erfahrungsseelenkunde
1
Memnon
2
Mémoires de l'Institut national des sciences et arts. Littérature et beaux arts
1
Minerva
2
Mitternachtsblatt für gebildete Stände
1
Monatliche Correspondenz zur Beförderung der Erd- und Himmelskunde
1
Morgenblatt für gebildete Stände
37
Morgenlændische Alterthümer (hg. v. Wilhelm Dorow)
1
Morning Chronicle (London)
4
Musen-Almanach 1776–1800 (hg. v. Johann Heinrich Voß)
3
Musen-Almanach 1796ff. (hg. v. Friedrich Schiller)
14
Musenalmanach 1796 (hg.v. Karl Reinhard)
1
Musen-Almanach 1802ff. (hg. v. August Wilhelm von Schlegel und Ludwig Tieck; nur ein Jahrgang erschienen)
3
Musenalmanach 1830–1832 (hg. v. Amadeus Wendt)
2
Musenalmanach auf das Jahr 1806 (hg. v. Adelbert von Chamisso und Karl August Varnhagen von Ense)
3
Musen-Almanach für 1800. Der lezte (hg. v. Johann Heinrich Voß)
3
Musen-Almanach für das Jahr 1796 (hg. v. Friedrich Schiller)
30
Musen-Almanach für das Jahr 1796 (hg. v. Johann Heinrich Voß)
4
Musen-Almanach für das Jahr 1797 (hg. v. Johann Heinrich Voß)
2
Musen-Almanach für das Jahr 1798 (sog. „Balladen-Almanach“) (hg. v. Friedrich Schiller)
21
Musen-Almanach für das Jahr 1799 (hg. v. Friedrich Schiller)
10
Musenalmanach für das Jahr 1807 (hg. v. Franz Karl Leopold von Seckendorf-Aberdar)
1
Musenalmanach für das Jahr 1831 (hg. v. Amadeus Wendt)
2
Musenalmanach für das Jahr 1832 (hg. v. Amadeus Wendt)
3
Musen-Almanach für die Jahre 1802 (und 1803) (hg. v. Johann Bernhard Vermehren)
11
Musenalmanach, oder poetische Blumenlese, aufs Jahr 1787 (Göttingen, hg. v. Gottfried August Bürger u.a.)
1
Musenalmanach, oder poetische Blumenlese, aufs Jahr 1789 (Göttingen, hg. v. Gottfried August Bürger u.a.)
1
Musenalmanach, oder poetische Blumenlese, aufs Jahr 1790 (Göttingen, hg. v. Gottfried August Bürger u.a.)
1
Musenalmanach, oder poetische Blumenlese, aufs Jahr 1791 (Göttingen, hg. v. Gottfried August Bürger u.a.)
1
Musenalmanach, oder poetische Blumenlese aufs Jahr 1792 (Göttingen, hg. v. Gottfried August Bürger u.a.)
6
Musenalmanach, oder poetische Blumenlese aufs Jahr 1793 (Göttingen, hg. v. Gottfried August Bürger u.a.)
2
Museum der Altertums-Wissenschaft
3
Museum für altdeutsche Literatur und Kunst
11
Musikalisches Taschenbuch auf das Jahr 1803
1
Nachrichten von gelehrten Sachen
2
Nekrolog auf das Jahr 1793
4
Nemesis. Zeitschrift für Politik und Geschichte
1
Neue allgemeine deutsche Bibliothek
4
Neue allgemeine deutsche Bibliothek
1
Neue Berlinische Monatsschrift
1
Neuer literarischer Anzeiger. Eine Zeitschrift aus dem Gebiete der Litteratur und Kunst
5
Neuer Nekrolog der Deutschen (1824–1854)
1
Neues Hannöverisches Magazin
2
Neues Museum der Philosophie und Literatur
1
Neueste Critische Nachrichten
1
Neue Thalia (1.1792–4.1793)
15
Neue Zeitschrift für speculative Physik
14
Neujahrs Taschenbuch von Weimar auf das Jahr 1801
3
Oppositions-Blatt oder Weimarische Zeitung
1
Oriental Herald and Colonial Review
1
Österreichische Militär-Zeitschrift
1
Österreichischer Beobachter
15
Oster-Taschenbuch von Weimar auf das Jahr 1801 (hg. v. Seckendorf)
2
Ostrakographische Hefte
1
Pantheon. Eine Zeitschrift für Wissenschaft und Kunst
1
Philomathie von Freunden der Wissenschaft und Kunst (Hg. v. Ludwig Wachler)
1
Philosophisches Journal
18
Phöbus. Ein Journal für die Kunst
4
Poetisches Journal
16
Poetisches Taschenbuch für das Jahr 1806. Von Friedrich Schlegel
18
Polychorda
3
Preußischer Korrespondent
5
Prometheus
33
Reformations-Almanach für Luthers Verehrer auf das evangelische Jubeljahr 1817 (Hg. v. Friedrich Keyser und Joh. Fr. Möller)
1
GND
Revue des deux mondes
11
Revue encyclopédique
2
Revue française
2
Rheinische Blätter
2
Rheinisches Museum für Philologie (hg. v. Friedrich Gottlieb Welcker und August Ferdinand Naeke)
4
Rheinisches Odeon
1
(Römisches Wochenblatt)
1
Russische Bibliothek für Deutsche
1
Svea. Tidskrift för vetenskap och konst
2
Taschenbuch auf das Jahr 1801 für Damen
2
Taschenbuch auf das Jahr 1802. Der Liebe und Freundschaft gewidmet
1
Taschenbuch auf das Jahr 1804. Von Wieland und Goethe
1
Taschenbuch für Damen
6
Taschenbuch für das Jahr 1803. Der Liebe und Freundschaft gewidmet
2
Taschenbuch für edle teutsche Frauen
1
Taschenbuch für Freunde der Poesie des Südens
1
Taschenbuch für Freunde des Scherzes und der Satire
13
Taschenbuch für Kunst und gute Laune
2
Taschenbuch für vaterländische Geschichte
1
Taschenbuch zum geselligen Vergnügen
15
Thalia (1.1785/87(1787)–3.1790/91(1791))
2
The Asiatic Journal and Monthly Miscellany
3
The Courier
1
The Foreign Quarterly Review
2
The Literary Gazette, and Journal of Belles Lettres, Arts, Sciences
5
The Madras Courier
1
The Mirror of Fashion
1
The New Monthly Magazine
6
The Quarterly Review
6
Transactions of the Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland
30
Tsa-la-gi tsu-le-hi-sa-no-hi. A Cherokee Phoenix. Hg. v. Elias Boudinot for the Cherokee Nation (1828–1834)
1
Urania. Taschenbuch für Damen auf das Jahr 1812
2
Urania. Taschenbuch für das Jahr 1810
1
Vaterländische Blätter für den österreichischen Kaiserstaat
2
Vaterländisches Museum
6
Vyasa. Ueber Philosophie, Mythologie, Literatur und Sprache der Hindu. Eine Zeitschrift von Dr. Othmar Frank
1
Westphälische Provinzial-Blätter
1
Wiener Zeitung
1
Zeitgenossen. Biographien und Charakteristiken
3
(Zeitschrift aus Speyer)
2
Zeitschrift für deutsches Alterthum und deutsche Literatur
1
Zeitschrift für die Kunde des Morgenlandes
14
Zeitschrift für spekulative Physik
13
Zeitschwingen oder Des deutschen Volkes fliegende Blätter
1
Zeitung aus dem Feldlager
1
Zeitung für die elegante Welt
21
Zeitung für Einsiedler
7
Zur Morphologie
1