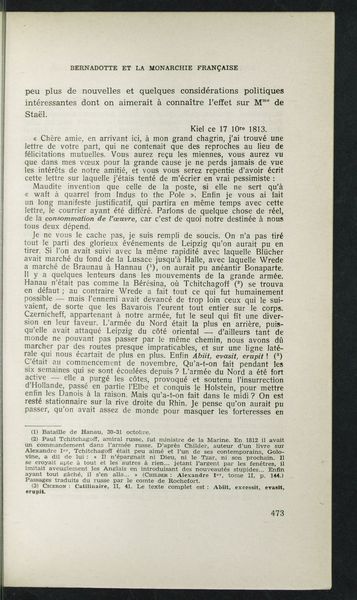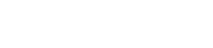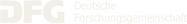Ich verhehle Ihnen nicht, ich habe große Sorgen. Die ruhmvollen Erfolge von Leipzig hat man nicht so ausgenutzt, wie man es hätte tun müssen. Hätte man mit derselben Schnelligkeit die Verfolgung aufgenommen, wie Blücher hinten aus der Lausitz nach Halle oder Wrede von Braunau nach Hanau vorstieß, so hätte man Bonaparte vernichten können. Aber die große Armee bewegte sich zu langsam vorwärts. Hanau war keine Beresina, wo Tschitschagoff Fehler machte; im Gegenteil: Wrede hat alles getan, was menschenmöglich war – aber der Feind war zu weit vor seinen Verfolgern voraus, sodaß ihn die Bayern ganz allein auf dem Hals hatten. Czernischeff, der zu unserer Armee gehörte, war der einzige, der durch einen Seitenangriff die Bayern entlastete. Die Nordarmee war am weitesten zurück, da sie Leipzig von Osten aus angegriffen hatte – im übrigen konnten so viele Menschen nicht auf denselben Wegen marschieren, und so mußten wir auf fast unwegsamen Straßen vorwärtsziehen und noch dazu auf Seitenstraßen, die uns mehr und mehr von den anderen entfernten. Endlich abiit, evasit, erupit! Das war Anfang November. Was hat man in den sechs Wochen, die seither vergangen sind, getan? Die Nordarmee war sehr tätig – sie säuberte die Küsten, schürte den Aufstand in Holland und hielt ihn wach, überschritt zum Teil die Elbe und eroberte Holstein, um die Dänen endlich zur Vernunft zu bringen. Aber was tat man im Süden? Man blieb beharrlich auf dem rechten Rheinufer stehen. Warum ging man nicht hinüber? Truppen waren genug da, um die Festungen einzuschließen und geradenwegs auf Paris zu marschieren. Urteilen Sie selber, wie wenig Truppen im Innern gestanden haben müssen, wenn ich authentische Beweise dafür in Händen habe, daß Ende September in Paris und im ganzen Bezirk der ersten Division nicht mehr als 2000 Mann zur Verfügung waren. Schien dieser Plan zu gewagt, so konnte man zum wenigsten mit 60000 M[ann] gegen die Schweiz marschieren; man konnte den Regierungshäuptern die Hände binden, die in ihrer Anhänglichkeit an Frankreich sich so kleinmütig zeigten, während alle anderen Völker sich gegen den Eroberer zusammentun; dann konnte man in der Schweiz über den Rhein gehen, dann den Jura überschreiten, der ganz unverteidigt ist, Italien in den Rücken fallen und den Vicekönig zwischen zwei Feuer nehmen. Zum mindesten hätte man einen gewandten Führer eines Streifkorps mit Kosaken durch Südfrankreich schicken und Lord Wellington unsere Grüße bestellen lassen können. Das wäre schon wegen des Aufsehens, das es gemacht hätte, eine schöne Sache gewesen und hätte überall Schrecken und Unordnung verbreitet. Ein solcher Husarenritt hätte zu gleicher Zeit dazu dienen können, offizielle Kundgebungen an das französische Volk zu verbreiten. Sie werden aus der Erklärung vom 1. Dez[ember] sehen, daß die Verbündeten verhandelt, daß sie als Grundlage wieder die Bestimmungen des Friedens von Lunéville vorgeschlagen haben. Nach der Zurückweisung ihres Angebots wenden sie sich nun an das französische Volk. Das ist wenigstens etwas! Aber mit welcher Schonung tun sie es! Die Worte: ›Seine Majestät der Kaiser der Franzosen‹ tun meinen Augen weh. Der Schwung der Völker ist bewunderungswürdig – man könnte daraus alle erdenkbaren Vorteile ziehen, aber ich fürchte die Regierungen, d. h. Schwächen, Hintergedanken, Schwankungen, halbe Maßregeln.
Sollte Friede geschlossen werden, selbst ein scheinbar guter, ohne daß Napoleon entthront wird, so werden wir in zwei Jahren wieder anfangen müssen. Dann aber werden die Völker nicht mehr so begeistert sein und es wird keine Möglichkeit geben, die gleiche Koalition noch einmal ins Leben zu rufen. Ein anderer Nachteil eines vorzeitigen Endes dieses großen Kampfes wäre, daß das System der nationalen Verteidigung, das heute überall organisiert wird, in vielen Ländern noch nicht hat auf die Probe gestellt werden können. Zuerst wäre es für unsereinen vielleicht noch möglich auf dem Kontinent zu wohnen, aber allmählich würde die Schonung, die man dem mächtig gebliebenen Mann hat angedeihen lassen, sich siegreich im Sinne seines Systems entwickeln, und man könnte einfach nicht mehr existieren und vor allem nicht schreiben, was man will.
Die Schweizer proklamieren etwas albern ihre Neutralität, während sie doch Vasallen Frankreichs sind und der Gesandte Frankreichs ganz offen ihrer Tagsatzung präsidiert. Scheinbar will man sie ihnen zugestehen. Das verwundert mich etwas, besonders weil Metternich mir in Leipzig einiges über die Schweiz sagte, das mich etwas ganz anderes mutmaßen ließ. Man hat einen geradezu abergläubischen Respekt vor diesem Land – es hat sicher eine achtungswerte Verwaltung, aber jämmerlich sind seine Beziehungen zum Ausland: Man müßte sich immer wieder an die Devise erinnern, auf die die ganze Komödie zurückgeht: ›Kein Schweizer tut etwas, wofür er sich nicht bezahlen läßt!‹ Mit 50000 Talern käme man sehr weit, wenn man Geschenke unter die führenden Männer verteilte und ihnen Pensionen für genau so lange Zeit bewilligte, wie die Schweiz sich unabhängig von Frankreich hielte. So haben es die französischen Könige immer gemacht; Bonaparte ist der erste, der ihnen derart imponiert, daß sie seine Befehle befolgen, ohne daß er ihnen Pensionen zu geben brauchte. Um wieder eine europäische Rolle zu spielen, müßte sich die Schweiz dem Deutschen Bund anschließen und sich von ihm garantieren lassen; sie muß die Provinzen wiederhaben, die man ihr abgenommen hat, besonders das Wallis. Wie könnten es die Verbündeten zulassen, daß Bonaparte den Simplon behält, um, wenn es ihm beliebt, ein Heer ins Herz Italiens zu werfen? Es wäre sehr zu wünschen – ich glaube, es läge im Interesse aller – wenn Genf wieder zur Schweiz käme, seine Industrie sich wieder entwickeln könnte und es wieder die Stadt der Aufklärung würde.
Man müßte sich über das Ziel, das man erreichen will, ganz klar sein und auch die Mittel bereitstellen, die dazu führen. Ich lege Ihnen eine sehr klare Darlegung darüber aus der Feder B[enjamin] C[onstants] bei. Ich habe sie nach Frankfurt geschickt – er hat sich selber zu dieser Mission angeboten. Zeigen Sie sie Lord Castlereagh, sobald Sie Gelegenheit dazu haben. England müßte auch einen diplomatischen Vertreter in der Schweiz haben.
Machen Sie doch um Gotteswillen den Herren so eindringlich wie möglich die Notwendigkeit klar, gegen Bonaparte eine Opposition im Innern des Landes zu entfachen. Alle Mittel sind da recht, und keine Ausgabe darf man scheuen, Schriften, die diesem Zwecke dienen können, zu vervielfachen und sie nach Frankreich hineinzubringen. Eine solche schicke ich Ihnen mit dem gleichen Kurier, die Bemerkungen über einen Artikel der Leipziger Zeitung vom 5. Oktober 1813. Sie hat in Deutschland großen Erfolg; ich hoffe, auch Ihre Zustimmung zu finden. Ich habe einen ganzen Band zum Druck fertig – es ist eine Auswahl der Abgefangenen Depeschen und Briefe mit einer Vorrede und Anmerkungen. Hauptsächlich um dieser Arbeit willen bin ich in Göttingen geblieben, aber ich fand den Prinzen so beschäftigt, daß ich noch nicht die Erlaubnis erhalten konnte, sie zu veröffentlichen. Leider ist Herr von Wetterstedt, der mir dazu verhelfen könnte, auf dem Frankfurter Kongreß und also abwesend. Ich habe zwei Abschriften vorbereitet, eine soll nach England gehen und mir Geld einbringen!
Es wäre auch sehr gut, die gesamte Reihe unserer Bulletins in Frankreich zu verbreiten. Ich habe eine Neuausgabe von ihnen veranstaltet – aber infolge der Unordnung auf der Post ist das Paket noch nicht angekommen, sonst würde ich Ihnen Exemplare schicken.
Sie werden meine deutsche Schrift über die Politik Dänemarks, die schon während des Waffenstillstandes veröffentlicht wurde, erhalten haben. Sie ist jetzt überholt; im übrigen hat sie ihren besonderen Zweck und geht Frankreich nichts an. Eine Übersetzung ins Englische wäre trotzdem nicht überflüssig gewesen, da man versucht, die öffentliche Meinung durch Schriften wie On the meditated attack upon Norway with strictury zu täuschen. Hierin schreibt man Ihnen die Broschüre über das Continentalsystem zu und glaubt, sie auf Grund einer ganz unsinnigen Übersetzung widerlegen zu können. Wer ist denn das zweifüßige Vieh, das das geschrieben hat? Es scheint ein ehemaliger Handlungsreisender aus Norwegen zu sein.
C[onstant] sieht die allgemeine Lage genau so an wie ich. Wir haben in Hannover dauernd über diese wichtige Angelegenheit geredet. Er hat den Kr[on]pr[inzen] bei seiner Durchreise oft gesprochen und ist sehr freundlich von ihm empfangen worden. Aber jetzt fühlt er sich vereinsamt. Er ist ja doch ein Mensch, der immer gestoßen werden muß, wenn er nicht in Unschlüssigkeit zurückfallen soll. Signeul ist auch ganz einer Meinung mit mir – er erscheint von Zeit zu Zeit im Hauptqu[artier], um Unheil zu prophezeien wie Kassandra.
Wir haben alle einstimmig bedauert, daß die notwendigen militärischen Operationen unsern Helden in diesem Augenblick von dem Mittelpunkt der Ereignisse und den Grenzen Frankreichs fernhalten. Ich fürchtete schon, wir würden gänzlich auf diese kimbrische oder kimmerische Halbinsel verbannt werden. Aber jetzt ist ja der Waffenstillstand da, und nun muß man sehen, ob er zu etwas führt.
Sie machen sich eine völlig falsche Vorstellung von meiner persönlichen Stellung. Der Prinz ist mir sehr gewogen; ich glaube, daß er meiner Gesinnung und meinen Fähigkeiten Gerechtigkeit widerfahren läßt, aber ich habe viel zu selten Zutritt zu ihm, um mich wirklich nützlich machen zu können. Ich könnte viel mehr tun als ich tue, wenn ich an richtiger Stelle verwandt würde. Oft aber muß ich lange warten, um eine Unterhaltung von nur einigen Minuten mit ihm haben zu können – die Zeit, die er mir bewilligt, genügt nicht, um meine Gedanken so zu entwickeln, daß er sie sich zu eigen macht. Trotzdem habe ich nie eine Gelegenheit versäumt, von Ihnen und August zu reden. Das Gedränge von Personen und Geschäften ist wirklich außerordentlich groß, und es liegt nicht in meinem Charakter, immer auf dem Sprunge zu stehen. Bitte sprechen Sie zu niemand davon, so lange die Ereignisse ihren Gang gehen und nichts endgültig festgelegt ist. Ich warte geduldig ab, bis das alles eine günstige Wendung nimmt. Ach! Wenn unsere geheimen Wünsche sich verwirklichten, könnte man alles miteinander vereinigen: das Glück einer Freundschaft und eine öffentliche Laufbahn.
Ich merke deutlich, daß Ihnen England nicht gefällt, daß es Sie verstimmt und nicht frei macht, kurzum, daß Sie oft von Langeweile gepackt werden. Reisen Sie aber trotzdem bitte nicht zu früh ab, ich würde Sie gerne vorher dort noch treffen; bei der ersten Gelegenheit werde ich um Urlaub bitten, um nach London zu kommen – jetzt ist es ja eine kurze Reise.
Liebe Freundin! Seien Sie nicht böse, daß ich Ihnen immer wieder von Geschäften schreibe. Aber im Grunde handelt es sich doch nur um unsere Zukunft, von der ich spreche, denn unser ganzes Leben hängt davon ab, was wir jetzt erreichen können.
Ich hätte Ihnen viel zu sagen. Was sage ich: viel – sehr viel, sehr, sehr viel – aber wo anfangen und wo aufhören?
Baudissin ist in der vorläufigen Verwaltung dieses Landes beschäftigt, das nimmt ihn voll und ganz in Anspruch, und ich werde ihn viel weniger sehen können. Sie machen sich keine Vorstellung, wie verhaßt die dänische Regierung hier ist; ein jeder wünscht, daß das Land der Gewalt des Königs entzogen und wieder wirklich deutsch würde – jede Veränderung, die dahin zielte, würde mit Freude aufgenommen werden, aber niemand will seine Hände dazu hergeben, die Kastanien aus dem Feuer zu holen. Über die Zustände in Hannover habe ich mich genau unterrichtet, es geht dort nicht alles so, wie es sollte, oder vielmehr nichts ist dort in Ordnung. Man hält da nicht mehr Schritt mit dem neuen, gestählten Deutschland. Nur die Ankunft des Herrn von Münster könnte da Wandel schaffen, man sagt, er sei schon auf dem Wege. Sobald ich kann, werde ich Ihnen darüber eine in die Einzelheiten gehende Denkschrift schicken.